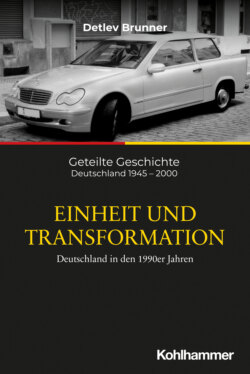Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Leitkultur
ОглавлениеIm Herbst des Jahres 2000 entbrannte eine Debatte, die zwar im Zusammenhang der Zuwanderung nach Deutschland geführt wurde, die jedoch mit ihrem definitorischem Anspruch, was »nationale Identität« sei, auch für das Ziel »innerer Einheit« der deutschen Gesellschaften in Ost und West bedeutsam war. Es ging um die deutsche »Leitkultur«. Diese kombiniert mit einem »positiven Patriotismus« konnte, so die Vorstellung, der »Kitt« für die Einheit sein, eine deutsche Leitkultur also eine »integrative Kraft« entfalten.39 Der Begriff »Leitkultur« ging ursprünglich auf den Politikwissenschaftler Bassam Tibi zurück, der ihn allerdings im europäischen Sinne verstand und die Ideale der kulturellen Moderne, der Demokratie und Zivilgesellschaft, der Aufklärung und der Trennung von Kirche und Staat darunter subsumierte. In Deutschland war es Friedrich Merz, vom Februar 2000 bis Oktober 2002 Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, der die Debatte auslöste. In einem Artikel in der Tageszeitung »Die Welt« vom 25. Oktober 2000 nahm Merz zum Thema »Einwanderung und Identität« Stellung. Er formulierte darin Grundsätze, die er für »einen gemeinsamen, wertorientierten gesellschaftlichen Konsens« als leitend erachtete. An erster Stelle nannte er die Verfassungstradition des Grundgesetzes, dieses sei »wichtigster Ausdruck unserer Werteordnung und so Teil der deutschen kulturellen Identität, die den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft erst möglich macht.« An zweiter Stelle stand die »europäische Idee« mit dem Ziel europäischer Integration. Als Drittes nannte Merz die »in Jahren und Jahrzehnten erkämpfte Stellung der Frau in unserer Gesellschaft«, die zur Identität unserer Freiheitsordnung gehöre.40 Was Merz hier formulierte, waren Selbstverständlichkeiten, die auch von der damals amtierenden Rot-Grünen Bundesregierung, an die sie letztlich adressiert waren, nicht in Frage gestellt wurden. Der kontroverse Zuschnitt wird erst im politischen Kontext deutlich – im gleichen Zeitraum der »Leitkulturdebatte« standen Fragen eines neuen Staatsbürgerrechtes und damit der Integration von Migranten auf der Tagesordnung.41
Im Verständnis dessen, was unter Staat, Nationalstaat und Nation zu verstehen sei, schieden sich die Geister. Der Freiburger Politikwissenschaftler Dieter Oberndörfer, verwies im November 2000 auf die Problematik eines noch immer vorhandenen, den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen jedoch nicht mehr angemessenen Staatsverständnisses. Ein völkisches Staatsverständnis habe die deutsche politische Kultur zutiefst geprägt, es schließe Ausländer von der Nation aus oder verlange ihre vollständige Assimilation in die »nationale« Kultur. Die völkische Nation gehe von der Vorstellung einer homogenen, für alle verbindlich definierbaren Nationalkultur aus. Als Alternative beschrieb er den demokratischen Verfassungsstaat, der sich als Staatsbürgernation verstehe, deren normatives Fundament kultureller Pluralismus und kulturelle Toleranz seien. Jene, die die »Integration der Ausländer in die deutsche Kultur« forderten, sollten die Frage beantworten: »Was ist ein integrierter Deutscher? Sind Süd- oder Norddeutsche, Katholiken, Protestanten, säkularisierte, kirchlich-konfessionell nicht gebundene Bürger, zum Islam oder Buddhismus konvertierte Deutsche, Akademiker oder Bauern, Mitglieder der SPD oder der CSU jeweils das Modell für Integration und den integrierten Deutschen?«42
Was fällt bei dieser Auflistung auf? Es fehlen »die Ostdeutschen«. Gingen die Beteiligten der Leitkultur-Debatte davon aus, dass es sich bei ihnen um »integrierte Deutsche« handelte, war ihre Integration kein Thema in dieser offenkundig vor allem von Westdeutschen geführten Diskussion? Die Frage der Integration Ostdeutschlands in die gesamtdeutsche Bundesrepublik ist zwar in jüngster Vergangenheit gestellt worden,43 aber eine breite Debatte über das, was Deutschland seit der Vereinigung als Nation ausmacht und was überhaupt unter Nation in diesem Zusammenhang zu verstehen ist, ist bislang ausgeblieben. Die Frage nach den Fundamenten nationaler Identität und damit auch »innerer Einheit« ist gleichwohl weiterhin aktuell. Reicht der von Dolf Sternberger geprägte und von Jürgen Habermas 1986 wieder aufgenommene »Verfassungspatriotismus« als Klammer der Nation aus?44 Genügt die Identifikation mit dem Grundgesetz als gesellschaftliche Grundlage? »Oder ist darüber hinaus eine Integration notwendig, die kulturellen Pluralismus als selbstverständlich anerkennt, zugleich die Forderung nach Assimilation zurückweist und doch den Gefährdungen eines freiheitlichen, demokratischen Gemeinwesens durch die Existenz von fragmentierten, nicht durch einen Wertekonsens geeinte Parallelgesellschaften Rechnung zu tragen sucht?«45 Diese im Jahr 2009 gestellte Frage wird angesichts einer zunehmenden ethnischen und kulturellen Pluralität einerseits und einer befürchteten Spaltung der Gesellschaft Deutschlands andererseits weiterhin zu diskutieren sein.