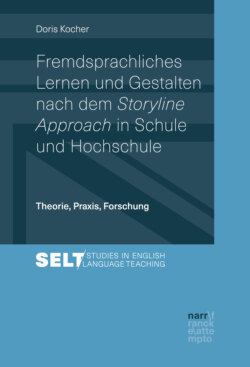Читать книгу Fremdsprachliches Lernen und Gestalten nach dem Storyline Approach in Schule und Hochschule - Doris Kocher - Страница 62
3.3.3.2 Zur Kritik am Konstruktivismus
ОглавлениеDer Konstruktivismus war in den vergangenen Jahren immer wieder das Ziel von teils heftiger Kritik aus verschiedenen Richtungen, wobei meist wenig zwischen den einzelnen Ansätzen und Positionen differenziert wurde, und man unterstellen könnte, dass manchen nicht immer bewusst war, dass es tatsächlich unterschiedliche Konzepte gibt. Dies wird auch von Reich (2012, 91) bemängelt: „Besonders peinlich ist die Rezeption in der Pädagogik. Hier wurde der Konstruktivismus z.B. entweder aus der Sicht der Systemtheorie bewertend als weniger lesenswert abgewertet (...) oder nur rudimentär dargestellt“. Im gleichen Zug hebt Reich hervor, dass im deutschen Sprachraum „die Bedeutung des Konstruktivismus in den Sozial- und Kulturwissenschaften (...) noch unterschätzt“ wird (Ebd.). Mit ein Grund dafür mag sein, dass es für Außenstehende nicht immer leicht ist, die einzelnen – zum Teil auch widersprüchlichen bzw. gegensätzlichen – Theorien einzuordnen und die – zum Teil hochkomplexen – Gedankengänge nachzuvollziehen.1 Reich (2012) hat sicher nicht unrecht mit seiner Behauptung:
Es setzt zudem ein gehöriges Literaturstudium voraus, wenn man sich mit der Fülle gerade auch impliziter Konstruktivismen vertraut machen und deren Bedeutung in den wissenschaftlichen Diskursen der Gegenwart einschätzen will. Erschreckend naiv und willkürlich verfährt daher mitunter die Kritik am Konstruktivismus, sofern sie ihn nicht in der Breite seiner Ansätze rezipiert und nicht hinreichend den erkenntnistheoretischen Status seiner Ansätze markiert (Ebd., 91).
Diese aus Sicht des Konstruktivismus erforderlichen Konstruktionsprozesse (mit den entstehenden Unschärfen) sowie die Verabschiedung von traditionellen Verfahren und Ansätzen mit Universalitätsanspruch stellen sicher eine große Herausforderung dar, aber auch eine große Chance und Bereicherung. Der Konstruktivismus fordert zur Trans- und Interdisziplinarität auf. Dies erfordert zwangsläufig einen intensiven Diskurs, so dass die Diskussionen um angeblich „fundamentale Denkfehler im Konstruktivismus“ (Unger 2003, 101) letztendlich ihr Ziel erreicht haben, nämlich die intensive Auseinandersetzung mit konkurrierenden Theorien und Konstruktionen von Wirklichkeit anzuregen, die schließlich zu der Erkenntnis führen (müsste), dass es „die“ absolute Wahrheit nicht gibt, sondern viele mögliche Perspektiven und zahlreiche Grauzonen.2
Auf Grund von einseitigen und zum Teil auch lückenhaften Interpretationen wurden in der Vergangenheit konstruktivistische Ansätze als Ganzes (auch im Bereich der Fremdsprachen) immer wieder abgelehnt, obwohl es in der therapeutischen, sozialen und ebenso in der pädagogischen Praxis kurioserweise schon seit vielen Jahren zahlreiche erfolgreiche Modelle gibt, die explizit oder implizit auf konstruktivistischen Ansätzen aufbauen bzw. von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis heraus entwickelt wurden (wie z.B. der Storyline Approach), ohne jemals ein Wort über den Konstruktivismus gehört zu haben. Dies ist für mich mit ein Grund dafür, warum konstruktivistisches Denken auch in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften mehr Berücksichtigung finden sollte, und zwar im Sinne einer aufeinander abgestimmten Vernetzung von Theorie und Praxis und der Nutzung der sich daraus ergebenden Synergieeffekte. Wie dies erfolgen könnte, möchte ich in meinen Fallstudien 7-9 untersuchen.
Kritik am Konstruktivismus bezieht sich bei genauerer Betrachtung meist auf den Radikalen Konstruktivismus, und speziell an der Gewichtung der Neurobiologie scheiden sich offenbar die Geister. Oft werden Vorwürfe wie Fundalismus, Egozentrismus, Biologismus, fehlende Empirie bzw. individuelle Ausgestaltung von Erlebniswirklichkeiten und Beliebigkeit in Bezug auf gesellschaftliche und persönliche Wertmaßstäbe geäußert. Ferner wird die Erklärung der Beziehungen zwischen Wirklichkeit und Realität sowie System und Umwelt oft als mangelhaft kritisiert. Die Kritikpunkte müssen hier nicht im Einzelnen dargelegt werden, zumal einiges schon im Text berücksichtigt und vieles auch im öffentlichen Diskurs geklärt wurde.3
Im Bereich der Fremdsprachendidaktik fand hierzulande um die Jahrtausendwende eine intensive und zum Teil auch recht feindselige Auseinandersetzung um den Radikalen Konstruktivismus insbesondere zwischen den Kontrahenten Bredella und Wendt statt. Wendt (2002) hatte mit seiner Publikation offensichtlich einen mittleren Flächenbrand ausgelöst und das fremdsprachendidaktische Lager in zwei Teile aufgeteilt, während viele andere das Thema „Konstruktivismus“ in der Fremdsprachenforschung – warum auch immer – bis heute totschweigen.4 Dem gegenüber hat Wolff durch zahlreiche Publikationen versucht, sachliche Gründe für einen konstruktivistisch orientierten Fremdsprachenunterricht darzulegen (vgl. z.B. Wolff 1994; 1997b; 2000; 2001; 2002b). Auf internationaler Ebene dagegen vertreten im Bereich des Fremdsprachenlernens beispielsweise Nie/Lau (2010) und insbesondere Williams/Burden (1997) eine explizit konstruktivistische Perspektive (vgl. Kapitel 4.3.3.1.2).
Der Konstruktivismus will und muss skeptisch betrachtet werden. Zweifelsohne. Er sollte nicht als Dogma, sondern vielmehr als inspirierende „Irritationstheorie“ genutzt werden (Pörksen 2006, 11), um gewisse Denktraditionen, Handlungsgewohnheiten und „Wahrheiten“ immer wieder neu zu überprüfen. Genau das beabsichtigt er nach meinem Verständnis auch. Und genau das hat er in der Vergangenheit auch getan: provoziert. Mittlerweile scheint dies nicht mehr in dem Ausmaß erforderlich zu sein. So betrachtet auch Roth (2003b) den Konstruktivismus, „was die erkenntnistheoretischen Fragestellungen betrifft (...) im positiven Sinne für ausdiskutiert“ (Ebd., 16)5, und Schmidt (2003) verabschiedet sich von naturalistischen Begründungsformen des Radikalen Konstruktivismus zugunsten einer kulturalistischen und philosophischen Erkenntnistheorie, die nach dem Sinn von Wirklichkeitskonstruktionen und Handlungen fragt. Er geht davon aus, dass kulturelle Sinnstrukturen in Geschichten und Diskurse eingebettet sind: „Geschichten und Diskurse liefern Erwartungs- und Deutungsmuster für das Erleben und Erfahren der Aktarten, wodurch über Anschlussmöglichkeiten entschieden wird. Geschichten und Diskurse entstehen aus und bestehen durch Relationalität und Reflexivität“ (Ebd., 56).
Viele Vertreterinnen bzw. Vertreter des Konstruktivismus (z.B. Ciompi, Roth und auch Maturana) verweisen auf die handlungsleitende Kraft der Gefühle. Dieses Thema wurde in meinen Ausführungen bisher nur ganz am Rande gestreift. So behauptet Maturana (1997, 130): „Wer den kulturellen Wandel zu erklären und zu verstehen wünscht, muß bei den Gefühlen ansetzen“. Er unterstreicht die emotionalen Grundlagen des Handelns und stellt die These auf, „daß allein Gefühle über den Sinn und die Bedeutung von Taten entscheiden“ (Ebd.).6 In diesem Sinne ist auch Kommunikation (als Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft) nie nur eine Verstandessache, sondern stets auch – oder besser: vor allem – eine Gefühlssache: Verstehen, Verständigung und Perspektivenverschränkung erfordern „nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch emotionale Antriebe“ (Siebert 2005, 26). Diesen Aspekt gilt es bei der Unterrichtsgestaltung und gerade auch beim Fremdsprachenlernen mit Bezug zur angestrebten interkulturellen kommunikativen Kompetenz viel stärker zu berücksichtigen.
Dass der Konstruktivismus vielschichtig ist und sich in den vergangenen Jahren auch auffallend in Richtung eines sozialen und kulturalistischen Konstruktivismus weiter entwickelt hat, wird vielerorts, und vor allem von seinen Kritikern und Kritikerinnen, nicht wahrgenommen. Dies trifft meines Erachtens auch auf die Fremdsprachendidaktik zu, und das ist bedauerlich.
Konstruktivistisches Denken mag an Grenzen stoßen, aber das tut letztendlich – wie auch die Geschichte zeigt – (fast) jede Theorie. Theoriediktate sind gefährlich und kontraproduktiv. Eine prinzipielle Skepsis ist also immer angebracht, da sie den Blick weitet. Dies betrifft vor allem soziale Konstruktionen, wenn diese von der Gesellschaft objektiviert und „wie naturgegebene Phänomene“ (von Ameln 2004, 198) betrachtet werden, „mit entsprechenden Folgen für reales Denken und Handeln“ (Ebd.). Ich denke hier vor allem an „Urteile“ in Bereichen wie (psychische) Gesundheit, Schicht-, Konfessions- oder Kulturzugehörigkeit, die beispielsweise auch im schulischen Kontext relevant sind. Dasselbe gilt natürlich auch für die individuellen Konstrukte, also die Wahrnehmungs- und Interpretationsfolien, mit deren Hilfe jeder und jede Einzelne die Welt betrachtet.
Konstruktivistisches Denken löst fixierte Denkmuster auf und zieht letztendlich auch ethische Konsequenzen nach sich, denn der Verzicht auf eindimensionale Welterklärungen bedeutet gleichzeitig auch einen Verzicht auf Machtanspruch:7
Mit keiner Bewertung ist in der Geschichte der Menschheit mehr Elend verantwortet worden als mit der Wahrheit. (...) Der zentrale Wert des im Konstruktivismus angelegten Menschenbildes ist die Autonomie. (...) Die Stärke des Radikalen Konstruktivismus liegt in der Notwendigkeit des bewußten und selbstverantwortlichen Umgangs mit sonst nur allzuoft unhinterfragten Grundannahmen (Kruse/Stadler 1990, 44).
Konstruktivistisches Denken erlaubt, fördert und fordert divergentes und kreatives Denken. Dies sollte auch im Zusammenhang mit Erneuerung, Pluralismus, Respekt, Friedfertigkeit, Solidarität und Toleranz sowie den dafür erforderlichen bzw. immer wieder geforderten Kompetenzen gesehen und wertgeschätzt werden (vgl. Kapitel 1.6). Mit Beliebigkeit hat dies meines Erachtens wenig zu tun, sondern im Gegenteil verlangt konstruktivistisches Denken eine neue Dimension von anspruchsvollen Qualitäten wie Eigenverantwortlichkeit, Selbstorganisation, Selbstmotivation, Reflexionsvermögen, (Selbst-)Kritikfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Interaktions- und Diskursfähigkeit, was zweifelsohne eine große Herausforderung – vor allem auch für die Schule – darstellt.
Auch wenn von manchen Zeitgenossinnen bzw. -genossen8 moniert wird, dass es im Konstruktivismus keine einheitliche und in sich schlüssige Theorie gäbe, um überhaupt von einem ernstzunehmenden Ansatz sprechen zu können, so ist doch verwunderlich, dass diese angeblich unsolide Basis seit Jahren als Sprungbrett für viele anregende Diskussionen in der Wissenschaftslandschaft und unzählige erfolgversprechende Modelle in der pädagogischen Praxis dient: „Konstruktivismus muss Vielfalt ermöglichen, dies ist in seinem theoretischen Kern eingeschrieben, aber er bietet auch ein hinreichendes konstruktives, methodisches und praktisches Repertoire, um wissenschaftlich relevante, neue Ergebnisse zu erzielen“ (Reich 2012, 92). Auf die Schule und das Fremdsprachenlernen bezogen, mit den in vielerlei Hinsicht heterogenen Klassen, ergibt sich daraus ein ganz neues Bild: Wenn nämlich die vielfältigen individuellen und/oder sozialen Konstruktionen bzw. Konstrukte als jeweils viable Lösungen und Lösungsversuche ernstgenommen und reflektiert werden, dann könnte sich das möglicherweise positiv auf den Lernerfolg und die Bildungsmotivation der Schülerinnen und Schüler auswirken! Ob und inwiefern der Storyline Approach im fremdsprachlichen Klassenzimmer der Sekundarstufe I einen Beitrag dazu leisten kann, sollen meine Fallstudien in Teil B zeigen.