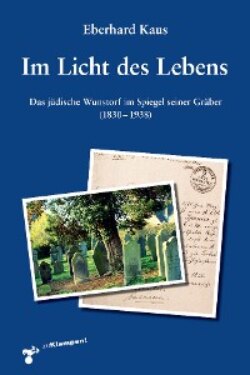Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7. Schmuel ben Menachem ha-lewi, HOMEYER Nr. 11
H: 94 cm B: 40 cm T: 8,5 cm
Z. 5: Auf dem Stein als Ligatur.
Z. 6: Vertauschung der beiden ersten Buchstaben bzw. Worte des Schlusssegens.
Samuel, Sohn Menachems des Levi (gest. 17.4.1838)
Das Familienbuch des Landrabbinats enthält für die Stadt Wunstorf zum entsprechenden Todes-bzw. Begräbnisdatum keinen Eintrag.1 Sterbelisten der Synagogengemeinde Wunstorf liegen erst ab 1844 vor. Vielleicht handelt es sich bei Samuel um einen Bruder von Jette Löwenstein (Jette bat Menachem; Nr. 11), über deren Familie bis auf den Vatersnamen nichts bekannt ist, oder um den Vater Röschen Meyermanns (Resche bat Schmuel; Nr. 21). Auch über ihre Eltern fehlen weitere Hinweise in den Akten.
Der Nachname Samuels ist aus den Angaben nicht zu erschließen, da levitische Familien nicht nur den Namen Levy wählten, sondern – mit Bezug auf Neh 3,31 – etwa Goldschmidt, wobei das Vorbild der angesehenen Frankfurter Familie Goldschmidt, deren Angehörige nach dem großen Pogrom im Rahmen des »Fettmilch-Aufstands« (1614) u. a. nach Hameln und Kassel auswanderten,2 von Bedeutung war.3
Nicht levitischer Abstammung war allerdings wohl Michael Moses Goldschmidt (Nr. 51), dessen Großvater Mendel hieß, was eine häufige säkulare Entsprechung (Kinnui) zum religiösen Namen Menachem darstellt. Pessie Levi (Nr. 1) dürfte ebenso als Verwandte ausscheiden, da ihr Nach- bzw. Vatersname Levi eine Entsprechung zum Synagogalnamen Jehuda darstellt und demnach nicht auf eine levitische Abstammung verweist.
1 FB Wunstorf; vgl. HOMEYER, S. 123–125.
2 GRONEMANN I, S. 14; RIES, S. 126 f.
3 Samuel, S. 846 f.; vgl. GROTTE 1928, Sp. 1186.
Übersetzung
Hier ist begraben / ein untadeliger und aufrechter Mann (Hi 1,1/1,8), der verehrte Herr Schmuel, / Sohn des Herrn Menachem des Levi. Er ging ein in seine Ewigkeit (→F2) / am letzten Tag von Pessach (17.4.[1838]) und wurde begraben / [5] an Tag 5, dem 24. Nissan 598 n. kl. Z. (Donnerstag, 19.4.1838) / Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! (→F4)
Kommentar
Z. 1–2a: Die kurzgehaltene Inschrift greift im Lob auf den häufigen Vergleich mit Hiob als Muster des »Gerechten« zurück. (siehe den Kommentar zu Nr. 3, Z. 1–3).
Z. 2b–5: Der »Titel« ha-lewi zeigt die levitische Herkunft Samuels, muss aber nicht mit dem gewählten Familiennamen identisch sein.
Der Todestag fällt auf den letzten Tag des in der Regel sieben-, im traditionellen Judentum in der Diaspora – wozu man die Wunstorfer Gemeinde zählen kann – aber achttägigen (TREPP, S. 77) Pessach-Festes. Der letzte Tag des Festes acharon schel pessach) trägt messianische Züge und bietet von daher einen Bezug zum endzeitlichen Lohn der »Gerechten« (z. B. Singen von Ps 24 bei der Tora-Prozession nach aschkenasischem Ritus; TREPP, S. 84).
Z. 6: Die Vertauschung der beiden ersten Buchstaben des abgekürzten Segenswunsches findet sich in Wunstorf nur hier, wird aber auch bei Händler, S. 79, als mögliche Variante aufgeführt.
Äußere Form: Darstellung des Levitengeschirrs (Kanne und Schüssel) in Karniesbogen. Zur Bogenform vgl. Nr. 2. Die Leviten assistierten in traditionellen Gemeinden den Kohanim (s. Glossar s. v. Kohen) im Gottesdienst bei der Handwaschung vor dem Priestersegen.