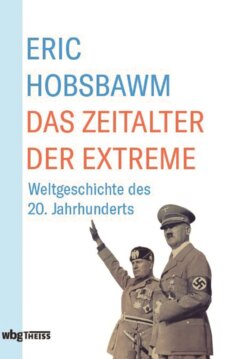Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 25
5
ОглавлениеDie Macht der weltrevolutionären Bewegungen beruhte auf der kommunistischen Organisationsform nach Lenins »neuem Parteitypus«, einer gewaltigen Innovation für die Gesellschaftskonstruktion des 20. Jahrhunderts, vergleichbar nur mit der Begründung der christlichen Klosterkultur und anderer Orden des Mittelalters. Selbst kleine Organisationen konnten dadurch unverhältnismäßig starke Wirkungskraft entfalten, denn mehr noch als militärische Disziplin und Zusammenhalt gelang es der »Partei«, von ihren Mitgliedern ein außerordentliches Maß an Hingabe und Selbstaufopferung und die vollständige Konzentration auf die unbedingte Ausführung aller Parteibeschlüsse einzufordern. Sogar gegnerische Beobachter waren davon tief beeindruckt. Und doch war die Beziehung zwischen dem Modell der »Parteiavantgarde« und den großen Revolutionen, die zu unternehmen sie angetreten war (was ihr gelegentlich auch gelang), keineswegs eindeutig – obwohl kaum etwas eindeutiger war als die Tatsache, daß dieses Modell seine maximale Wirkungskraft immer nach einer erfolgreichen Revolution oder während eines Krieges bewies. Das grundlegende Strukturgesetz von leninistischen Parteien war die Führung durch eine Elite (Avantgarde) oder, bevor die Revolution gewonnen war, die Führung durch eine »Gegenelite«. Aber wie sich 1917 gezeigt hatte, hingen Revolutionen davon ab, was in den Massen und in solchen Situationen vor sich ging, die weder die Elite noch die Gegenelite unter Kontrolle hatten. Das leninistische Modell übte vor allem auf die jungen Mitglieder der alteingesessenen Eliten große Anziehungskraft aus, und dies vor allem in der Dritten Welt. Diese Menschen traten den Parteien, die dieses Modell repräsentierten, selbst dann noch in unverhältnismäßig großer Zahl bei, wenn diese sich heroisch und auch relativ erfolgreich bemühten, Kader aus dem wirklichen Proletariat zu fördern. Die Ausbreitung des Kommunismus im Brasilien der dreißiger Jahre war beispielsweise in erster Linie der Konversion von jungen Intellektuellen aus den Familien der Oligarchie oder jungen Armeeoffizieren zu verdanken (Martins Rodrigues, 1984, S. 390–397).
Andererseits führten die Emotionen der realen »Massen« (wozu manchmal auch aktive Unterstützer der »Avantgarde« zählten) oft in eine ganz andere Richtung, als ihre Eliten einschlagen wollten, vor allem wenn es zu wirklichen Volksaufständen kam. So führte zum Beispiel der Aufstand der spanischen Generäle gegen die Volksfrontregierung im Juli 1936 in weiten Teilen Spaniens augenblicklich zur sozialen Revolution. Daß die Militanten unter ihnen, vor allem die Anarchisten, die Produktionsmittel verstaatlichen wollten, war keine Überraschung (die Kommunistische Partei und die Zentralregierung wandten sich später wieder davon ab und machten diese Transformation wo immer möglich wieder rückgängig). Noch heute wird das Pro und Kontra dieser Geschichte in der politischen und historischen Literatur diskutiert. Wie dem auch sei: Dieser Aufstand hatte zusätzlich einen Bildersturm gegen die Kirchen und Mordanschläge auf den Klerus ausgelöst, die ihresgleichen suchten und einzigartig in der Geschichte des spanischen Volkes waren, seit es seine Empörung erstmals auf derartige Weise zum Ausdruck gebracht hatte (1835, als die Bürger von Barcelona aus Zorn über den nicht zufriedenstellenden Ausgang eines Stierkampfs zahlreiche Kirchen niederbrannten). Ungefähr 7000 Kleriker – etwa 12–13 Prozent der Priester und Mönche des Landes und eine geringere Zahl von Nonnen – wurden ermordet. Allein in einer einzigen Diözese Kataloniens (Gerona) wurden über 6000 Bilder zerstört (Thomas, 1977, S. 270–271; Delgado, 1992, S. 56).
Zwei Dinge an dieser schrecklichen Episode sind klar: erstens, daß die Führer oder Sprecher der revolutionären spanischen Linken, so leidenschaftlich antiklerikal sie auch eingestellt sein mochten, diese Ausschreitungen schärfstens verurteilten; und das traf sogar auf die Anarchisten zu, die ja als notorische Priesterhasser bekannt waren; und zweitens, daß diese Aktionen für die Täter und all jene, die ihnen tatenlos zusahen, den wahren Gehalt einer Revolution symbolisierten: die Umwälzung des Gesellschaftssystems und seiner Werte nicht nur für einen kurzen symbolischen Augenblick, sondern für immer (Delgado, 1992, S. 52–53).
Auch wenn die politische Führung weiter predigte, daß der Kapitalismus und nicht die Priesterschaft ihr eigentlicher Feind sei, so haben die Massen in ihrem Innersten doch ganz anders empfunden. (Ob die Politik der Massen in einer Gesellschaft, die weniger von Machos geprägt gewesen wäre als die iberische, auch weniger mörderisch und ikonoklastisch hätte sein können, ist eine offene Frage, die aber wohl durch Verhaltensstudien an Frauen beleuchtet werden könnte.)
Im 20. Jahrhundert hat es fast nie jene Art von Revolution gegeben, die die Strukturen und die Autorität eines politischen Systems von einem Tag auf den anderen zum Verschwinden bringt und bei der die Männer auf den Straßen (und Frauen, soweit man ihnen gestattete mitzumachen) sich selbst überlassen bleiben. Sogar die iranische Revolution von 1979, das naheliegendste Beispiel für den plötzlichen Zusammenbruch eines etablierten Regimes, war nicht völlig unstrukturiert, obwohl die Massenbewegung gegen den Schah in Teheran ungewöhnlich einmütig war und sich im wesentlichen sehr spontan entwickelt haben muß. Doch dank der Strukturen der iranischen Geistlichkeit stand das neue Regime schon in den Trümmern des alten bereit, auch wenn es noch eine Weile dauern sollte, bis es endgültige Formen annahm (siehe Fünfzehntes Kapitel).
Die typische Revolution im Kurzen 20. Jahrhundert nach der Oktoberrevolution war – von einigen örtlich begrenzten Explosionen abgesehen – entweder durch einen (beinahe immer militärischen) Staatsstreich zustande gekommen, der die Hauptstadt eroberte, oder sie war das Resultat eines langwierigen und fast immer auf das Hinterland beschränkten bewaffneten Kampfes. In armen, rückständigen Ländern, wo das Militär häufig die einzige Karrieremöglichkeit bot für fähige junge Männer mit besserer Schulbildung, aber ohne Geld und Familienbeziehungen, waren es denn auch häufig junge Offiziere, seltener auch Unteroffiziere, die mit radikalen und linksgerichteten Anschauungen sympathisierten. Typischerweise fanden derartige Initiativen in Ländern wie Ägypten (die Revolution der Freien Offiziere 1952) und anderen Staaten des Nahen Ostens statt (Irak 1958, Syrien zu verschiedenen Zeiten seit den fünfziger Jahren, Libyen 1969). Militärs waren schon lange fester Bestandteil der lateinamerikanischen Revolutionsgeschichte, obwohl sie die Macht nur selten – und wenn, dann nicht für lange – aus eindeutig linksgerichteten Motiven übernahmen. Aber zur Überraschung fast aller Beobachter hat 1974 ein klassischer Militärputsch junger Offiziere, die durch lang währende koloniale Nachhutgefechte desillusioniert und radikalisiert worden waren, sogar das älteste rechtsgerichtete Regime in Europa gestürzt, das zu dieser Zeit noch bestand: die »Nelkenrevolution« in Portugal. Doch ihr Bündnis mit den Kommunisten, die als starke Partei aus dem Untergrund aufgetaucht waren, und mit verschiedenen radikalmarxistischen Gruppen sollte sich bald spalten und schließlich aufgelöst werden – zur Erleichterung der Europäischen Gemeinschaft, welcher Portugal bald danach beitreten konnte.
In den Industriestaaten tendierten politisch interessierte Militärs aufgrund der dort herrschenden spezifischen Gesellschaftsstrukturen, ideologischen Traditionen und politischen Funktionen von Streitkräften schon immer eher zur Rechten. Staatsstreiche im Bündnis mit Kommunisten oder Sozialisten waren nicht nach ihrem Geschmack. Doch bei den Befreiungsbewegungen des französischen Imperiums spielten ehemalige Soldaten der französischen Kolonialarmeen – kaum ein Offizier unter ihnen – eine wichtige Rolle (vor allem in Algerien). Denn während und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie nicht nur schlechte Erfahrungen mit der alltäglichen Diskriminierung gemacht, sondern auch deshalb, weil die mehrheitlich aus den Kolonien stammenden Soldaten in de Gaulles Freiem Frankreich, wie die ebenso mehrheitlich nichtfranzösischen Mitglieder des bewaffneten Widerstands innerhalb von Frankreich, bald schon in den Schatten gedrängt worden waren. Die Freien Armeen Frankreichs, die sich bei den offiziellen Siegerparaden nach der Befreiung zeigten, waren ein gutes Stück »weißer« als jene, mit denen die gaullistische Schlacht tatsächlich so ehrenvoll gewonnen werden konnte. Dennoch blieb die Mehrheit der Kolonialarmeen selbst dann noch den imperialistischen Mächten gegenüber loyal (oder besser gesagt unpolitisch), wenn sie von Offizieren aus dem jeweiligen Kolonialstaat geführt wurden; die etwa 50000 indischen Soldaten, die unter den Japanern der Indischen Nationalarmee beitraten, sind nur die Ausnahme, die die Regel bestätigen (Echenberg, 1992, S. 141–154; Barghava/Singh Gill, 1988, S. 10; Sareen, 1988, S. 20–21).