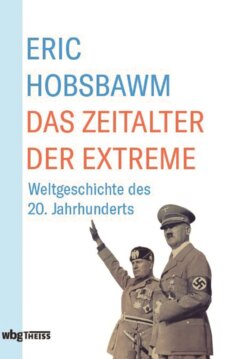Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 26
6
ОглавлениеDie Straße des lang währenden Guerillakrieges hin zur Revolution wurde erst spät im 20. Jahrhundert von den Sozialrevolutionären entdeckt. Vielleicht hing das damit zusammen, daß sich diese Strategie hauptsächlich auf Aktivitäten auf dem Land beschränkte und historisch fast immer mit archaischen Ideologien gleichgesetzt wurde, die von skeptischen Beobachtern aus der Stadt leicht mit Konservatismus und Reaktion oder sogar Konterrevolution in Verbindung gebracht wurden. Schließlich hatten sich ja auch die gewaltigen Guerillakriege des revolutionären und Napoleonischen Frankreich immer nur gegen und niemals für Frankreich und die revolutionäre Sache eingesetzt. Allein das Wort »Guerilla« fand erst nach der kubanischen Revolution von 1959 Eingang ins marxistische Vokabular. Die Bolschewiken, die sich 1918–20 auch auf den Kleinkrieg einstellten, nannten ihre Guerillas »Partisanen«, ein Terminus, der dann auch zum Standardvokabular der sowjetisch inspirierten Widerstandsbewegungen im Zweiten Weltkrieg gehörte. Rückblickend betrachtet verwundert, daß Guerillaaktionen im Spanischen Bürgerkrieg so gut wie keine Rolle gespielt haben, obwohl es reichlich Spielraum in den von Francos Truppen besetzten republikanischen Gebieten für sie gegeben hätte. Nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten die Kommunisten von außen zwar einige in der Tat recht einflußreiche Guerillazellen, aber davor hatten sie schlechterdings nicht zum Instrumentarium der potentiellen Revolutionäre gehört.
Eine Ausnahme war China, wo einige (aber bei weitem nicht alle) kommunistische Führer diese neue Strategie verfolgten – nachdem sich die Kuomintang unter Tschiang Kai-schek 1927 gegen ihre ehemaligen kommunistischen Verbündeten gewandt hatte und der kommunistische Aufstand in den Städten (Kanton 1927) spektakulär fehlgeschlagen war. Mao Tse-tung, Vorkämpfer der neuen Strategie – die ihn schließlich zum Führer des kommunistischen China machen sollte –, hatte nicht nur erkannt, daß große Gebiete Chinas nach mehr als fünfzehn Jahren Revolution der Kontrolle jeglicher zentraler Administration entglitten waren. Als großer Bewunderer der Wasserscheide – dem bedeutenden klassischen Roman über das soziale Banditentum Chinas – wußte er auch, daß Guerillataktiken schon immer zum Bestandteil aller sozialen Konflikte in China gehört hatten. Keinem klassisch gebildeten Chinesen konnten die Parallelen entgehen, die der Aufbau von Maos erster freier Guerillazone, 1927 in den Bergen von Kiangsi, und die Bergfestung der Helden aus der Wasserscheide aufwiesen; schon 1917 hatte Mao seine Kommilitonen aufgefordert, es diesen Helden gleichzutun (Schram, 1966, S. 43–44).
Die chinesische Strategie, wie heroisch und inspirierend sie auch gewesen sein mag, schien sich aber nicht auf Staaten anwenden zu lassen, deren Regierungen sich auf gut funktionierende interne Kommunikationswege verlassen konnten, durch die sie die Möglichkeit hatten, ihr gesamtes Territorium administrativ zu kontrollieren, so abgelegen und schwierig es auch zu erreichen gewesen sein mochte. Doch es sollte sich herausstellen, daß diese Strategie kurzfristig gesehen nicht einmal in China erfolgreich war, nachdem die Nationalregierung die Kommunisten nach mehreren Feldzügen 1934 schließlich gezwungen hatte, ihre freien Rätegebiete in den Hauptregionen des Landes aufzugeben und sich in die abgelegene und dünn besiedelte Grenzregion des Nordwestens zurückzuziehen – der legendäre Lange Marsch.
Seit die aufständischen brasilianischen Offiziere in den späten zwanziger Jahren von ihrem erfolglosen Weg zum Kommunismus übergewechselt waren, hat keine linke Gruppe von Belang mehr den Weg der Guerilla eingeschlagen, es sei denn, man zählt General César Augusto Sandinos Kampf gegen die amerikanischen Marines in Nicaragua dazu (1927–1933), auf den sich die sandinistische Revolution fünfzig Jahre später berufen sollte. (Ohne großen Erfolg versuchte die Kommunistische Internationale auch den gefeierten brasilianischen Sozialbanditen und Helden von tausend Balladen, Lampiâo, in das Licht des Guerillahelden zu stellen.) Und Mao wurde erst nach der kubanischen Revolution zum Leitstern von Revolutionären.
Erst der Zweite Weltkrieg sollte der Revolution einen viel unmittelbareren und besseren Grund liefern, den Weg der Guerilla einzuschlagen: die Notwendigkeit, gegen die Besetzung eines Großteils des europäischen Kontinents und großer Gebiete der europäischen Sowjetunion durch die Armeen von Hitlers Deutschland und seinen Verbündeten Widerstand zu leisten. Die Kraft vor allem des bewaffneten Widerstands wuchs beträchtlich an, nachdem Hitlers Angriff auf die Sowjetunion die kommunistischen Bewegungen mobilisiert hatte. Als die deutsche Wehrmacht schließlich mit unterschiedlicher Beteiligung der verschiedenen regionalen Widerstandsgruppen geschlagen werden konnte (siehe Fünftes Kapitel), stürzten die Regime des besetzten oder faschistischen Europa, und die Macht fiel in die Hände von sozialrevolutionären Regimen unter kommunistischer Kontrolle – zumindest in den Ländern, wo der bewaffnete Widerstand am wirkungsvollsten gewesen war (Jugoslawien, Albanien und Griechenland – bei dem man die britische und zeitweilig auch amerikanische Militärhilfe jedoch mit einkalkulieren muß). Wahrscheinlich hätten sie auch in Italien nördlich der Apenninen die Regierungsgewalt übernehmen können, aber sicher nicht für lange. Die Gründe, aus denen sie es gar nicht erst versucht hatten, werden noch heute in der Linken debattiert. Auch die kommunistischen Regime, die nach 1945 in Ost- und Südostasien etabliert wurden (in China, einem Teil von Korea und in Französisch-Indochina), können als direkte Abkömmlinge des Widerstands im Krieg betrachtet werden. Denn sogar in China begann der massive Vorstoß von Maos Roten Armeen erst, nachdem die japanische Armee 1937 den Versuch unternommen hatte, den größten Teil des Landes einzunehmen. Die zweite Welle der sozialen Weltrevolution war mit dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wie die erste im Ersten – wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise. Beim zweitenmal war es das kriegerische Unternehmen selbst, und nicht die Auflehnung gegen den Krieg, das die Revolution an die Macht brachte.
Den Aufbau und die Politik der neuen Revolutionsregime werden wir an anderer Stelle betrachten (siehe Fünftes und Dreizehntes Kapitel). Im Moment beschäftigt uns vor allem der revolutionäre Prozeß selbst. Die Revolutionen Mitte des Jahrhunderts, die am Ende langer Kriege ausbrachen, unterschieden sich in zweierlei Hinsicht vom klassischen Szenario eines 1789 oder des »Oktober«; sie waren auch nicht mit dem allmählichen Zusammenbruch der alten Regime wie beispielsweise dem chinesischen Kaiserreich oder dem porfirianischen Mexiko12 vergleichbar. Erstens – und in dieser Hinsicht erinnern sie an erfolgreiche Militärputsche – bestand nie der geringste Zweifel daran, wer die Revolution angeführt oder die Macht übernommen hat: die politische(n) Gruppe(n) im Verbund mit der siegreichen Roten Armee. (Die westlichen Siegerarmeen waren ja gegen kommunistisch dominierte Regime.) Übrigens hätten weder Deutschland noch Italien und nicht einmal die Japaner China ausschließlich von den eigenen Widerstandskräften und ohne Bündnis mit der sowjetischen Armee besiegen können. Es hat nie ein Interregnum oder Machtvakuum gegeben. Umgekehrt war die unmittelbare Machtübernahme von starken Widerstandskräften nach dem Zusammenbruch der Achsenmächte dort unmöglich, wo die Westalliierten noch einen Fuß in den befreiten Ländern hatten (Südkorea, Vietnam) oder wo die innenpolitischen Gegenkräfte zu den Achsenmächten selbst gespalten waren, wie in China. Sogar dort mußten sich die Kommunisten nach 1945 erst noch gegen ein korruptes und, obgleich zunehmend schwaches, noch immer kriegführendes Kuomintang-Regime durchsetzen, wofür die Sowjetunion wenig Begeisterung zeigte.
Zweitens führte der Guerillaweg zur Macht unweigerlich aus den Städten und Industriezentren, wo die sozialistischen Arbeiterbewegungen traditionell am stärksten waren, hinaus ins Hinterland. Guerillakrieg braucht den Dschungel, Berge, Wälder und ähnliches Terrain und setzt sich daher in dünnbesiedelten Gebieten weit abseits der Ballungszentren fest. Mit Maos Worten heißt das: Das Land muß die Stadt umzingeln, bevor es sie erobern kann. Für den europäischen Widerstand bedeutete das: Der Aufstand der Stadt – wie z.B. im Sommer 1944 in Paris, im Frühling 1945 in Mailand – mußte warten, bis der Krieg praktisch schon zu Ende war, ob ganz oder auf dem lokalen Kriegsschauplatz. Dem verfrühten Aufstand 1944 in Warschau folgte das Strafgericht auf dem Fuß: Die Stadt hatte nur eine, wenn auch große Granate abzuschießen. Sie hatte keine Reserven. Die Entscheidung für den Guerillaweg bedeutete also selbst in einem revolutionären Land für den größten Teil der Bevölkerung eine lange Zeit des relativ untätigen Wartens auf Veränderungen, die andernorts erkämpft wurden; und die tatsächlich involvierten Widerstandskämpfer, einschließlich ihrer gesamten Infrastruktur, blieben unvermeidlich auf eine relativ kleine Minderheit beschränkt.
In ihren Territorien konnte die Guerilla natürlich nicht ohne den Rückhalt der Massen agieren; nicht zuletzt, weil sie ihre Kämpfer in den lang anhaltenden Konflikten mehr oder weniger nur lokal rekrutieren konnte. So wurden die Parteien der Industriearbeiter und Intellektuellen (wie in China) stillschweigend zu Armeen ehemaliger Bauern umgewandelt. Doch deren Beziehungen zu den Massen waren bei weitem nicht so einfach, wie Maos Bild vom Partisan suggerieren wollte, der wie ein Fisch im Wasser des Volkes schwimmt. Im typischen Guerillagebiet konnte sich im Grunde jede Gruppe von Außenseitern oder Gesetzlosen, die sich den örtlichen Verhaltensregeln anzupassen wußte, der Sympathie und grundsätzlichen Unterstützung der Bevölkerung gegen fremde Soldaten oder die Streitmächte der Nationalregierung sicher sein. Nur, im Hinterland gab es tiefverwurzelte Fehden; und die konnten jederzeit bedeuten, daß der Zugewinn von neuen Freunden automatisch mit dem Risiko neuer Feindschaften verbunden war. Die chinesischen Kommunisten, die in der Zeit von 1927–28 ihre ländlichen Rätegebiete etablierten, hätten nicht davon überrascht sein dürfen, daß die Konversion eines von einem bestimmten Clan beherrschten Dorfes zwar ein Netzwerk von »roten Dörfern« unter der Herrschaft befreundeter Clans entwickeln konnte, diese Dörfer dann aber unweigerlich in Kriege gegen ihre traditionellen Feinde verstrickte, welche nun wiederum ein ähnliches Netzwerk aus »schwarzen Dörfern« errichtet hatten. »In manchen Fällen«, so reklamierten die Kommunisten, »wurde der Klassenkampf zu einem Kampf des einen Dorfes gegen das andere. Es gab Fälle, in denen unsere Truppen erst ganze Dörfer belagern und zerstören mußten« (Manfred Hinz, 1973, S. 45–46). Mancher erfolgreiche Guerillakämpfer lernte zwar, sicher über solch trügerische Wasser zu steuern, aber, wie auch Milovan Djilas’ Memoiren aus dem jugoslawischen Partisanenkrieg zeigten: Befreiung war eine weit komplexere Angelegenheit als nur der einmütige Aufstand eines unterdrückten Volkes gegen fremde Eroberer.