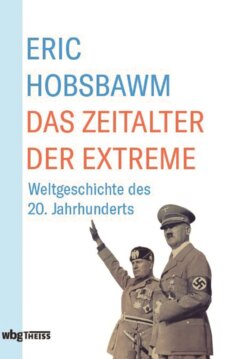Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 30
2
ОглавлениеWeshalb hat die kapitalistische Wirtschaft zwischen den Kriegen versagt? Die Lage der USA ist ein wesentlicher Teil der Antwort auf diese Frage. Denn während man in Europa (zumindest in den kriegführenden Ländern Europas) die Zerstörungen durch den Krieg und die Probleme der Nachkriegszeit für die ökonomischen Schwierigkeiten verantwortlich machen konnte, waren die USA weit vom Kriegsschauplatz entfernt, obwohl sie kurz, aber entscheidend am Krieg teilgenommen hatten. Im Gegenteil, die Vorteile, die ihre Wirtschaft aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hatte, waren nicht minder spektakulär als die, welche sie später aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen sollte. Bereits 1913 waren die USA zur größten Volkswirtschaft der Welt geworden und stellten über ein Drittel der gesamten globalen Industrieproduktion her – nur knapp weniger, als die Gesamtproduktion von Deutschland, Großbritannien und Frankreich. 1929 war ihr Anteil an der gesamten Weltproduktion über 42 Prozent, wohingegen die drei Industriemächte Europas zusammen kaum 28 Prozent hielten.20 Dies sind wahrhaftig erstaunliche Zahlen. Ein konkretes Beispiel: Die Stahlproduktion der USA stieg zwischen 1913 und 1920 um ein Viertel, während die Stahlproduktion im Rest der Welt um etwa ein Drittel zurückging.21 Nach dem Ersten Weltkrieg waren die USA also in vielerlei Hinsicht zu einer international ebenso dominierenden Wirtschaft geworden wie später nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur die Weltwirtschaftskrise sollte ihre Vorherrschaft zeitweise unterbrechen.
Hinzu kam, daß der Krieg nicht nur ihre Rolle als größter Industrieproduzent der Welt gestärkt, sondern sie auch zum größten Gläubiger der Welt gemacht hatte. Die Briten hatten während des Krieges ungefähr ein Viertel ihrer weltweiten Kapitalanlagen verloren, vor allem in den USA, weil sie zum Verkauf gezwungen waren, um den Ankauf von Kriegsmaterial bezahlen zu können; die Franzosen hatten die Hälfte ihrer Investitionen durch die Revolution und den Zusammenbruch in Europa verloren. Inzwischen waren die Amerikaner, die den Krieg als Schuldner begonnen hatten, zum international größten Kreditgeber geworden. Und da sie ihre Aktivitäten auf Europa und die westliche Hemisphäre konzentrierten (die Briten waren der noch immer bei weitem größte Investor in Asien und Afrika), war auch ihr Einfluß auf Europa entscheidend.22
Kurz gesagt: Man kann die Weltwirtschaftskrise ohne Einbeziehung der USA nicht erklären. Sie waren in den zwanziger Jahren die größte Exportnation der Welt und, nach Großbritannien, auch der größte Importeur. Bei Rohmaterialien und Lebensmitteln hielten sie beinahe 40 Prozent des Gesamtimports der fünfzehn größten Handelsnationen – eine Tatsache, die schließlich auch den verheerenden Einfluß der Krise auf die Produzenten von Weizen, Baumwolle, Zucker, Kautschuk, Seide, Kupfer, Zinn und Kaffee erklärt (Lary, 1943, S. 28–29). Aber aus genau diesem Grund sollten sie auch zum eigentlichen Opfer der Krise werden. Zwischen 1929 und 1932 fielen ihre Importe wie Exporte um 70 Prozent. Und während der Welthandel zwischen 1929 und 1939 um weniger als ein Drittel zurückging, fielen die amerikanischen Exporte um über die Hälfte.
Damit sollen die genuin europäischen Wurzeln des Übels, die im wesentlichen in der Politik aufzufinden sind, keinesfalls unterschätzt werden. Auf der Friedenskonferenz von Versailles (1919) waren Deutschland riesige, aber nicht klar definierte »Reparationen« für die Kriegskosten und Schäden der Siegermächte auferlegt worden. Um dies rechtfertigen zu können, war dem Friedensvertrag eine Klausel hinzugefügt worden, die die Alleinverantwortung von Deutschland für den Krieg konstatierte (die sogenannte »Kriegsschuldklausel«), was nicht nur historisch zweifelhaft war, sondern sich auch als Geschenk für den deutschen Nationalismus erweisen sollte. Die Höhe der Summe, die Deutschland zu zahlen hatte, blieb vage – ein Kompromiß zwischen der Position der USA, die vorgeschlagen hatten, daß Deutschlands Zahlungen anhand der Zahlungsfähigkeit des Landes berechnet werden sollten, und der Position der anderen Alliierten, vor allem der Franzosen, die darauf bestanden, die gesamten Kriegskosten erstattet zu bekommen. Das eigentliche Ziel aller Alliierten und vor allem von Frankreich war, Deutschland in einem Zustand der Schwäche zu halten und ein Mittel in der Hand behalten zu können, um Druck auf das Land ausüben zu können. 1921 wurde die Höhe des Betrags schließlich auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzt – zur damaligen Zeit der Gegenwert von 33 Milliarden Dollar –, für jedermann eine Phantasiesumme.
Diese »Reparationen« führten zu einem endlosen Kreislauf aus Debatten, regelmäßig auftauchenden Krisen und deren Beilegungen, vor allem durch die Amerikaner: Zum Mißfallen ihrer ehemaligen Alliierten wollten die USA die Frage von Deutschlands Schulden gegenüber allen Alliierten mit der Frage von deren eigenen Schulden gegenüber Washington verbinden. Und diese Summen waren beinahe so aberwitzig wie die Summen, die Deutschland zahlen sollte (die eineinhalbfach so hoch wie das gesamte Nationaleinkommen des Landes im Jahr 1929 waren). Englands Schulden gegenüber den USA beliefen sich auf die Hälfte seines Nationaleinkommens, die der Franzosen auf zwei Drittel.23 Der »Dawes-Plan« setzte 1924 schließlich eine realistische Summe für die jährlichen Zahlungen Deutschlands fest; und der »Young-Plan« von 1929 modifizierte das Rückzahlungsschema und etablierte in Basel eine »Bank für Internationalen Zahlungsausgleich«, das erste von vielen internationalen Finanzierungsinstituten, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet werden sollten. (Zur Zeit der Niederschrift dieses Buches existierte sie noch immer.) Aus praktischen Gründen wurden alle Zahlungen, die der Deutschen wie die der Alliierten, 1932 eingestellt. Nur Finnland hat seine Schulden gegenüber den USA beglichen.
Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, soll erwähnt sein, daß zwei Fragen zur Debatte standen. Erstens: »Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Friedens« (1920) – ein Punkt, den der junge John Maynard Keynes in seiner grimmigen Kritik an der Konferenz von Versailles, an der er als Juniormitglied der britischen Delegation teilgenommen hatte, ausgearbeitet hatte. Ohne die Genesung der deutschen Wirtschaft, so argumentierte er, wäre auch die Genesung einer stabilen liberalen Zivilisation und Wirtschaft in Europa unmöglich. Die Politik Frankreichs, Deutschland zugunsten der französischen »Sicherheit« schwach zu halten, sei kontraproduktiv. Frankreich war in der Tat zu schwach, um seine Politik durchzusetzen, auch wenn es 1923 für kurze Zeit das industrielle Herz im Westen Deutschlands mit der Begründung besetzen konnte, daß die Deutschen die Zahlungen verweigerten. Schließlich mußten die Franzosen 1924 eine »Erfüllungspolitik« für Deutschland akzeptieren, mit der die deutsche Wirtschaft wieder gestärkt wurde. Zweitens aber gab es die Frage, auf welche Weise Reparationen zu zahlen seien. All jene, denen es darum ging, Deutschland schwach zu halten, wollten lieber Geld als Güter aus der laufenden Produktion sehen (was vernünftiger gewesen wäre) und ließen sich nicht einmal darauf ein, daß Deutschland aus den Einnahmen seiner Exporte zahlen konnte, weil damit die deutsche Wirtschaft gegenüber ihren Konkurrenten gestärkt worden wäre. Dadurch zwangen sie Deutschland zu großen Kreditaufnahmen, so daß die Reparationen, die schließlich tatsächlich gezahlt wurden, aus den riesigen (amerikanischen) Kapitalanleihen der zwanziger Jahre stammten. Für die Rivalen Deutschlands schien das noch den zusätzlichen Vorteil zu haben, daß sich das Land tief verschulden mußte, anstatt seine Exporte ausweiten und somit ein außenpolitisches Gleichgewicht herstellen zu können. Tatsächlich stiegen Deutschlands Importe stark an. Wir wissen, daß all diese Arrangements nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa höchst empfindlich gegenüber dem Zustand des amerikanischen Kreditwesens machten, dessen Niedergang bereits vor der Krise begonnen hatte; und es machte sie davon abhängig, ob der amerikanische Kredithahn zugedreht werden würde, wie es dann 1929 nach dem Börsenkrach auch geschah. Das gesamte Kartenhaus für die »Reparationen« fiel während der Krise in sich zusammen. Aber zu dieser Zeit konnte die Einstellung der Zahlungen schon keinen positiven Effekt mehr auf Deutschland oder die Weltwirtschaft haben, die als integriertes System bereits zusammengebrochen war, und mit ihr 1931–33 auch alle Arrangements für die internationalen Zahlungen.
Die Zerstörungen und Probleme der Kriegs- und Nachkriegszeit und die politischen Schwierigkeiten in Europa können den wirtschaftlichen Zusammenbruch in den Jahren zwischen den Kriegen jedoch nur zum Teil erklären. Wirtschaftlich betrachtet kann man ihn aus zwei Perspektiven sehen.
Die erste wird vor allem ein auffälliges und stetig zunehmendes Ungleichgewicht in der internationalen Wirtschaft entdecken, verursacht durch die asymmetrische Entwicklung der USA und des Rests der Welt. Man könnte behaupten, daß das Weltsystem deshalb nicht funktionieren konnte, weil die USA den Rest der Welt nicht besonders brauchten (im Gegensatz zu Großbritannien, das vor 1914 das Zentrum des Weltsystems gewesen war) und sich deshalb auch nicht dafür interessierten, als globaler Stabilisator zu fungieren (wieder im Gegensatz zu Großbritannien, das sehr wohl wußte, wie sehr das Weltzahlungssystem auf dem Pfund Sterling basierte, und deshalb dafür gesorgt hatte, daß er stabil geblieben war). Die USA brauchten die Welt auch deshalb nicht besonders, weil sie nach dem Ersten Weltkrieg weniger Kapital, Arbeitskraft und (relativ gesehen) weniger Güter importieren mußten als jemals zuvor – abgesehen von einigen Rohstoffen. Ihre Exporte, obwohl international von Bedeutung (Hollywood hatte effektiv den gesamten internationalen Filmmarkt monopolisiert), machten einen wesentlich geringeren Teil des Nationaleinkommens aus als in irgendeinem anderen Industriestaat. Über die Frage, wie signifikant dieser Rückzug der USA aus der Weltwirtschaft tatsächlich war, kann man streiten. Aber ziemlich deutlich ist, daß amerikanische Ökonomen und Politiker in den vierziger Jahren von dieser Krisenanalyse stark beeinflußt waren, was schließlich auch dazu beitrug, Washington in den Kriegsjahren davon zu überzeugen, daß es nach 1945 die Verantwortung für die Stabilität der Weltwirtschaft übernehmen müßte.24
Die zweite Perspektive auf diese Depression rückt das Versagen der Weltwirtschaft in den Brennpunkt, eine Nachfrage zu stimulieren, die ausgereicht hätte, um dauerhafte Expansion zu garantieren. Wie wir wissen, war die Basis für den Wohlstand der zwanziger Jahre nur schwach – sogar in den USA, wo sich die Landwirtschaft bereits in der Depression befand und wo die Löhne im Gegensatz zum Mythos des großen »Jazz-Zeitalters« nicht dramatisch anstiegen, sondern in den letzten verrückten Jahren des Booms sogar stagnierten.25 Wie so oft während eines Booms der freien Marktwirtschaft stiegen mit dem Zurückfallen der Löhne die Profite unverhältnismäßig an. Die Reichen konnten sich daher auch ein noch größeres Stück vom nationalen Kuchen abschneiden. Doch als die Massennachfrage in der Blütezeit von Henry Ford nicht mehr mit der rapide wachsenden Produktivität des industriellen Systems Schritt halten konnte, hieß das Resultat: Überproduktion und Spekulation. Sie wiederum waren dann Auslöser für den Zusammenbruch. Es soll hier nochmals betont werden, daß zeitgenössische Beobachter mit starkem Interesse an der Politik – ganz unabhängig davon, was Historiker und Ökonomen, die über diese Frage noch immer streiten, von diesem Argument halten – zutiefst von der schwachen Nachfrage beeindruckt waren; nicht zuletzt John Maynard Keynes.
Als der Kollaps dann eintrat, war er in den USA katastrophaler als in irgendeinem anderen Land; denn dort hatte man versucht, ausbleibende Nachfrage durch enorm erweiterte Möglichkeiten für Verbraucherkredite hochzuputschen. (Leser, die sich an die späten achtziger Jahre erinnern, werden sich hier auf vertrautem Boden wiederfinden.) Banken, die schon vor dem Großen Crash mit Hilfe von sich selbst belügenden Optimisten26 und wie Pilze aus dem Boden sprießenden Finanzbetrügern bereits durch den Spekulationsboom auf dem Grundstücksmarkt Schäden davongetragen hatten, waren nun mit Massen von zahlungsunfähigen Schuldnern konfrontiert und verweigerten neue Hypotheken oder die Umschuldungen der bereits aufgenommenen. Doch selbst das konnte sie nicht mehr davor bewahren, zu Tausenden zugrunde zu gehen.27 1933 war fast die Hälfte aller amerikanischen Hypothekenzahlungen im Verzug, und Tausende von diesen Hypotheken mußten pro Tag für verfallen erklärt werden.28 Allein die Automobilbesitzer hielten 1400 Millionen Dollar Schulden von insgesamt 6500 Millionen Privatschulden in kurz- und mittelfristigen Krediten.29 Was die Wirtschaft diesem Kreditboom gegenüber so verwundbar gemacht hatte, war, daß sie von den Verbrauchern nicht zum Erwerb von traditionellen Massenkonsumgütern – also Lebensmittel, Kleidung und ähnliches – genutzt wurden, die Leib und Seele zusammenhalten und deren Erwerb in geringerem Maße von Mehreinkommen abhängig ist (denn man kann seinen Bedarf an Lebensmitteln zwar nicht unter ein bestimmtes Maß senken, aber bei doppeltem Einkommen verdoppelt er sich auch nicht). Statt dessen kaufte man die dauerhaften Konsumgüter der modernen Konsumgesellschaft, und deren Pionier war schon damals Amerika. Doch der Kauf eines Autos oder eines Hauses konnte aufgeschoben werden, weil die Nachfrage nach solchen Konsumgütern gegen Änderungen im Einkommen ungeheuer sensibel ist.
Die Auswirkungen einer solchen Krise waren dramatisch, sofern sie nicht nach kurzer Zeit schon überwunden worden war und das Vertrauen in die Zukunft nicht zerstört hatte. So halbierte sich die Automobilproduktion in den USA zwischen 1929 und 1931; die Produktion von Schallplatten für arme Leute (race records und Jazzplatten, die sich an ein schwarzes Publikum richteten) wurde für eine Weile sogar fast völlig eingestellt – um nur ein Beispiel aus einem weniger hoch angesiedelten Wirtschaftszweig zu nennen. »Anders als bei den Eisenbahnen oder leistungsfähigen Schiffen, oder bei der Einführung von Stahl- und Maschinenwerkzeugen – die sich alle kostensenkend ausgewirkt haben –, erforderten die neuen Produkte und Lebensformen ein immer höheres Einkommensniveau und ein hohes Maß an Vertrauen in die Zukunft, das schnell zerstört werden konnte.«30 Und genau das war geschehen.
Auch die schlimmste zyklische Krise hat einmal ein Ende, und nach 1932 mehrten sich die Anzeichen, daß das Schlimmste überwunden war. In der Tat stürmten denn auch einige Volkswirtschaften voran. Japan (und in bescheideneren Ausmaßen auch Schweden) konnte bis Ende der dreißiger Jahre sein Produktivitätsniveau gegenüber der Zeit vor der Krise beinahe verdoppeln, und die deutsche Wirtschaft lag 1938 25 Prozent über dem Niveau von 1929 (nicht aber die italienische). Sogar eine so träge Wirtschaft wie die britische bot viele Anzeichen von Dynamik. Doch irgendwie fand der erwartete Aufschwung nicht statt. Die Welt verharrte in Depression. Am sichtbarsten war dies bei der größten aller Volkswirtschaften, in den USA, wo die vielen verschiedenen Experimente von Präsident F. D. Roosevelts »New Deal«, mit denen die Wirtschaft (auf nicht immer konsequente Art und Weise) angekurbelt werden sollte, nicht wirklich zum versprochenen Erfolg führten. 1937–38, nach einem großen Aufschwung, gab es eine neue Wirtschaftskrise – wenn auch in bescheidenerem Ausmaß als nach 1929; und die Automobilproduktion, der führende Sektor der amerikanischen Industrie, konnte nie wieder ihr Niveau von 1929 erreichen. 1938 war sie nur geringfügig höher, als sie es 1920 gewesen war.31 Im Rückblick aus den neunziger Jahren ist man beeindruckt vom Pessimismus vieler intelligenter Kommentatoren der damaligen Zeit. Fähige und brillante Ökonomen sahen die Zukunft eines sich selbst überlassenen Kapitalismus in der Stagnation. Diese Ansicht, die Keynes in seinem Pamphlet gegen den Versailler Friedensvertrag bereits vorausgesehen hatte, war nach der Krise natürlich vor allem in den USA weit verbreitet. Mußte nicht jede vollentwickelte Wirtschaft Tendenzen hin zur Stagnation zeigen? Ein anderer Prognostiker schlechter Aussichten für den Kapitalismus, der österreichische Ökonom Schumpeter, bemerkte: »In Zeiten einer länger anhaltenden wirtschaftlichen Misere bieten Ökonomen, die wie andere Menschen auch auf die Stimmungen ihrer Zeit hereinfallen, Theorien an, die beweisen sollen, daß es keinen Ausweg aus der Depression gibt« (Schumpeter, 1954, S. 1172). Vielleicht werden dereinst Historiker aus einem vergleichbaren Abstand auf die Periode von 1973 bis zum Ende des Kurzen 20. Jahrhunderts zurückblicken und davon fasziniert sein, daß sich die siebziger und achtziger Jahre hingegen beharrlich weigerten, die Möglichkeit einer allgemeinen Depression der kapitalistischen Weltwirtschaft auch nur in Betracht zu ziehen.
Trotz alledem waren die dreißiger Jahre auch ein Jahrzehnt der großen technologischen Innovationen in der Industrie, beispielsweise bei der Entwicklung von Plastikstoffen. Auch in der Unterhaltungsindustrie und unter den später so genannten »Medien« fand zumindest in der angelsächsischen Welt der eigentliche Durchbruch in dieser Zeit statt: der Siegeszug des Radios für die Massen, der Filmindustrie Hollywoods und schließlich auch des modernen Tiefdruckverfahrens bei der illustrierten Presse (siehe Sechstes Kapitel). Vielleicht nicht ganz so überraschend war der Aufstieg von gigantischen Filmtheatern, die sich wie Traumpaläste aus den grauen Städten der Massenarbeitslosigkeit erhoben, denn Kinokarten waren bemerkenswert billig. Und die Jüngsten und Ältesten, die wie immer unverhältnismäßig zahlreich von Arbeitslosigkeit betroffen waren, hatten viel Zeit totzuschlagen. Soziologen stellten übrigens auch fest, daß während der Depression mehr Eheleute Gefallen an gemeinsamen Freizeitvergnügungen fanden als vorher.32