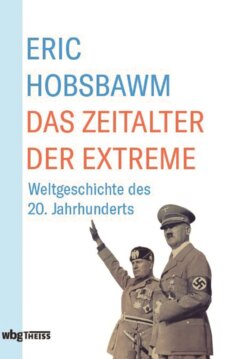Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 35
3
ОглавлениеDer Aufstieg der radikalen Rechten nach dem Ersten Weltkrieg war zweifellos eine Antwort auf die Gefahr – und in der Tat auch auf die Realität – einer mächtigen sozialen Revolution und einer starken Arbeiterklasse, und besonders auf die Oktoberrevolution und den Leninismus. Ohne diese hätte es keinen Faschismus gegeben. Demagogische rechte Ultras hatten zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts in einer ganzen Reihe von europäischen Staaten politisch ihre Stimme erhoben und sich aggressiv gebärdet, doch bis 1914 hatte man sie mehr oder weniger überall unter Kontrolle halten können. So gesehen haben die Apologeten des Faschismus wahrscheinlich recht, wenn sie behaupten, Lenin habe Mussolini und Hitler heraufbeschworen. Aber es ist völlig ungerechtfertigt, sich mit der Behauptung reinwaschen zu wollen – wie es einige deutsche Historiker in den achtziger Jahren versucht haben –, daß die faschistische Barbarei nur ein Abbild der Barbarei gewesen sei, die die Russische Revolution zuvor verübt habe, und daß der Faschismus diesen Vorgänger nur imitiert habe.15
Die These, daß der Aufstieg der Rechten im wesentlichen nur als Reaktion auf die revolutionäre Linke möglich gewesen sei, muß allerdings in zweierlei Hinsicht modifiziert werden. Erstens wird dabei grundsätzlich der Einfluß unterschätzt, den der Erste Weltkrieg auf die Mittel- bzw. untere Mittelschicht und, nach dem November 1918, auch auf jene nationalistisch eingestellten Soldaten und jungen Männer ausgeübt hat, die nicht vergessen konnten, daß man sie mit dem Ende des Krieges auch ihrer Chancen zum Heroismus beraubt hatte. Der sogenannte »Frontsoldat« sollte noch eine wichtige Rolle in der Mythologie der radikalen Rechten spielen – Hitler selbst war einer von ihnen. Außerdem sollte er die Basis für die ersten Gruppen von ultranationalistischen, gewalttätigen Schwadronen bilden, wie die italienischen squadristi und die deutschen Freikorps, deren Offiziere im Frühjahr 1919 die deutschen Kommunistenführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordeten. 57 Prozent der italienischen Faschisten der ersten Stunde waren ehemalige Soldaten. Wie gesagt, der Erste Weltkrieg war eine Maschine zur Brutalisierung der Welt gewesen, und solche Männer sonnten sich in dem Ruhm, ihrer latenten Brutalität nun freien Lauf lassen zu können.
Das bekannte Engagement der Nachkriegslinken gegen Krieg und Militarismus und der Abscheu im Volk gegen das Massentöten im Ersten Weltkrieg dürfen uns nicht dazu verleiten, das Auftauchen einer zwar relativ kleinen, aber absolut gesehen ziemlich großen Minorität zu unterschätzen, für die das Kampferlebnis (sogar unter den Bedingungen von 1914–18) zur wichtigsten und prägendsten Lebenserfahrung geworden war und für die eine Uniform und Disziplin, Selbstaufopferung oder die Opferung anderer, Blut, Waffen und Gewalt das Leben eines Mannes erst wirklich lebenswert machten. Sie schrieben zwar nicht viele Bücher darüber, aber einige sind (vor allem in Deutschland) erschienen. Diese Rambos der damaligen Zeit waren die geborenen Rekruten für die radikale Rechte.
Die zweite Modifikation dieser These muß lauten, daß der Aufstieg der Rechten keine Reaktion auf den Bolschewismus an sich war, sondern auf alle Bewegungen, besonders auf die organisierte Arbeiterklasse, die die bestehende Gesellschaftsordnung bedrohten oder für deren Zusammenbruch verantwortlich gemacht werden konnten. Lenin diente dafür eher als Symbol, als daß er die Realität dieser Bedrohung verkörperte; und in den Augen der meisten Politiker wurde diese Bedrohung auch weniger durch die sozialistischen Arbeiterparteien an sich repräsentiert – deren Führer relativ moderat waren – als durch die wachsende Macht, Selbstsicherheit und Radikalität der Arbeiterklasse selbst: Denn nur sie verhalf den alten sozialistischen Parteien zu neuer politischer Macht und machte sie zu unverzichtbaren Stützen eines liberalen Systems. Es war ja kein Zufall, daß fast überall in Europa die zentrale Forderung aller sozialistischen Kampagnen seit 1889 eben in der allerersten Nachkriegszeit durchgesetzt werden konnte: der Achtstundentag.
Es war also mehr die Bedrohung, die in der wachsenden Macht der Arbeiterschaft lag, die das Blut der Konservativen gefrieren ließ, als die bloße Verwandlung von Gewerkschaftsführern und Oppositionssprechern zu Ministern, obwohl auch das schon bitter genug war, gehörten diese ja per definitionem zur »Linken«. Außerdem gab es in einer Zeit des sozialen Aufruhrs keine klare Linie, die sie von den Bolschewiken abgegrenzt hätte. Es war ja auch so, daß sich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren viele sozialistische Parteien gerne mit den Kommunisten verbündet hätten, wenn diese eine Zusammenarbeit nicht abgelehnt hätten. Matteotti, der Mann, den Mussolini nach seinem »Marsch auf Rom« ermorden ließ, war denn auch nicht eine führende Figur des PCI, sondern Sozialist gewesen. Der traditionellen Rechten mag zwar das gottlose Rußland als Verkörperung allen Übels dieser Welt erschienen sein, aber der Aufstand der Generäle in Spanien 1936 richtete sich trotzdem nicht gegen die Kommunisten als solche (wohl weil sie den kleinsten Teil der Volksfront bildeten; siehe Fünftes Kapitel). Er richtete sich gegen die Rebellion eines Volkes, das bis zum Beginn des Bürgerkriegs Sozialisten und Anarchisten politisch gefördert hatte. Nur eine Rationalisierung ex post kann den Faschismus mit Lenin und Stalin entschuldigen.
Was aber noch einer Erklärung bedarf, ist, weshalb die Rechte nach dem Ersten Weltkrieg ihren entscheidenden Sieg in Gestalt des Faschismus erringen konnte. Denn extremistische Bewegungen der Ultrarechten hatte es auch vor 1914 schon gegeben – hysterisch nationalistisch und xenophobisch, kriegsverherrlichend und gewalttätig, intolerant und den Mitteln der Gewalt verschrieben, leidenschaftlich antiliberal, antidemokratisch, antiproletarisch, antisozialistisch und antirationalistisch, in Träumen von Blut und Boden schwelgend und die Rückkehr zu Wertvorstellungen ersehnend, die die Moderne zerstört hatte. Sie hatten einen gewissen Einfluß innerhalb der politischen Rechten und in einigen intellektuellen Zirkeln, aber nirgendwo hatten sie dominieren oder die Kontrolle übernehmen können.
Erst der Zusammenbruch der alten Regime und herrschenden Klassen und ihrer ganzen Maschinerie aus Macht, Einfluß und Hegemonie gab der radikalen Rechten nach dem Ersten Weltkrieg eine Chance. Wo die alten Strukturen weiterbestanden, dort gab es auch keinen Bedarf am Faschismus. In Großbritannien konnte er sich trotz eines kurzen, nervösen Aufflackerns nicht entwickeln. Die traditionelle konservative Rechte behielt die Kontrolle. In Frankreich konnte er sich bis zur Niederlage 1940 nicht durchsetzen. Obwohl die traditionelle radikale Rechte – die monarchistische Action Française und der Croix de Feu (Feuerkreuz-Verband) von Colonel La Rocque – absolut bereit gewesen war, sich auf die Linke zu stürzen, war sie nicht eindeutig faschistisch. Einige aus ihren Reihen sollten später sogar der Résistance beitreten.
In den neuen unabhängigen Staaten gab es kein Bedürfnis nach dem Faschismus, wenn eine neue nationalistische Klasse oder Gruppe die Regierungsgewalt übernommen hatte. Deren Vertreter konnten zwar reaktionär sein und hätten durchaus – aus Gründen, die später beleuchtet werden sollen – für eine autoritäre Regierungsform optieren können; dennoch war es nur Rhetorik, wenn der Wechsel zur antidemokratischen Rechten im Europa der Zwischenkriegsjahre augenblicklich mit Faschismus gleichgesetzt wurde. Faschistische Bewegungen von Bedeutung gab es weder im neuen Polen, das von autoritären Militaristen regiert wurde, noch im böhmischen und im mährischen Teil der Tschechoslowakei, die demokratisch waren, noch im (überwiegend) serbischen Kernland des neuen Jugoslawien. In Staaten, wo einflußreiche faschistische oder vergleichbare Bewegungen existierten, die von Rechten oder Reaktionären alten Stils geführt wurden (wie in Ungarn, Rumänien, Finnland und im Spanien von Franco, der selbst kein Faschist war), da gab es auch kaum Schwierigkeiten, sie unter Kontrolle zu halten – es sei denn, die Deutschen hatten ihre Daumenschrauben angesetzt (wie 1944 in Ungarn). Das heißt jedoch nicht, daß nationalistische Minderheitenbewegungen in alten oder neuen Staaten den Faschismus nicht attraktiv gefunden hätten, und sei es auch nur deshalb, weil sie von Italien und nach 1933 auch von Deutschland finanzielle und politische Unterstützung erwarten konnten, wie beispielsweise das (belgische) Flandern, die Slowakei und Kroatien.
Optimale Bedingungen für einen Triumph der besessenen Ultrarechten waren vielmehr ein alter Staat, dessen Mechanismen funktionsunfähig geworden waren; eine Masse aus desillusionierten, desorientierten und unzufriedenen Bürgern, die nicht mehr wußten, wem ihre Loyalität gehören sollte; starke sozialistische Bewegungen, die mit einer sozialen Revolution drohten oder zu drohen schienen, aber nicht wirklich in der Lage waren, sie durchzuführen; und ein nationaler Widerstand gegen die Friedensverträge von 1918–20. Unter solchen Umständen waren die hilflosen alten herrschenden Eliten versucht, bei den Ultraradikalen Zuflucht zu suchen, wie die italienischen Liberalen 1920–22 bei Mussolinis Faschisten und die deutschen Konservativen 1932–33 bei Hitlers Nationalsozialisten. Und dies waren auch die Bedingungen, unter denen sich die Bewegungen der radikalen Rechten in mächtige, wohlorganisierte und oft auch uniformierte paramilitärische Truppen (squadristi, Sturmtruppen) verwandelten – oder, wie in Deutschland während der Weltwirtschaftskrise, eben zu einem gewaltigen Heer von Wählern. Doch in keinem der beiden faschistischen Staaten konnte der Faschismus einfach »die Macht übernehmen«, auch wenn er mit seiner Rhetorik dröhnend ankündigte, »nach Rom zu marschieren«, wie in Italien, oder »die Straße zu erobern«, wie in Deutschland. In beiden Fällen kam der Faschismus durch Begünstigung oder (in Italien) sogar durch die Initiative des alten Regimes an die Macht, also auf »konstitutionelle« Weise.
Neu am Faschismus war, daß er sich – erst einmal an die Macht gelangt – weigerte, die alten politischen Spiele weiterzuspielen, und daß er begann, die Dinge, wo er nur konnte, zu verändern. Der totale Machttransfer und die vollständige Eliminierung aller Rivalen dauerten in Italien zwar länger (1922–28) als in Deutschland (1933–34), doch sobald das erreicht war, gab es keinerlei innenpolitische Grenzen mehr für die uneingeschränkte Diktatur eines alles beherrschenden populistischen Führers (»Duce«, »Führer«).
An dieser Stelle sollte kurz zwei völlig verfehlten Thesen entgegengetreten werden. Die erste stammt von den Faschisten, wurde aber von vielen liberalen Historikern übernommen, und die zweite war dem orthodoxen sowjetischen Marxismus lieb und wert: erstens hat niemals eine »faschistische Revolution« stattgefunden; zweitens war der Faschismus niemals Ausdruck des »Monopolkapitalismus« oder Großunternehmertums gewesen.
Der Faschismus besaß nur insofern revolutionäre Elemente, als er von Menschen getragen wurde, die eine fundamentale Transformation der Gesellschaft herbeisehnten und dabei häufig auch antikapitalistische und antioligarchische Beweggründe hatten. Doch das Pferd des revolutionären Faschismus war entweder gar nicht erst am Start erschienen oder wurde nicht zum Rennen zugelassen. Hitler hat schnellstens alle eliminiert, die die »sozialistische« Komponente im Namen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei – im eindeutigen Gegensatz zu ihm selbst – ernst genommen hatten. Und die Utopie der Rückkehr zu einer Art Mittelalter des kleinen Mannes, das von Erbhofbauern, Künstler-Handwerksleuten wie Hans Sachs und blondbezopften Mädchen bevölkert gewesen war, war kein Programm, das in einem bedeutenden Staat des 20. Jahrhunderts realisiert werden konnte (außer in der Alptraumversion von Himmlers Plänen für eine reinrassige Gesellschaft), und am wenigsten von Regimen, die sich einer spezifischen Art von Modernisierung und technologischem Fortschritt verschrieben hatten, wie die Faschisten Italiens und Deutschlands.
Was die Nationalsozialisten mit Sicherheit erreichten, war eine radikale Säuberung des Staates von den alten Eliten und institutionellen Strukturen des Kaiserreichs. Immerhin rekrutierte sich die einzige Gruppe, die sich jemals wirklich gegen Hitler aufgelehnt hat (Juli 1944) – und folgerichtig auch dezimiert wurde –, aus der alten aristokratischen preußischen Armee. Die völlige Zerstörung der alten Eliten und alten Rahmenbedingungen, nach Kriegsende durch die Politik der westlichen Besatzungsarmeen bestätigt, sollte es schließlich auch ermöglichen, daß die Bundesrepublik auf einem sehr viel festeren Fundament errichtet wurde als die Weimarer Republik von 1918–33, die kaum mehr gewesen war als ein geschlagenes Kaiserreich minus Kaiser. Ganz gewiß hatte der Nazismus ein soziales Programm für die Massen, das er teilweise auch realisierte, wie zum Beispiel Ferien, Sportaktivitäten oder auch den geplanten »Volkswagen« (den die Welt nach dem Krieg als »Käfer« kennenlernen sollte). Doch seine wichtigste Errungenschaft war, daß er die Weltwirtschaftskrise nachhaltiger als andere Regierungen abwickeln konnte, weil ihn sein Antiliberalismus dazu brachte, nicht a priori dem Glauben an die freie Marktwirtschaft anzuhängen. Und doch war der Nazismus eher ein aufpoliertes und revitalisiertes altes Regime als ein grundlegend neues und völlig anderes. Wie das imperiale und militaristische Japan der dreißiger Jahre (von dem niemand behauptet hätte, daß es revolutionär gewesen sei) hatte auch der Nazismus eine nichtliberale kapitalistische Wirtschaft, der es gelang, sein Industriesystem auf schlagend eindrucksvolle Weise zu dynamisieren. Die wirtschaftlichen und anderen Errungenschaften des faschistischen Italien waren, wie der Zweite Weltkrieg zeigen sollte, weit weniger beeindruckend. Seine Kriegswirtschaft war ungewöhnlich schwach. Das ganze Gerede von einer »faschistischen Revolution« war pure Rhetorik, wenn es vielen aufrechten italienischen Faschisten der Basis auch zweifellos ernst damit gewesen war. Das italienische Regime war ganz offen von den Interessen der alten herrschenden Klassen geprägt und eher als Schutz gegen die revolutionären Unruhen nach 1918 ins Leben gerufen worden denn – wie in Deutschland – als Reaktion auf das Trauma der Weltwirtschaftskrise und auf die Unfähigkeit der Weimarer Regierungen, ihrer Herr zu werden. Doch auch der italienische Faschismus, der in gewisser Hinsicht den Prozeß der italienischen Einigung aus dem 19. Jahrhundert weiterführte und damit eine stärkere und zentralistischer augerichtete Regierung hervorbrachte, konnte einige Errungenschaften vorweisen. So etablierte er beispielsweise das einzige Regime in Italien, das jemals erfolgreich gegen die sizilianische Mafia und die neapolitanische Camorra vorgehen konnte. Doch seine historische Bedeutung liegt weder in seinen Zielen noch in seinen Errungenschaften, sondern einzig in seiner Rolle als Pionier für eine neue Version der siegreichen Konterrevolution. Mussolini inspirierte Hitler, und Hitler versäumte es niemals, diesen Einfluß und die vorrangige Bedeutung Italiens hervorzuheben. Andererseits wies der italienische Faschismus eine völlige Anomalie unter den rechten Bewegungen auf, und das sogar für relativ lange Zeit: Er tolerierte die künstlerische Avantgarde des »Modernismus« nicht nur, sondern entwickelte sogar eine gewisse Vorliebe für sie; und er zeigte völliges Desinteresse am antisemitischen Rassismus, bis Mussolini 1938 auf die Linie von Deutschland einschwenkte.
Was nun die »monopolkapitalistische« These betrifft, so kann man nur sagen, daß das wirkliche Großunternehmertum mit jeder Art von Regime zurechtkommt, das nicht zu Enteignungsmaßnahmen greift, und daß jedes Regime mit dem Großunternehmertum zurechtkommen muß. Der Faschismus war kein stärkerer »Ausdruck der Interessen des Monopolkapitals« als der amerikanische New Deal, die britischen Labour-Regierungen oder die Weimarer Republik. Das Großunternehmertum der dreißiger Jahre hat Hitler nicht ausdrücklich herbeigewünscht und hätte wohl auch einen orthodoxeren Konservatismus vorgezogen. Daher erhielt Hitler bis zur Weltwirtschaftskrise aus seinen eigenen Reihen auch nur geringe Unterstützung; und selbst in der ersten Zeit danach lief diese Unterstützung nur zögernd an und blieb relativ uneinheitlich. Aber als Hitler an die Macht kam, da kollaborierte das Großunternehmertum aus vollem Herzen und ging während des Zweiten Weltkriegs sogar so weit, Sklavenarbeiter und Häftlinge in den Konzentrationslagern für seine Geschäfte zu nutzen. Und das Großunternehmertum profitierte genauso wie die kleinen Geschäftsleute von der Enteignung der Juden.
Dennoch muß ausgesprochen werden, daß der Faschismus für das Unternehmertum durchaus auch bedeutende Vorteile gegenüber anderen Regimen hatte. Zuerst einmal eliminierte oder besiegte er die soziale Revolution von links und schien in der Tat das beste Bollwerk gegen sie zu sein. Zweitens eliminierte er Gewerkschaften und beseitigte Beschränkungen der Arbeitgeberrechte gegenüber der Arbeiterschaft. In der Tat hatten die meisten Chefs und Arbeitgeber in ihren eigenen Geschäftsbereichen schon längst das »Führerprinzip« des Faschismus gegenüber ihren Untergebenen angewandt, und nun bot ihnen der Faschismus die autoritative Rechtfertigung dafür. Drittens verhalf die Zerstörung der Arbeiterbewegungen dem Unternehmertum zu einer völlig ungerechtfertigt günstigen Lösung der aus der Depression entstandenen Probleme. Während der Anteil der oberen 5 Prozent der Verbraucher in den USA zwischen 1929 und 1941 am (nationalen) Gesamteinkommen um 20 Prozent sank (einen ähnlichen, aber bescheideneren egalitären Trend gab es in Großbritannien und Schweden), konnten die oberen 5 Prozent in Deutschland in ebendieser Periode einen 15 prozentigen Zuwachs erleben.16 Und schließlich funktionierte der Faschismus, wie schon erwähnt, gut bei der Dynamisierung und Modernisierung von Industriewirtschaften, allerdings weit weniger gut als westliche Demokratien in bezug auf risikoreiche, langfristige techno-wissenschaftliche Planungen.