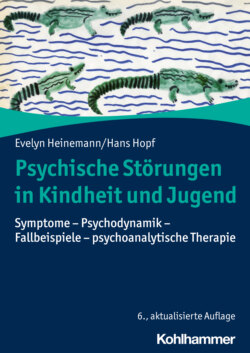Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Triebtheorie, Ich-Psychologie und Objekbeziehungstheorie
ОглавлениеIn der Psychoanalyse wird zwischen der Triebentwicklung, der Entwicklung der Objektbeziehungen und der narzisstischen Entwicklung des Selbst unterschieden. Diese Entwicklungen verlaufen parallel und beeinflussen sich wechselseitig. Die Vorstellung, dass sich die psychische Struktur aus einem komplizierten Interaktionsprozess zwischen Anlage und Umwelt entwickelt, macht die Psychoanalyse nicht nur zu einer Krankheits- und Behandlungslehre, sondern zu einer kritischen Kulturtheorie, die Biologie, Ethnologie und Soziologie integriert.
Die Triebtheorie der Psychoanalyse geht wesentlich auf Freud zurück. Freud stellte im Laufe seiner Publikationen mehrere Triebtheorien auf. Zunächst sprach Freud in »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« (1905d) vom Dualismus der Libido (Sexualtriebe zur Arterhaltung) und der Ichtriebe (Selbsterhaltungstriebe). Freud fasste also ursprünglich Aggression als Teil des Sexualtriebes auf. Aggression diente als Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen. In »Triebe und Triebschicksale« (1915c) trennte sich Freud von der Vorstellung, Aggression sei eine libidinöse Strebung, und sprach vom Gegensatz von Liebe und Hass. In »Jenseits des Lustprinzips« (1920g) geht er schließlich erneut von einem Triebdualismus aus, nämlich dem Lebenstrieb (Libido), der die Sexualtriebe und die Selbst- und Arterhaltungstriebe umfasse, sowie dem Todestrieb (Destrudo), der den Aggressionstrieb beinhalte und das Ziel habe, aufzulösen und zu zerstören. Im Todestrieb wird Aggression primär gegen das Selbst gerichtet und erst sekundär durch die Mischung mit dem Lebenstrieb nach außen gewendet. Nur wenige Psychoanalytiker, speziell die Schulen, die auf Melanie Klein oder Francoise Dolto zurückgehen, halten heute noch an der Todestriebhypothese fest, der Dualismus von Libido und Aggressionstrieb dagegen ist unumstritten.
In der Ich-Psychologie, die auf A. Freud (1936) und Hartmann (1939) zurückgeht, rückte die Störung des Ich und Über-Ich gegenüber der Triebentwicklung in den Vordergrund. Hartmann (1955) führte den Begriff der Neutralisierung ein. Als solche bezeichnet er den Wechsel libidinöser wie aggressiver Energie in einen nicht triebhaften Modus. Auf diese Weise werden die Energien der Triebe dem Ich verfügbar gemacht, das Ich kann sie kontrollieren, nutzen und die Abfuhr aufschieben. Die primär aggressiven Tendenzen werden auf diese Weise in nützliche, expansive und konstruktive verwandelt.
In der Objektbeziehungspsychologie wird die Triebtheorie weiter modifiziert. Nach Kernberg (1989) strukturieren sich Triebe aus spezifischen Affektdispositionen und den verinnerlichten Objektbeziehungen, d. h. den Selbst- und Objektrepräsentanzen. AngeboreneAffektdispositionenfärben als gute und böse Affekte die Objektbeziehungen. Anfänglich sind Affekte aufgrund der Ich-Schwäche in »gut und böse« gespalten. Erst später wird Spaltung zu einem aktiven Abwehrvorgang. Aus diesen Affektdispositionen und den realen Erfahrungen von Interaktionen, d. h. der Bildung von Selbst- und Objektrepräsentanzen, strukturieren sich nach Kernberg Libido und Aggression: »Libido und Aggression repräsentieren die beiden umfassenden psychischen Triebe, welche die übrigen Triebkomponenten und die anderen, zuerst in Einheiten von internalisierten Objektbeziehungen konsolidierten, Bausteine integrieren« (ebd., S. 106 f.).
Die Theorie der Spaltung der Affekte in »gut und böse« geht auf Melanie Klein (1972) zurück, die zwischen einer frühen paranoid-schizoiden Position und der späteren depressiven Position unterschied. Sie sieht die Ambivalenz der depressiven Position, die Integration guter und böser Aspekte, als wesentliche Voraussetzung der Ichreifung. Kognitive Reifung, Abnahme der Angst vor den eigenen Aggressionen sowie gute Erlebnisse mit der Mutter fördern die Auflösung der paranoid-schizoiden Position, in der Spaltung vorherrscht. In der depressiven Position sind Wiedergutmachung, Ambivalenz und Dankbarkeit möglich. Aggression wandelt sich in Schuldgefühl, wenn die Fähigkeit zur Integration guter und böser innerer Bilder erreicht, das Ertragen des Ambivalenzkonfliktes möglich ist. Beim Vorherrschen von Ambivalenz richtet sich Aggression auch gegen die guten Anteile des Objektes. Aus Schuldgefühl entsteht der Drang, den Schaden wiedergutzumachen, dabei müssen die Liebesgefühle, d. h. die libidinösen Gefühle, nach Klein allerdings den destruktiven Regungen gegenüber überwiegen. Dankbarkeit verstärkt die Liebe zum äußeren Objekt. Dankbarkeit und Wiedergutmachung verstärken sich gegenseitig und steigern die Fähigkeit, anderen zu vertrauen, und die Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. Die bessere Anpassung an die Realität, die Beziehung zu den realen Eltern, ist dem Kind eine große Hilfe gegenüber den fantasierten Imagines. Während in den frühen Entwicklungsstufen die aggressiven Fantasien gegen die Eltern und Geschwister Angst hervorrufen – vor allem Angst, jene Objekte könnten sich gegen das Kind selbst wenden –, bilden nun diese Aggressionen die Grundlage für Schuldgefühle und den Wunsch nach Wiedergutmachung (Klein 1934, S. 103).
Betrachten wir nun die Entwicklung der Triebe, der Objektbeziehungen und ihrer Verinnerlichungen sowie die narzisstische Entwicklung des Selbst.