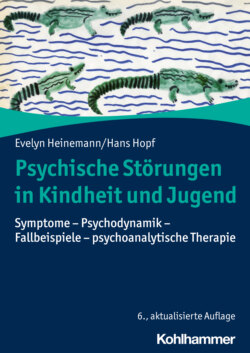Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Die Entwicklung der Objektbeziehungen
ОглавлениеLange Zeit galt die frühkindliche Phasentheorie Margret Mahlers (1978) als Kernstück psychoanalytischer Entwicklungstheorie. In Anlehnung an Freuds (1914) Theorie des primären Narzissmus und das Konzept der objektlosen Stufe von Spitz (1969, S. 53 ff.) sprach sie von einer Phase des normalen Autismus in den ersten beiden Lebensmonaten. Die Aufmerksamkeit des Säuglings sei ganz nach innen gerichtet – vermutlich auf seine Körperempfindungen –, so dass die äußere Welt und die Mutter nicht wahrgenommen werden. Die vorherrschende Aufgabe sei in dieser Zeit die Entwicklung einer Homöostase, d. h. eines Zustandes des Wohlbefindens in Koordination von Schlafen, Wachen, Nahrungsaufnahme, Verdauung und Temperaturregelung. Erst durch die Pflegeleistungen der Umwelt verschiebe sich die libidinöse Besetzung zur Körperperipherie. Der Säuglinge befinde sich zuvor in einem Zustand halluzinatorischer Desorientiertheit und Omnipotenz.
Im Alter zwischen vier und sechs Wochen bis zum Alter von fünf Monaten befindet sich nach Mahler der Säugling in einer normalen Symbiose mit der Mutter, einem dunklen Gewahrwerden der Außenwelt und des mütterlichen Objektes. Dieses Objekt wird nicht als unabhängig vom Selbst erfahren, sondern als mit ihm verschmolzen im Sinne einer unabgegrenzten Dualunion mit der Mutter. Hauptkennzeichen sei die »halluzinatorisch-illusorische somatopsychische omnipotente Fusion mit der Mutter« (Mahler 1978, S. 63). Es entsteht ein libidinöses Band zwischen Mutter und Kind, das sich auch in der Lächelreaktion des Säuglings äußert.
Ab dem 6. Lebensmonat beginnt nach Mahler die Loslösungs- und Individuationsphase (ebd., S. 72 ff.), die sie in vier Subphasen unterteilt: Die Subphase der Differenzierung (bis zum 10. Monat), die Übungssubphase (bis zum 17. Monat), die Subphase der Wiederannäherung (18. bis 24. Monat) und schließlich die Phase der Konsolidierung (bis zum 36. Monat).
Während der Subphase der Differenzierung ist das erste Anzeichen beginnender Differenzierung das visuelle Muster des Nachprüfens bei der Mutter. Das Kind beginnt sich für die Mutter zu interessieren, vergleicht sie mit anderen. Die Fremdenangst entsteht. Das vertraute Gesicht der Mutter wirkt angstmindernd. Vor allem Kinder, die gesättigt aus der Symbiose hervorgehen, zeigen aktives Differenzierungsverhalten.
In der Übungsphase ist das Kind aufgrund motorischer Reifung in der Lage zu krabbeln, zu kriechen und bald auch zu laufen. Es kann sich motorisch von der Mutter wegbewegen, Loslösung und Autonomie unmittelbar ausprobieren. Insbesondere durch das aufrechte Fortbewegen beginnt das Liebesverhältnis des Kindes mit der Welt, es kann aktiv erkunden und die unbelebte Umwelt erforschen.
In der dritten Subphase wird sich das Kind physischer Getrenntheit immer bewusster, und es macht stärkeren Gebrauch davon. Das Kind erlebt verstärkt Trennungssituationen und reagiert mit gesteigerter Trennungsangst und Wiederannäherung an die Mutter. Mahler spricht vom emotionalen Wiederauftanken. Körperkontakt wird erneut gesucht. Es beginnt ein Beschatten der Mutter und ein Weglaufen von ihr. In dieser Zeit erhalten die Übergangsobjekte (Winnicott 1971) eine besonders stabilisierende Funktion. Sie sind die ersten Symbole, sie sind die Mutter und sind sie doch nicht, sie können im Gegensatz zur realen Mutter manipuliert werden.
Die vierte Subphase bedeutet die Konsolidierung der Individualität und die Anfänge der emotionalen Objektkonstanz. In dieser Zeit kann das Kind schließlich getrennt von der Mutter funktionieren unter Bewahrung der Repräsentanz des abwesenden Objektes. Es kommt zur Vereinigung von guten und bösen Objektrepräsentanzen zu einem Ganzobjekt, zu einer Mischung von Aggression und Libido.
Vorteil des Mahlerschen Modells ist, dass es, im Gegensatz zu den Rekonstruktionen Freuds aus den Erwachsenenanalysen, aus der direkten Kinderbeobachtung kommt; es steht zudem im Wechselprozess mit der Triebentwicklung. Während der oralen Phase herrscht die Symbiose mit der Mutter und der Beginn der Ablösung der visuellen Wahrnehmung von der Dominanz der taktilen. Während der drei folgenden Subphasen herrscht die anale Phase mit der motorischen Reifung und der Möglichkeit zur Fortbewegung. Das »Nein« der analen Trotzphase fördert die Individuation.
Kritisch ist anzumerken, dass die Herleitung der Phasen des normalen Autismus und der Symbiose, die Mahler als Fixierungsstellen für den Autismus und die Psychosen ( Kap. VI) geltend macht, d. h. eine Herleitung aus der pathologischen Entwicklung, fragwürdig ist. Diese Phasen stimmen inzwischen nicht mehr mit den Erkenntnissen moderner Säuglingsbeobachtung überein.
Stern (1983; 1985) spricht von den ersten beiden Monaten als Phase des auftauchenden Selbstempfindens. Der Säugling ist bei Stern von Anfang an auf seine Umwelt bezogen. Er verfügt über angeborene Fertigkeiten zu lernen und ein Gefühl von Regelmäßigkeit und Ordnung herzustellen. Sein visuelles Abtastmuster, sein soziales Lächeln zeigen, dass er Sinneseindrücke miteinander in Beziehung setzt. Er verfügt nicht nur über Triebe, sondern über angeborene Vitalitätsaffekte, Furcht, Angst, Scham, Schuld, Freude und Wut, die er mit anderen austauscht. Er befindet sich in einer dialogischen Hör-, Seh- und Fühlwelt. Entgegen dem Konzept von Mahlers Symbiose gibt es bei ihm im Alter bis neun Monate ein sogenanntes Kernselbstempfinden zweier physisch getrennter Wesenheiten, zweier Körper, die miteinander in Beziehung treten können, ohne miteinander zu verschmelzen. Er sieht einen anfänglichen Zustand einer Trennung von Selbst und Objekt (self-versus-other), der Gemeinsamkeitserlebnisse (self-with-other) möglich macht. Gemeinsamkeitserlebnisse sind auch reichlich vorhanden, aber die Grenzen gehen im Normalfall nicht verloren. Das Selbst ist Urheber von Handlungen und Empfindungen und verfügt über ein spezifisches Gedächtnis. Das Alter von 7–9 bis 18 Monate beschreibt Stern als subjektives Selbstempfinden getrennter Psychen, als Gefühle von Intersubjektivität. Das Kind kann jetzt mit Hilfe von Symbolen kommunizieren.
Mit den Beobachtungen und Erkenntnissen von Stern ergeben sich fundamentale Kritikpunkte am Mahlerschen Modell. Wir schließen uns hier Dornes (1993, S. 75) an, der dafür plädiert, die Phase des normalen Autismus fallen zu lassen. Auch Mahlers Konzept der Symbiose betrachtet Dornes als nicht haltbar. Der Säugling nehme nicht symbiotisch wahr, nehme an Interaktionen nicht undifferenziert und passiv teil. Das symbiotische Verschmelzungsgefühl geht seiner Ansicht nach einher mit Sterns Konzept von Gemeinschaftserlebnissen zwischen Mutter und Kind, allerdings ohne eine Verschmelzung. Die Grenze zwischen Selbst und Objekt bleibt bei Stern erhalten. Intensive Gemeinschaftserlebnisse sind nicht von Grenzauflösung oder Konfusion begleitet, das sei nur in einer pathologischen Entwicklung so. Der Säugling kann sich weiterhin beim Erleben vom Miteinander abgrenzen. Nur wenn die Eltern die Autonomie behindern, kann die Flucht in eine Symbiose für einen überforderten Säugling entstehen, die Symbiose ist also bereits Abwehrprodukt. Gleichermaßen führt Stern zu einer Revision des Spaltungskonzeptes. Bei ihm kann der Säugling bereits ein ganzes Objekt wahrnehmen, erst affektive Belastungen können zu Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und damit zur Spaltung als Abwehrleistung führen. Die Erkenntnisse Mahlers haben damit für die pathologische Entwicklung weiterhin uneingeschränkt Gültigkeit.