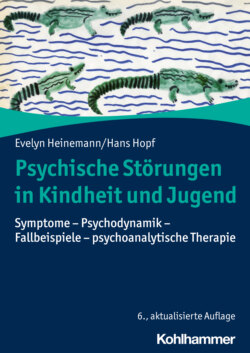Читать книгу Psychische Störungen in Kindheit und Jugend - Evelyn Heinemann - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Psychische Störungen und Geschlechterdifferenz
ОглавлениеWenn wir die in diesem Buch beschriebenen psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter unter geschlechtsspezifischen
Tab. 3.1: Psychische Störungen und Geschlechterdifferenz (Jungen Mädchen = 100 %)
JungenMädchen
Aspekten betrachten, so fallen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf, die uns unter Umständen Aufschluss geben können über unbewusste und bewusste Macht- und Sozialisationsverhältnisse in unserer Kultur. »Die Pathologie hat uns ja immer den Dienst geleistet, durch Isolierung und Übertreibung Verhältnisse kenntlich zu machen, die in der Normalität verdeckt geblieben wären« (Freud 1933a, S. 129).
Psychische Störungen bei Knaben konzentrieren sich auf das Alter der Kindheit, grob gesagt, die Schulzeit, während die Störungen der Mädchen hauptsächlich die Adoleszenz betreffen.
Die Geschlechterverteilung der in diesem Buch beschriebenen psychischen Störungen zeigt die Tabelle 3.1 ( Tab. 3.1).
Eine repräsentative Untersuchung von Hirschmüller, Hopf, Munz und Szewkies (1997) zeigt bei einer Stichprobe von 449 Kindertherapien und 160 Therapien mit Jugendlichen, dass bei Kindern bis 12 Jahren die Jungen 64 % der Therapieplätze in Anspruch nehmen, bei den Jugendlichen sind die männlichen Patienten nur noch mit 32 % vertreten. Die wichtigsten Symptome bei Behandlungsbeginn entsprechen in der Geschlechterverteilung etwa unseren Ausführungen ( Abb. 3.1).
Jungen wenden Aggression eher nach außen, Mädchen wenden sie gegen sich selbst. Jungen werden durch geschlechtsspezifische Erwartungen und Erziehung eher in körperlichen Aktionen narzisstisch bestätigt, sie beantworten innere Unruhe bald mit narzisstischen Größenfantasien, Aggression und motorischer Unruhe. Depressionen kommen bei Jungen nicht seltener vor als bei Mädchen, die depressiven Affekte werden nur stärker mit Hilfe einer Aggressivierung abgewehrt. Erstaunlich ist, dass Hyperaktivität kaum zur psychotherapeutischen Behandlung führt (Jungen 2 %, Mädchen 0,5 %, bei Jugendlichen beiderlei Geschlechts 0 % der Behandlungen). Die Abwehr der Anerkennung psychischer Ursachen und die Bevorzugung medikamentöser Behandlung
Abb. 3.1: Wichtiges Symptom bei Behandlungsbeginn. Aus: Hirschmüller u. a., 1997, S. 24
scheint noch immer sehr wirksam, trotz des Wissens um die Gefährlichkeit des Medikamentes Ritalin.
Die Störungen der Jungen dokumentieren die von Chodorow und Greenson beschriebene Identitätskrise des Knaben. Um männlich zu werden, muss er sich von der verführerischen Mutter abgrenzen und mit dem Vater oder einem Ersatzobjekt identifizieren. Der Knabe ist von der Verfügbarkeit eines solchen Objektes abhängig. Wenn der Vater schwach, nicht vorhanden oder als Identifikationsobjekt unattraktiv ist, wächst die Bedrohung für den Knaben, mit der Mutter symbiotisch und inzestuös verstrickt zu bleiben und die Geschlechtsidentität zu verlieren. Aggression und Hyperaktivität zeugen vom Versuch, sich von der Mutter abzugrenzen. Im Zwang, Stottern und Stammeln drückt sich die Ambivalenz aus, Aggression gegenüber der Mutter, aber auch Schuldgefühle und Zuneigung ihr gegenüber zu empfinden. Die sexuellen Identitätsstörungen, das Einnässen und Einkoten wehren Aggression der Mutter gegenüber im Sinne einer Perversion oder psychosomatisch ab, d. h. Aggression ist nicht mehr bewusst und die Ängste um die eigene Geschlechtsidentität stehen unbewusst im Vordergrund. In der Psychose ist die Abgrenzung und Triangulierung schließlich gescheitert.
Ganz im Sinne von Chodorow scheinen die Mädchen das Kindesalter unbeschadeter zu überstehen. Vielleicht ermöglicht die Schule den Mädchen, mit der Mutter in sublimierter Weise zu rivalisieren und sich so von ihr abzugrenzen. Die Mädchen durchlaufen keine mit der männlichen Entwicklung vergleichbare frühe Identifikationskrise. Sie scheinen eher unter Schuldgefühlen zu leiden, ihr Über-Ich ist, im Gegensatz zu Freuds Hypothese, rigider und führt zur Wendung der Aggression gegen das Selbst. Mertens (1992, S. 95) sieht in der frühen Identifikation des Mädchens mit der Mutter eine Ursache für ein strengeres, aber auch konsolidierteres Über-Ich als das des Knaben. Bei den Mädchen ist vermutlich die Verselbständigung komplizierter und löst mehr Schuldgefühle der Mutter gegenüber aus.
Die weibliche Entwicklung scheint in unserer Kultur in der Adoleszenz verstärkten Belastungen ausgesetzt zu sein. Vielleicht gelingt es den Knaben in der Adoleszenz über die Identifizierungen im Beruf, die Ablösung von der Mutter und die Sicherung männlicher Identität zu erreichen. Eggert-Schmid Noerr (1991) fand in gruppenanalytischen
Gesprächen bei männlichen, arbeitslosen Jugendlichen die Angst zu verweiblichen. Die Mädchen geraten in der Adoleszenz jedoch in eine Krise, sich nun endgültig von der Mutter ablösen zu müssen, was offenbar mit starken Schuldgefühlen und Verlustängsten behaftet ist (vgl. Bell 1996), und sie müssen Sexualität integrieren. Hysterie, Bulimie und Magersucht zeugen von der Angst, weiblich und sexuell aktiv zu werden. Über die bekannte Gleichsetzung von Essen und Sexualität wird der Kampf um sexuelle Autonomie auf das Essen verschoben oder ins Körperliche konvertiert und so maskiert. Die Rivalität, die durch den Reiz des Penis ausgelöst wird, weckt und reaktiviert archaische Trennungsängste und Schuldgefühle der Mutter gegenüber (Anzieu 1995). Starke Verlustängste und Aggressionen werden in der Depression introjiziert und über Schuldgefühle gegen das Selbst gewendet. Mutismus, Ängste und Phobien im Kindesalter sind bereits in der weiblichen Entwicklung Ausdruck dieser Trennungs- und Ablösekrise von der Mutter, Aggression wird auf die Außenwelt projiziert und die Beziehung zur Mutter regressiv stabilisiert. Auch die weibliche Entwicklung scheitert dann letztendlich an fehlenden nicht-mütterlichen, phallischen Identifikationsmöglichkeiten, phallisch nicht im Sinne eines Männlichkeitskomplexes, den Penis besitzen zu wollen, sondern im Sinne eines aktiven Begehrens.