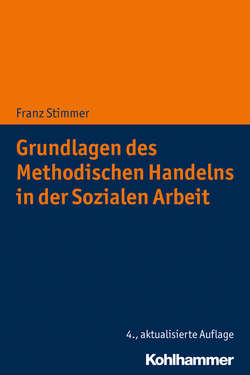Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Systematik: Orientierungsraster 3.4.1 Modell
ОглавлениеDas »wissenschaftliche« an den Wissenschaften ist, wie erwähnt, das methodische Handeln als ein intersubjektiv überprüfbarer (und meist komplexer) Prozess. In dem Modell des Orientierungsrasters ( Abb. 3) werden die zentralen inhaltlichen Ebenen, Elemente oder Funktionsprinzipien methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit benannt. Sie sind damit auch bezüglich ihrer Anwendung überprüfbar. Die einzelnen interdependenten Ebenen des Rasters bilden jedoch ein holistisches System, für das gilt, dass – nach der alten aristotelischen Regel – das Ganze mehr oder qualitativ höher ist als die Summe seiner Teile (Übersummationsregel). Die einzelnen Elemente beeinflussen sich also in einem emergenten Prozess wechselseitig und lassen etwas entstehen, was allein durch die Aneinanderreihung der einzelnen Elemente nicht möglich gewesen wäre. Aus der zunächst statischen Aufzählung der inhaltlichen Ebenen wird dadurch ein dynamisches System wechselseitiger Beeinflussung. Die in Abbildung 3 angeführten Ebenen sind zentral für das Methodische Handeln in der Sozialen Arbeit. Sie sind notwendig, wenn vielleicht auch nicht für alle Eventualitäten der Praxis ausreichend, sie sind also je nach Fall u. U. ergänzungsbedürftig.
Das idealtypische Modell – knappe, abstrahierende Kennzeichnungen (Max Weber) – bildet die Struktur, die Gesamtheit der Elemente ab, die im Weiteren inhaltlich beschrieben werden (Inhaltsebenen) und die in Annäherung zu vollziehen sind, soll professionell methodisch gehandelt werden. Die integrierende Umsetzung der Elemente des Modells findet in der Praxis der Sozialen Arbeit im Prozess des zirkulären Problemlösens ( Kap. 3.5 und Abb. 5) statt. Vom Methodischen Handeln in der Sozialen Arbeit kann, daraus abgeleitet, erst dann die Rede sein, wenn dieser Gesamtzusammenhang (Struktur und Prozess) beachtet und reflektiert wird. Die praktische Anwendung von Katalogen von Methoden oder Techniken, die in manchen Büchern und in der Aus- und Weiterbildung angeboten werden, mögen zwar in den Turbulenzen der Praxis kurzfristig hilfreich sein, Methodisches Handeln ist es jedoch nicht. So wird auch deutlich, dass spezifische Methoden in einen sehr viel größeren Zusammenhang eingebettet sind, ohne dessen Beachtung sie inhaltsleer bleiben müssten.
Ein Streben, komplexe Zusammenhänge erkennen zu wollen, ist einerseits eine wichtige Voraussetzung für ein fachlich kompetentes Handeln, in der Praxis sind allerdings Fachkräfte wie KlientInnen dadurch u. U. schnell überfordert, so dass es, um handlungsfähig zu bleiben, sinnvoll und professionell ist, bewusst und gezielt zu reduzieren ohne einem Reduktionismus anheim zu fallen. Das Orientierungsraster und das Modell des zirkulären Problemlösens bieten für Fachkräfte einen Wegweiser – eine Art Kompass –, im gefährlichen Gelände der täglichen Praxis immer wieder einmal zu reflektieren, wo sie sich gerade befinden und um vielleicht hier und da die anderen Ebenen und Prozessphasen wahrzunehmen und sich anregen zu lassen, strukturierter und gezielter weiterzuarbeiten, Routinen vorübergehend hinter sich zu lassen, Versuche nach dem Motto »Probieren geht über Studieren« abzulehnen und sich insgesamt neue kreative Möglichkeiten zu eröffnen. Dies alles und ganz besonders auch zum Wohle der KlientInnen.
Methodisch handeln in der Sozialen Arbeit heißt, die Zusammenhänge zwischen den komplex miteinander wechselwirkend verbundenen Bereichen des Orientierungsrasters von der Anthropologie bis zu den Techniken zu verstehen, umzusetzen und auch in der alltäglichen konkreten Arbeit mit spezifischen Methoden immer wieder zu reflektieren. Und es heißt auch, dass die Planung und Organisation dieses Handelns (Sozialplanung, Sozialmanagement) sich dieser Zusammenhänge bewusst sein muss, um auf ihre Weise effektiv zu sein.
Im Folgenden werden die einzelnen inhaltlichen Ebenen kurz beschrieben:
• Die Grundlage Sozialer Arbeit und damit zugleich die Basis jeglichen Handelns in der Sozialen Arbeit bilden nach dem Orientierungsraster Anthropologie, Sozialphilosophie und Ethik ( Kap. 4). In ihnen sind zugleich, hierarchisch gesehen, die »höchsten« Ziele und Werte und die Rahmenbedingungen dieses Handelns verankert. Die an diese Basis rückgekoppelte Definition von Sozialer Arbeit bestimmt die Arbeitsprinzipien (Handlungsnormen).
• Je nach Definition, je nach »Schule«, je nach bevorzugter Theorie von Sozialer Arbeit (Marburger 1979, Engelke u. a. 2009) sind die Konsequenzen für jeweils alle weiteren Schritte im Rahmen des Orientierungsrasters zu beachten. Eine »kritisch-rationalistische« Sozialpädagogik (Sozialarbeitswissenschaft i. S. von Lutz Rössner), eine »alltagsorientierte« Sozialpädagogik (Alltagsansatz i. S. von Hans Thiersch), eine »kritisch-emanzipatorische« Sozialpädagogik (i. S. von Hermann Giesecke oder Klaus Mollenhauer), eine »historisch-materialistische« Sozialpädagogik (i. S. von Walter Hollstein oder Karam Khella), eine »geisteswissenschaftliche« Sozialpädagogik (i. S. von Herbert Nohl oder Erich Weniger) oder eine »sozialökologische Soziale Arbeit« (i. S. von Germain und Gitterman oder Wendt), um einige Grundorientierungen zu nennen, werden sich von den Basisdefinitionen her u. U. erheblich voneinander unterscheiden und damit auch bezüglich der von ihnen bevorzugten Arbeitsformen, Interaktionsmedien, spezifischen Methoden (Problemanalyse-, Interventions- und Reflexionsmethoden), Verfahren und Techniken. Dennoch gilt auch hier der wissenschaftstheoretische Lehrsatz Schopenhauers von der Notwendigkeit der gleicherweisen Beachtung von Homogenität und Spezifikation (1986, S. 11). Es ist also zu fragen, wo bei den genannten Orientierungen übereinstimmende Aussagen zu finden sind und worin sie sich wirklich unterscheiden. Dies bedeutet dann auch, ausgehend von den homogenen Aussagen, homogene Arbeitsprinzipien, Arbeitsformen, Interaktionsmedien und Methoden zu formulieren und sich gleichzeitig der darüberhinausgehenden spezifischen Unterschiedlichkeiten bewusst zu bleiben. In differenzierter Form ist diese Frage bisher umfassend jedoch nicht bearbeitet worden. Dies kann auch hier nicht geleistet werden. Die Handlungsleitenden Konzepte, die vorgestellt werden ( Kap. 8), sind jedoch so offen, dass sie für unterschiedliche theoretische Konzepte grundlegend sind.
Abb. 3: Orientierungsraster: Inhaltsebenen Methodischen Handelns von der Anthropologie bis zur Technik (und zurück)
• Aus den theoretischen Konzepten der Sozialen Arbeit resultieren (in Wechselwirkung mit konkreten sozialen Problemen) letztendlich deren Arbeitsfelder, die nach Lebensalter und/oder nach Lebenslagen strukturiert werden können. Ohne Zuordnung von Handlungsfeldern zu theoretischen und erkenntnisleitenden Konzepten bleiben diese beliebig, Moden oder politischen Forderungen unterworfen.
• Theoretische Konzepte der Sozialen Arbeit (Engelke u. a. 2009) sowie die Praxiserfahrungen bilden die Basis für die Handlungsleitenden Konzepte. Unter Konzept wird ein Entwurf, ein Plan, ein Modell verstanden, in dem die einzelnen Inhalte in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden. Handlungsleitende Konzepte in der Sozialen Arbeit zeichnen sich dadurch aus, dass ein logischer Zusammenhang von den axiologischen Grundannahmen bis zu den konkreten Techniken hergestellt wird. Je nach Vollständigkeit der inhaltlichen Ebenen und der Differenziertheit ihrer Ausgestaltung ergeben sich unterschiedliche Differenzierungsgrade ( Kap. 3.4.2) von Handlungsleitenden Konzepten. Manche dieser Konzepte sind in vielen Arbeitsfeldern anwendbar, haben also einen hohen Grad von Allgemeingültigkeit, andere sind eingeschränkter lebensaltersspezifisch oder lebenslagenspezifisch.
• Arbeitsprinzipien sind zu begründende Handlungsnormen, Grundsätze des Handelns zur Lösung von Problemen. In ihnen sind wesentliche Ziele spezifischen Handelns verdeutlicht. Sie leiten sich aus den sozialphilosophischen und ethischen Überlegungen ( Kap. 4) ab.
• Arbeitsformen sind unterschiedliche Sozialformen mit jeweils eigenen Voraussetzungen, die im Rahmen Handlungsleitender Konzepte umgesetzt werden. Sie dienen als Differenzierungsraster für die spezielleren Interaktionsmedien (Interaktionsmodi, Handlungsarten) und die spezifische Methodenwahl. Je nach Problemstellung und damit einhergehender Festlegung der Arbeitsformen und der Interaktionsmedien sind also einzelne Methoden als Problemlösungswege lege artis zu wählen (monomethodisches Vorgehen) und anzuwenden oder aber ein verschiedene Methoden oder auch einzelne Verfahren integrierendes Konzept (Kombinationsmethode) zu verwenden oder auch erst zu entwickeln und umzusetzen. Für die Wahl der Arbeitsformen und spezieller der Interaktionsmedien und noch spezieller der Methoden, Verfahren und Techniken ist die Problembzw. Situationsanalyse ( Kap. 5.) einschließlich der Ziele- und Thesenformulierungen ( Kap. 6) bestimmend.
• Spezifische Methoden beinhalten mehr oder weniger differenzierte Systeme von geregelten Verfahren(sweisen) und Techniken. Aus dem Instrumentarium der Basis- oder Standardverfahren eines Methodenkonzeptes werden die speziellen Verfahren entwickelt, als konkrete und situationsspezifische Anwendung der Basisverfahren zur Lösung von speziellen Praxisproblemen, u. U. mit entsprechenden Modifikationen (= sozialpädagogische Kreativität). Daneben gibt es Verfahren, die aus der Praxis heraus entwickelt wurden, die aber mangels axiologischer Fundierung und theoretischer Begründung ( Abb. 4) nicht den Status einer Methode erreichen. In der Praxis werden des Weiteren viele Verfahren (und Techniken) angewendet, ohne auf die Methoden bezogen zu werden, aus denen heraus sie entstanden sind (Rollenspiel, Skulpturarbeit, positive Verstärkung …). Techniken bilden das methodenimmanente und spezifische »Handwerkszeug«, das im Rahmen der gewählten Verfahren einer Methode Anwendung findet. Sie bezeichnen somit die grundlegenden Handlungsregeln, die eine Methode und ihre Verfahren (bzw. auch eigenständige Verfahren) in besonderer Weise kennzeichnen.
Die Effektivität und die Effizienz der Wahl von Handlungsleitenden Konzepten, Arbeitsformen, Interaktionsmedien, Methoden, Verfahren und Techniken bezüglich der Problemlösung sind zu evaluieren ( Kap. 10.1). Dabei sind auch die Qualität der Situationsanalyse und die der Durchführung der gewählten Methode mit ihren Verfahren und Techniken zu prüfen. Unter Umständen sind sogar als Folge der Reflexion/Evaluation die Arbeitsprinzipien zu revidieren oder gar die Basistheorie und die Basisdefinitionen bezüglich Sozialer Arbeit zu modifizieren oder als nicht hinreichend brauchbar zu verwerfen. Im Rahmen des Evaluationsprozesses wird auch deutlich, ob die Problemlösung wirklich nur eine sozialpädagogische Aufgabe ist, ob nur Teilbereiche dies sind, ob andere Professionen beteiligt werden müssen oder ob es überhaupt eine sozialpädagogische Aufgabe ist. Evaluation darf somit nicht nur am »Ende« eines Problemlösungsprozesses stehen, sondern ist als zirkulärer Reflexionsprozess zu verstehen, der alle Schritte immer wieder in Frage stellt und der auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Kosten-Nutzen-Analyse) mit einschließt.
Ganz gleich, wo in dieses Modell eingestiegen wird, sind die jeweils anderen Aspekte mehr oder weniger mit zu bedenken, soll kompetent und professionell methodisch gearbeitet werden. Eine noch so wirkungsvolle Technik muss dann bezogen werden auf die zugrunde liegende Methode, auf deren axiologischen Basisannahmen (Ethik, Menschenbild) und den daraus ableitbaren Arbeitsprinzipien, auf ihre theoretische Begründung, auf die Spezifika unterschiedlicher Arbeitsfelder sowie auf ihre Zuordnung zu den Arbeitsformen und Interaktionsmedien.
Im ersten Beispiel (Nachsorge Kap. 2.1) ist die Aufgabe zu lösen, alkoholabhängige Menschen in der Nachsorgephase in der Vorbereitung auf Alltagssituationen zu unterstützen (Arbeitsfeld, Problem). Wenn als Arbeitsprinzip Multiperspektivität (weite Themenwahl: Lebensstil- und Lebensweltelemente, gesellschaftliche Bezüge) und Hilfe zur Selbsthilfe gelten soll, ist im Rahmen eines passenden Handlungsleitenden Konzeptes (z. B. Empowerment) die Arbeitsform begründet zu wählen (z. B. Gruppenarbeit, um den Austausch der direkt Betroffenen untereinander zu fördern), das Interaktionsmedium zu vereinbaren (z. B. Gruppen-Beratung), die Methode festzulegen (z. B. Kombinationsmethode Themenzentrierte Interaktion und Psychodrama) sowie die Verfahren (z. B. Themeneinstimmung nach der Themenzentrierten Interaktion und zukunftsgerichtetes Rollenspiel) und Techniken (z. B. Dreifach-geleitetes Schweigen, Rollentausch und Spiegeln) zu bestimmen. Erst im Rahmen einer solchen Systematik wird methodisches Handeln den formulierten Ansprüchen gerecht, allerdings immer unter dem Vorbehalt der Verständigungsorientierung. Die vorläufige Planung muss flexibel revidierbar sein, sie muss in ihren einzelnen Phasen mit den Bedürfnissen und Zielvorstellungen der Klienten konfrontiert und professionell evaluiert werden. Dabei muss aber eine für alle Beteiligten stabilisierende Struktur, die klar vereinbart wird, beibehalten werden, auch dann, wenn Konflikte auftreten, die Anlass für eine konstruktive Auseinandersetzung sind. Ein ständiger Wechsel von Handlungsleitenden Konzepten, Arbeitsformen, Methoden usw. signalisiert eine Schwäche in der Systematik, die viele Quellen haben kann. Es kann beispielsweise sein, dass die Methode, selbst wenn SozialpädagogInnen sie beherrschen, für manchen Klienten »nicht passt« oder dass zwar die Methode geeignet wäre, Professionelle aber damit nur ungenügend arbeiten können oder dass das Arbeitsprinzip zu elitär gewählt wurde oder dass die Vereinbarungen nicht klar genug formuliert wurden oder dass ein Sozialpädagoge ganz einfach Angst hat und deswegen allen Wünschen seiner Klienten nachgibt usw.