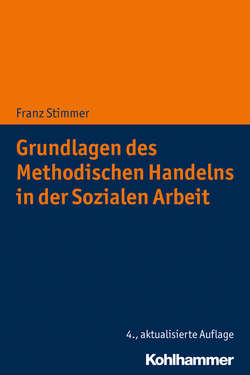Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5.1 Zugänge und Erstkontakt
ОглавлениеDie Zugänge zum Angebot der Sozialen Arbeit sind mehr oder weniger deutlich selbstbestimmt, häufig jedoch auch in diversen Variationen fremdbestimmt. Nach dem Grad der Selbstbestimmung kann u. a. unterschieden werden:
Zugang
• über eigene Einsicht und Motivation,
• über Anregung durch Ärzte, Heilpraktiker, Hebammen, Rechtsanwälte …,
• über Bitten, Drängen und Androhung durch Partner, Eltern, Kinder, Freunde, Arbeitgeber, Kollegen …,
• über die Vermittlung verschiedener – auch kontrollierender – Fachstellen (Jugendamt, Agentur für Arbeit …),
• als Auflage (verkehrspsychologische Beratung im Rahmen der Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung (MPU), Schwangerschaftskonfliktberatung),
• über einen Gerichtsbeschluss (Beratung/Therapie statt Strafe).
Der Erstkontakt erfolgt häufig während einer krisenhaften Zuspitzung eines Problems, dann, wenn der Leidensdruck besonders ausgeprägt ist: wenn der Gerichtsvollzieher zum wiederholten Male pfändet, wenn das Mobbing der Kollegen den Schlaf raubt, wenn der Ehemann wieder einmal zugeschlagen hat, wenn der Alkoholmissbrauch zum Scheidungsanwalt führt oder wenn die Eltern verzweifeln und den aggressiven Attacken ihrer Tochter hilflos ausgeliefert sind. Das heißt, dass Menschen, die – wie immer auch angeregt – Hilfe suchen, schon ein gewisses Maß an meist noch sehr labiler Veränderungsbereitschaft zeigen. Daraus lässt sich unschwer ableiten, dass der Erstkontakt, wo und wie immer er stattfindet, eine zentrale weichenstellende Funktion für den weiteren Verlauf hat, in dem dann vielleicht auch die Veränderungsmotivation in eine Inanspruchnahmemotivation (für Hilfsangebote) übergeht. Im Erstkontakt besteht zumindest die Chance, eine krisenhafte Situation schon etwas zu mildern und – bei einer verständigungsorientierten Haltung ( Kap. 4.6) – in einem relativ kurzen Gespräch, oft auch telefonisch, eine zuversichtliche Erwartungshaltung zu fördern (vgl. Prior 2010). Aus all dem wird deutlich, dass auch der Erstkontakt schon eine wesentliche Intervention darstellt – ein Einmischen in eine fremde Lebenswelt –, die ganz bewusst gestaltet werden muss. Zentral ist dabei eine reflektierte sozialpädagogische Haltung, wie sie im Kapitel 9.2.1.3 beschrieben ist. In größeren Einrichtungen ist es auch häufig eine Sekretärin, über die der allererste Kontakt stattfindet, die weitervermittelt oder vielleicht auch schon einen ersten Termin vereinbart oder auf spezielle Sprechzeiten hinweist. Die Qualität auch dieses Gesprächs – im positiven Fall freundlich, einladend, informativ – spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bezüglich der Weichenstellung hin zum Erstgespräch mit der Fachkraft und entscheidet u. U. schon, ob ein solches überhaupt stattfinden wird. Häufig werden nach dem Erstkontakt keine weiteren Schritte folgen, weil etwa die Veränderungsmotivation noch nicht genügend ausgeprägt bzw. beständig war oder durch einen misslungenen Erstkontakt wieder blockiert wurde. Vielfach sind Erstkontakte aber auch völlig ausreichend und hilfreich, vor allem dann, wenn es vorrangig um eine sachliche Information geht, beispielsweise bei Fragen nach Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Zuständigkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten oder sozialen Diensten.
Der Weg bis zum Erstkontakt ist aber nur selten geradlinig, sondern eher das Ergebnis vieler Einflussfaktoren wie das folgende Beispiel zeigt:
Viele Köche verderben den Brei – nicht immer!
Die Eltern des 17-jährigen Karl »schieben« ihn in ein Internat »ab«, wo er wenigstens das Zeugnis der »Mittleren Reife« erhalten soll, was bisher wegen seiner schlechten Noten undenkbar war. Besser wäre es natürlich, wenn er das Abitur machen würde. Karl ist immer wieder aufgefallen, als er betrunken nach Hause kam. Wenn er mit zwei Kumpels, die er selbst nicht als Freunde bezeichnete, in seinem Zimmer vor dem Computer saß, roch es manchmal eigenartig aus dem Zimmer. Die Eltern vermuteten, dass dort »gekifft« wird, was Karl vehement verneinte. Er war oft sehr zurückgezogen, dann auch wieder wegen Kleinigkeiten sehr aggressiv. Er ging aber in das Internat – »ich muss ja!« – und lernte schon am ersten Tag einen Mitschüler kennen, der, wie sich später herausstellte, schon erhebliche Erfahrungen mit einem verstärkten Alkohol- und Haschischkonsum hatte. Die weitere Entwicklung ging in die Richtung, dass Karl Zugang zu einem Kreis fand, in dem nicht nur konsumiert, sondern auch gedealt wurde. Den Betreuern, mit denen er einen guten Kontakt hatte, fiel das nach kurzer Zeit auf, es kam zu Gesprächen und auch zu drei Abmahnungen. Eine weitere Abmahnung würde bedeuten, dass er das Internat verlassen müsste. Der Wendepunkt kam, als er im Internat eine 18-jährige Mitschülerin kennen lernte, die dann seine Freundin wurde. Von da an nahm er die Möglichkeit – wie von den Betreuern nachdrücklich angeboten – wahr, im Internat mit einer Psychologin – zunächst widerwillig – Gespräche zu führen, die inhaltlich weit über den Drogenmissbrauch hinausgingen. Seine Freundin achtete sehr darauf, dass er sich nicht betrank, was ihn meist sehr aggressiv machte (»das ist meine Sache«, »ich lasse mich nicht unterdrücken«, »ich möchte auch mit meinen Kumpels feiern«), was aber insgesamt gesehen wirksam war. Mit seinem Vater, zu dem er trotz vieler Auseinandersetzungen ein sehr gutes Verhältnis hatte, kam es zusätzlich zu zwar meist kurzen aber emotional sehr offenen Gesprächen. Zur Verwunderung aller ging Karl von sich aus – mit ein wenig Unterstützung durch seine Freundin – zum Internatsarzt, ließ sich von ihm eine Adresse einer Drogenberatungsstelle geben, zu der er wöchentlich regelmäßig – neben den Gesprächen mit der Psychologin – zu den Beratungsterminen kam. Der Anfang war gemacht.