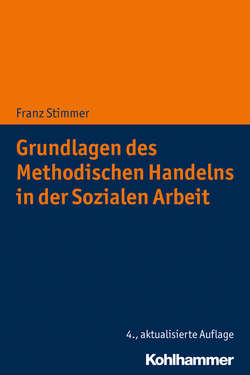Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Moderne Gesellschaft
ОглавлениеMenschenbilder und sozialphilosophische Ideen und die damit wechselwirksam verbundenen Ethiken schweben nicht im luftleeren Raum, sondern sind auf das engste verknüpft mit real existierenden Gesellschaften. Um Grundzüge einer Berufsethik zu entwickeln, sind deshalb gegebene gesellschaftliche Strukturen zu benennen und ihre dynamische Entwicklung zu berücksichtigen. Gesellschaft befindet sich immer im Übergang, wenn auch die Veränderungsgeschwindigkeit historisch unterschiedlich ist. Damit ist auch ein Teil dieser Gesellschaft, nämlich die konkrete Soziale Arbeit immer auch ein Übergangsphänomen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, was an Grundhaltungen und Basiswerten unbedingt zu schützen ist und was zeitbedingt begründet aufgegeben werden kann.
Der Alltag in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland beinhaltet Chancen und Gefährdungen zugleich. Die Chancen zugänglicher zu machen und die Gefährdungen zu mildern oder weniger tiefgreifend wirken zu lassen ist individuen- wie strukturbezogen präventive, korrigierende und kompensierende Aufgabe der Sozialen Arbeit. Wie schwierig dies ist, wenn nicht nur anpassungsethisch korrekt gehandelt werden soll, zeigen einige Kennzeichen dieser Gesellschaft und der damit »kompatiblen« Persönlichkeitsbilder. Das heißt auch, dass, je mehr reale Menschen sich diesen idealtypischen Bildern bezüglich der erwarteten Fähigkeiten nähern, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ihre Teilhabe an den Chancen dieser Gesellschaft gesicherter ist und umgekehrt. Dies dient der Stabilisierung der Gesellschaft wie der Identität ihrer Mitglieder, birgt allerdings auch die Gefahr der Erstarrung für beide Teile in sich. Gesellschaftsfremdes, Randkulturelles, Abweichendes hat die lebenswichtige Funktion der gesellschaftlichen und kulturellen Dynamisierung und, wenn es gut geht, der kreativen Veränderung. Gestern noch als abweichend bekämpftes Verhalten ist heute erwünscht und gefördert. »Dynamische Stabilität« (Capra 1986, S. 362) ist auch hier ein wesentliches Ziel.
Als ein zentrales Element sozialphilosophischer Auseinandersetzung wurde das Verhältnis von Gentilizismus (Kollektivismus) zu Individualismus benannt. Ob die heutige Gesellschaft als »postmodern« deklariert wird oder nicht – eindeutig ist, dass im Prozess der Modernisierung seit der Renaissance ein Übergang von einer gentilizistischen zu einer individualistischen Grundorientierung stattfand und weiter stattfindet, wenn es auch zu Gegenströmungen kommt, die wie kleine Felsen im Fluss der Zeit Wirbel erzeugen, den Fluss oder den Flussverlauf selbst aber kaum verändern. Mit dieser Umorientierung sind je unterschiedliche Formen der Vergesellschaftung, Typen der Moral und Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung verbunden. So kommt es zu einer Schwerpunktverlagerung von einem soziozentrischen zu einem individuum-zentrierten Sozialleben, von der Kollektivverantwortung zur Eigenverantwortung, von der Volksreligion zur privatisierten Religion, vom Gruppeneigentum zum persönlichen Eigentum, von der Bedeutung der »Ehre«, deren Wurzeln gesellschaftliche Werte und institutionalisierte Rollen sind, zur menschlichen »Würde«, deren Träger das Individuum ist. Mit der individualistischen Orientierung mit ihrer ausgeprägten Betonung von Lebenshaltungen, die mit Begriffen wie Emanzipation, Selbstverwirklichung und Autonomie zu umschreiben sind, sind in enger wechselseitiger Abhängigkeit weitere Phänomene verbunden: gesellschaftliche Pluralisierung und soziale Dynamik, globale Interdependenzen und Abhängigkeiten, lebensweltliche Segmentierungen, Urbanisierung, massenmediale Versorgung, Technologisierung und Bürokratisierung … und sozialstaats- bzw. wohlfahrtsstaatliche Absicherungen.
Ralf Dahrendorf hat das Spannungsfeld zwischen individuumorientierter und kollektivorientierter Ausrichtung im Konzept der »Lebenschancen« (1979) differenziert beschrieben. Darunter versteht er die »Möglichkeiten des individuellen Wachstums, der Realisierung von Fähigkeiten, Wünschen und Hoffnungen«, die durch »soziale Bedingungen bereitgestellt« werden (S. 50). Dies sind u. a. das Recht auf freie Ortswahl, das allgemeine Wahlrecht, die infrastrukturelle Versorgung, also allgemeiner die Realisierung der durch das Sozialstaatsprinzip betonten Chancen auf soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit. Nun bestimmt aber Dahrendorf die sozialen Bedingungen für die Lebenschancen näher als Optionen und Ligaturen. Optionen sind die gesellschaftlich eröffneten Wahlmöglichkeiten, die Handlungsalternativen, die strukturell vorgegeben sind. Ligaturen dagegen sind die Zugehörigkeiten, die Bindungen und sozialen Bezüge, die wiederum gesellschaftlich bereitgestellt werden und die der sozialen Position des einzelnen einen verbindlichen Charakter, Sinn und Bedeutung geben und die in Konfliktsituationen unterstützend wirken (primäre Netzwerke wie Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Heimat, religiöse und geschichtliche Bezüge). Formal sind Lebenschancen bei Dahrendorf eine Funktion von Optionen und Ligaturen, sie sind »Gelegenheiten für individuelles Handeln, die sich aus der Wechselwirkung von Optionen und Ligaturen ergeben«. Für moderne Gesellschaften gilt nun, dass die Ligaturen sich quantitativ verringert haben und vor allem aber sich die Bindungsintensität der bestehenden Ligaturen als verbindliche und sinngebende Instanzen stark gelockert hat. Parallel dazu kommt es zu einer erheblichen Ausweitung der Optionen, die häufig nur durch eine Auflösung von Ligaturen möglich wird. Dahrendorf sieht die Gefahr, dass die »Zerstörung von Ligaturen (…) menschliche Lebenschancen bis zu dem Punkt reduziert (hat), an dem selbst Überlebenschancen wieder gefährdet sind« (S. 59). Genau hier setzt Soziale Arbeit an.
Um in dem hier pauschal skizzierten gesellschaftlichen Rahmen die gegebenen Lebenschancen nutzen zu können und den Gefährdungen so weit wie möglich zu entgehen oder die auftretenden Konflikte bewältigen zu können, bedarf es persönlicher und sozialer Kompetenzen, die in familialen und außerfamilialen Lebenswelten in lebenslangen sozialen Prozessen zu erwerben sind. An Formulierungen konkreter Eigenschaften des modernen Menschen, der bestrebt ist, die ermöglichten Chancen seiner Gesellschaft kreativ für sich umzusetzen, die individuellen Freiheiten und Rechte zu beanspruchen und die Werte der Autonomie und Selbstverwirklichung zu realisieren, mangelt es nicht. Die Werbung, Bekanntschafts- und Arbeitsvermittlungsanzeigen, TV-Filme sind voll davon: offen, veränderungswillig, flexibel, dynamisch, spontan, wach, reflexiv, sensibel, empathisch, kooperationsbereit, außengeleitet, mobil … . Hinter diesen anschaulich-oberflächlichen Beschreibungen steht die Annahme, dass die Persönlichkeitsbildung in modernen Gesellschaften nur als ein dynamischer und stets unabgeschlossener Prozess denkbar ist, in dem in einer lebenslangen Interaktion mit anderen die Selbst- und Weltbilder auf unterschiedlichen Ebenen erworben, abgeändert, verworfen und mühsam immer wieder neu aufgebaut werden. Soziale Arbeit ist eines der modernen Steuerungselemente, präventiv, korrigierend und auch kompensierend diese Prozesse individuen- und strukturbezogen zu begleiten, Integration zu fördern, Desintegration und ihre Folgen zu beheben oder zu mildern und die Organisation dieses Arbeitsfeldes zu planen und situationsgerecht zu verändern ( Kap. 4.5.1 und Kap. 8.5.1).