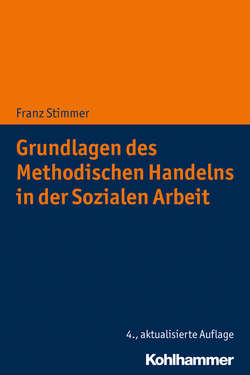Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.6 Verständigungsorientiertes Handeln
ОглавлениеAus den Überlegungen zur Berufs- und Praxisethik und den Versuchen, einen Verhaltenskodex zu entwickeln, lässt sich eine allgemeine Grundhaltung ableiten, die als notwendige Basis allen Handelns in der Sozialen Arbeit gelten muss: die Verständigungsorientierung ( Abb. 6). Diese Haltung ist zugleich Grundlage und Ziel methodischen Handelns. Es geht dabei nicht um den Erwerb eines statischen Faktors, den jemand besitzt oder nicht, sondern um ein dynamisches Bemühen, diese Haltung immer wieder neu anzustreben, Abweichungen wahrzunehmen und immer wieder flexibel in Richtung Verständigung umzugestalten. Diese Haltung ist ein so grundsätzliches Arbeitsprinzip, dass sie für alle Arbeitsfelder, Arbeitsformen, Interaktionsmedien, spezifischen Methoden und Verfahren Geltung beanspruchen darf. Ohne sie hat Soziale Arbeit und methodisches Handeln in ihr keine Daseinsberechtigung. Ihre Realisierung, in welcher äußeren Form auch immer, ist vermutlich auch der zentrale Wirkfaktor für das Gelingen sozialpädagogischer Interventionen. Diese sozialpädagogische Haltung darf aber nicht als überzogene und unrealistisch-idealisierende Schwärmerei formuliert oder gefordert werden. Es handelt sich lediglich um »Idealtypen« (Max Weber) oder »Konstruierte Typen« (Howard Becker), die über wenige Fakten einen Sachverhalt überdeutlich sichtbar machen, während reale Menschen in konkreten Situationen sich diesen Idealtypen immer nur mehr oder weniger annähern, ohne mit ihnen identisch zu werden.
Es geht in der Sozialen Arbeit zuvorderst und zunächst um soziales Handeln mit ganz konkreten Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt, wie viele Facetten ein Problem in den jeweiligen Arbeitsbereichen auch haben mag. »Soziales Handeln« ist nach Max Weber ein Handeln, »welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist« (1976, S. 1). Er erweitert diese Definition um die Wechselseitigkeit des Handelns zwischen Akteuren: »Soziale Beziehung soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen« (S. 13). Eine völlige Übereinstimmung konkreter Beziehungen mit diesen Formulierungen sieht Weber als Grenzfälle, allerdings verliert das Handeln den Charakter einer sozialen Beziehung, wenn »ein Aufeinanderbezogensein des beiderseitigen Handelns tatsächlich fehlt« (S. 14), wobei, und dies ist besonders bedeutsam, im realen Handeln Übergänge nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Das Bemühen um Verständigung ist also ständig bedroht durch Entfremdung, Gegenseitigkeit durch Schein-Gegenseitigkeit (Wynne), Bestätigung durch Pseudobestätigung (Laing), Solidarität durch Täuschungsmanöver (Goffman), kommunikatives Handeln durch strategisches Handeln (Habermas) oder wie dieser Tatbestand im Einzelnen auch bezeichnet werden mag. Es gilt also nicht ein strenges »Entweder-oder«, sondern ein »Sowohl-als-auch«, was sich bildhaft in Form eines Kontinuums darstellen lässt ( Abb. 6), das auf der einen Seite durch »Verständigungsorientierung« und auf der anderen durch »Erfolgsorientierung«, genauer um eine »« oder gar eine »Erfolgsfixierung« begrenzt wird. Handeln in der Sozialen Arbeit ist, erst einmal unter Verkürzung des professionellen Handelns auf den Beziehungsaspekt, auf diesem Kontinuum zugeordnet und in der Reflexion erkennbar, kritisierbar und veränderbar.
Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit hat neben und in Wechselwirkung zu dem Beziehungsaspekt natürlich auch einen Inhaltsaspekt, es geht ja nicht nur um »Beziehungsarbeit« allein, quasi um ihrer selbst willen, sondern immer auch um die Erledigung, die Bewältigung, die Veränderung einer »Sache«. Eine noch so gute Beziehung zwischen einer Sozialpädagogin und einem Elternpaar, das ein Kind in Pflege nehmen will, nützt wenig, wenn nicht auch Inhalte, eingebettet in den Beziehungsprozess, transportiert werden, die manchmal den guten Kontakt vielleicht sogar etwas stören können (Verpflichtungen der Pflegeeltern, Pflegegeld, Besuchsregelungen, Kontrolle durch das Jugendamt, Erziehungsziele usw.). Die Fokussierung auf den Beziehungsaspekt darf die Pflicht zur Sachlichkeit, einschließlich der Forderung nach Verständlichkeit (Schulz von Thun 1998, S. 129 ff.) nicht auslöschen. Darüber hinaus zeigt sich aber auch noch ein weiterer Aspekt, den Watzlawick u. a. in ihren schon klassischen Axiomen menschlicher Kommunikation in diesem Zusammenhang formuliert haben: »Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist« (1996, S. 56). Der Beziehungsaspekt definiert, wie eine Mitteilung zu verstehen ist, er ist daher eine Metakommunikation, eine Mitteilung über eine Mitteilung, oder: »Der Inhaltsaspekt vermittelt die ›Daten‹, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind« (S. 55). Es hängt also von der Mimik, Gestik, Tonlage der Sozialpädagogin ab, wie etwa die Kontrollen des Jugendamts in der Wahrnehmung der Eltern wirksam werden, als unverschämte Einmischung, als kränkender Akt oder als hilfreiche Handreichung für die Eltern zum Wohle des Kindes. In der Sozialen Arbeit geht es also um »Sacharbeit« (Unterstützungswege, Beratungsinhalte, Konfliktlösungen, Erziehungsmöglichkeiten, materielle Zuwendungen …) und deren Gestaltung über die »Beziehungsarbeit« zwischen Professionellen und Klienten, wobei die Qualität der letzteren über den Erfolg bzw. Misserfolg sozialpädagogischer Sacharbeit entscheidet. Formal kann diese Art der Beziehungsgestaltung annähernd als Interdependenzrelation im Sinne der Hypothesenbildung ( Kap. 6.2) verstanden werden.
Die These ist, dass Soziale Arbeit um so erfolgreicher sein wird, je weniger erfolgsfixiert und je ausgeprägter verständigungsorientiert sie ist. Auf dem oben erwähnten Kontinuum steht auf der Seite der Verständigungsorientierung ein Handeln, das inhaltlich den Definitionen sozialen Handelns bzw. sozialer Beziehung von Max Weber entspricht und das mit unterschiedlichen Interaktions-Begriffen belegt ist, wie »Begegnung« (Moreno), »Dialog« (Buber), »Kommunikatives Handeln« (Habermas), »Rapport« (Bandler und Grinder) u. v. a. Diese Begriffe sind nicht synonym zu verwenden, sie haben aber die gleiche Grundrichtung, nämlich die Verständigung als Ziel des Handelns, wobei das, was erreicht werden soll, erst auszuhandeln ist und der Erfolg, nämlich die Zielerreichung, immer auch ein gemeinsamer Akt von Klient und Fachkraft bleibt. Wenn ein Alkoholabhängiger nach einem wiederholten »Rückfall« in die Beratung kommt, geht es nach diesem Modell zunächst um Verständigung. Die Haltung des Beraters sollte, das hat Rogers sehr eindeutig nachgewiesen, durch Wertschätzung, Empathie und ( Kap. 9.2.1.3) geprägt sein, um überhaupt auf die Ebene der Verständigung zu kommen. Die Sachargumente wie Entgiftung, ambulante Therapie, Selbsthilfegruppenbesuch kennt der Alkoholabhängige häufig aus eigener Erfahrung mindestens genauso gut wie der professionelle Berater. Diese Angebote allein bleiben letztlich folgenlos. Bietet der Berater dem Klienten aber z. B. an, als eine Wahlmöglichkeit neben den anderen Vorschlägen, weiter zu trinken, ist dies, wenn die Beziehungsgestaltung diesen Vorschlag nicht als Zynismus entlarvt und wenn es dem Bedürfnis des Klienten entspricht, eine verständigungsorientierte Lösung, die u. U. über kurz oder lang zum Erfolg führt. Die Wirksamkeit solcher paradoxen Aufforderungen, der »Symptomverschreibungen« sind bekannt (Watzlawick u. a. 1996, S. 213 ff.). Sie dürfen hier aber nur ernst gemeintes und verantwortetes Ergebnis einer Verständigung sein und nicht die Anwendung einer wirksamen Technik.
In dem eben beschriebenen Fall ist die Verführung natürlich groß, über ein immer noch »Mehr-desselben« (Watzlawick u. a. 1974, S. 51 ff.; Angebote über Angebote, die in Richtung Abstinenz gehen) oder über Drohungen oder geschickte Manipulation einen kurzfristigen »Erfolg« zu erzielen, also offen oder verdeckt erfolgsorientiert (oder besser erfolgszentriert oder erfolgsfixiert) zu handeln. Bei diesem strategischen Handeln geht es um die strikte Realisierung vorgegebener Ziele und Erfolgsparameter, wie immer auch diese bestimmt werden (durch Fachkraft, Einrichtung, Gesellschaft …). Das ist die andere Seite des Kontinuums, das Feld der Strategien und Täuschungsmanöver, die nicht unbedingt bösartig sein müssen, sondern vielfach auch »gut gemeint« sein können, wobei die Handlungsziele aber eben nicht gemeinsam erarbeitet wurden, sondern nach dem Willen, den Bedürfnissen, den Wünschen des Beraters vorgegeben sind.
Die Abbildung 6, eine Differenzierung und Transformation des Handlungsmodells von Habermas (1981, S. 446), verdeutlicht das Kontinuum noch einmal schematisch.
Abb. 6: Kontinuum des Handelns zwischen Verständigungsorientierung und Erfolgszentrierung (nach Habermas 1981, S. 446)
Beim verständigungsorientierten Handeln geht es primär um die Beziehungsgestaltung, der Erfolg entsteht aus dieser heraus; beim erfolgszentrierten Handeln steht die Wirkung im Mittelpunkt, deren Verfolgung handlungsleitend ist. Verständigungsorientiertes Handeln ist immer zwei- oder mehrseitig, erfolgszentriertes Handeln dagegen kann einseitig, zwei- oder auch mehrseitig sein. Wenn es »offen« ist, ergibt sich daraus ein Zwangssystem oder auch eine Hierarchie oder aber, wenn mehrere gleichzeitig bei unterschiedlichen Zielen erfolgszentriert sind, eine kämpferische Auseinandersetzung. Manipulative Versuche verlaufen gewöhnlich in der Form, dass einer manipuliert, der andere manipuliert wird. Wenn zwei oder mehrere versuchen, sich gegenseitig zu manipulieren, wird das System schon sehr komplex, Sieger bleibt vermutlich der, der die besseren Strategien anwenden kann. Solche Manipulationen können den manipulierenden Akteuren bewusst sein, den Manipulierten allerdings unbewusst. Falls sie letztlich allen Beteiligten unbewusst sind, kommt es zu Formen verzerrter Kommunikation. Die Strategien sind teilweise die gleichen, teilweise aber unterschiedlich. Doppelbindungen (Bateson) laufen meist unbewusst ab, denkbar ist allerdings, sie bewusst als Möglichkeit zu nutzen, andere zu manipulieren oder verrückt zu machen.
Dieses Schema ist kein normatives Konzept oder Gesetz, an dem das Handeln von SozialpädagogInnen über Aussagen von »gut oder schlecht« oder »wahr oder falsch« gemessen werden soll, es bietet aber ein idealtypisches Orientierungsraster, das dabei hilft, konkretes Handeln immer wieder zu überprüfen und zu reflektieren und es – u. U. erst über kollegiale Beratung oder auch Supervision – wieder zu ändern. Je nach Situation, je nach Problem, je nach den beteiligten Personen wird der Ort des Handelns auf dem Kontinuum unterschiedlich sein. Das gegenseitig Aufeinander-bezogen-Sein im verständigungsorientierten Handeln ist stets gefährdet, es ist, wie Goffman dies ausdrückt, »zerbrechlich, es ist mit konstitutiven Schwächen und Gefährdungen behaftet, ein prekärer, unsteter Zustand, der die ständige Möglichkeit von Entfremdung«, wie sie sich im einseitig erfolgszentrierten Handeln ausdrückt, »in sich birgt« (1971, S. 128). Bezogen auf die Berufsethik Sozialer Arbeit hieße dies, dass eine Gesinnungsethik, die unabhängig vom Erfolg sich dialogisch verausgabt, genauso unangemessen ist wie eine Erfolgsethik, die entfremdetes Handeln um des Erfolges willen in Kauf nimmt. Die Lösung kann nur eine Verantwortungsethik sein, die sich des Handelns zwischen den beiden Polen bewusst ist, die Spannung »dazwischen« erträgt und zu einer konstruktiven Gestaltung des Handelns nutzt ( Kap. 4.4.2).
In diesem Kapitel wurden bedeutsame Aspekte der Grundlagen methodischen Handelns diskutiert. Das Fundament methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit wird aber durch deren Ethik gesetzt und nicht durch psychologische Kommunikationstheorien oder soziologische Gesellschaftmodelle oder pädagogische Konzepte, so wichtig und im Einzelnen auch handlungsleitend deren Kenntnis, Reflexion und pragmatische Umsetzung auch sind.