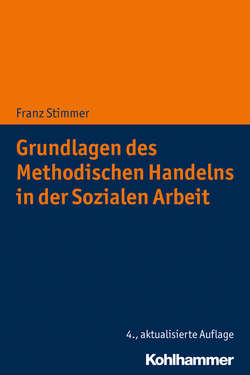Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.4.2 Berufsethik – Praxisethik
ОглавлениеSoziale Arbeit hat ihr Aufgabenfeld im sozialstaatlichen Rahmen mit seinen sozialpolitischen und sozialrechtlichen Ausformungen unter Einbeziehung weiterer spezieller Vorgaben wie durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG bzw. SGB VIII) zu gestalten, wozu eine ausreichende inhaltlich-sachliche Kompetenz und Beziehungskompetenz ( Kap. 11) ihrer Fachkräfte ( Kap. 4.5.3) zu fordern ist. Die Basis dieser Kompetenzen bildet der Bereich, der mit den Begriffen Anthropologie, Sozialphilosophie und Ethik umschrieben wurde. Die dazu formulierten Aussagen werden jetzt mit dem Ziel wieder aufgegriffen, einige Aspekte einer Berufsethik Sozialer Arbeit und damit einer Ethik methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit zu benennen.
Zentral ist die normative (präskriptive) Ethik, über die konkretes Handeln hinterfragt, begründet, systematisiert und danach beurteilt werden kann, ob die ethischen Prinzipien dabei erfüllt werden (moralisches Handeln) oder nicht. Ethik wird so zum Maßstab auch für methodisches Handeln. Darüber hinaus hat Ethik noch eine allgemeinere Funktion, nämlich eine Begründung für die Legitimation Sozialer Arbeit überhaupt zu liefern (Sozialphilosophie) oder auch Fragen zu klären, inwiefern bestimmte und scheinbar selbstverständliche Vorstellungen der Sozialen Arbeit wie Emanzipation oder Autonomie oder das Recht auf freie Meinungsäußerung Allgemeingültigkeit beanspruchen können oder auch inwiefern anscheinend universell anerkannte Leitsätze wie das Selbstbestimmungsrecht in spezifischen Bereichen Sozialer Arbeit unhinterfragt übernommen werden dürfen, etwa bei der Sterbehilfe oder bei Suizidankündigungen. Dies alles sind Inhalte einer sozialpädagogischen Berufsethik, so dass der Bereich, um den es hier ganz speziell geht, nämlich die Beziehung zwischen den Fachkräften und den KlientInnen der Sozialen Arbeit ( Kap. 4.5.4) besser als Praxisethik bezeichnet werden kann, wobei die Beziehungsgestaltung jeweils ethisch zu rechtfertigen ist.
Dass die Praxisethik der Sozialen Arbeit als reine Erfolgsethik zu kurz greift, leuchtet ein, selbst wenn dies im Gefolge eines Evaluierungsdrucks – möglichst erfolgreich sein zu müssen, um weiter Gelder zu erhalten – oder auch einer »Ökonomisierung« sozialpädagogischen Vokabulars, was sich dann in Begriffen wie Leistungs- und Kundenorientierung ausdrückt, manchmal auch anders erscheint. Eine Praxisethik Sozialer Arbeit kann auch keine monologische, einseitige (Gesinnungs-)Ethik sein, sondern ist nur als dialogische, zwei- oder mehrseitige (Verantwortungs-)Ethik vorstellbar.
In Weiterführung der Gedanken Max Webers, der den modernen ethischen Lebensstil in einer Verbindung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik sieht (1964, S. 70), hat Schluchter diese Lebensstile weiter differenziert (1980, S. 37):
Bei der Gesinnungsethik steht die moralische Angemessenheit einer Handlung über ihren Erfolg (Metapher: »Kompass« – »Norden« gibt die Richtung ohne wenn und aber vor): »Alkoholismus ist eine Sünde, deshalb müssen alle Alkoholiker erst zu Gott finden.« Die Durchsetzung der – wie auch immer begründeten – Vorstellung eines »guten« und »gerechten« Lebens steht hier im Vordergrund. Die tatsächlichen Folgen einer Handlung – z. B. weiterer Drogenkonsum – sind dabei bedeutungslos für ihre Beurteilung.
Bei der Anpassungsethik steht der Erfolg einer Handlung über ihrer moralischen Angemessenheit (Metapher: »Computer« – Gute Programme führen immer zum Erfolg): »Es ist bewiesen, dass Antabus bei Alkoholikern bezüglich der Abstinenz wirksam ist, also wenden wir es an.« Das Erreichen eines (vom Professionellen) definierten Ziels mit allen Mitteln ist hier vorrangig (»Gut ist was nützt!«). Antabus (Disulfiram) ist ein Medikament, das bei einem gleichzeitigen Konsum von Alkohol Unverträglichkeitsreaktionen auslöst, die zu Übelkeit, Kopfschmerzen etc. führen und über diesen Mechanismus Alkoholiker abhalten sollen, zu trinken oder weiter zu trinken. Allerdings sind schwerwiegende Folgen bis zum Herzinfarkt und Tod nicht auszuschließen.
Sowohl Gesinnungs- wie auch Anpassungsethik schleichen sich im Alltag wie in der Praxis der Sozialen Arbeit unter dem gegebenen Entscheidungs- und Handlungsdruck manchmal doch ein, problematisch wird es allerdings, wenn sie unreflektiert und dauerhaft praktisches Handeln steuern.
Als Lösung bietet sich die Verantwortungsethik an (Schluchter 1980, S. 40). Bei ihr (Metapher: »Wasserwaage« – ein Instrument des vorsichtig ausgleichenden Abwägens und Austarierens) wird versucht zwischen moralischer Angemessenheit und dem Erfolg einer Handlung in Berücksichtigung vorgegebener Bedingungen einen (spannungsreichen) Ausgleich herzustellen: »Abstinenz bei Alkoholikern ist grundsätzlich ein wichtiges Ziel, aber unter bestimmten Umständen reicht es zunächst, wenn Alkoholiker weniger trinken, um sie nicht zu überfordern, auch auf die Gefahr hin, dass dadurch über den ›Kontrollverlust‹ ein schädigendes unmäßiges Trinken provoziert wird.« Das – vielleicht auch unvollkommene und zeitlich begrenzte – Erreichen eines im Dialog zwischen KlientInnen und Professionellen ausgehandelten (Teil-)Ziels ist hier maßgebend, ohne jedoch, dass die Fachkraft sich der Verantwortung für ihr Handeln entziehen könnte.
Während die Gesinnungsethik über die Ablehnung situationsspezifischer Gegebenheiten (»Weltflucht«) und die Anpassungsethik über die Angleichung an normierte Vorgaben (»Weltanpassung«) die Träger dieser Ethiken aus diesem Spannungsverhältnis herausnimmt, ist es allein die Verantwortungsethik im definierten Sinne, die die Probleme der modernen Welt und die Probleme Sozialer Arbeit in ihr bewältigbarer erscheinen lässt. Erst dieser ethische Lebensstil führt zur Weltbewältigung (»Weltbeherrschung«), deren »subjektives Korrelat Selbstbeherrschung gegenüber den eigenen und den fremden Göttern« ist (Schluchter 1980, S. 40). Die Bewältigung von Problemen in der Praxis Sozialer Arbeit hat unter der Prämisse der Verantwortungsethik die Selbstbestimmung der Klienten zum Ziel und die Selbstbestimmung der Professionellen zur Voraussetzung.
Brumlik (2004) hat in der »advokatorischen Ethik « eine für die Soziale Arbeit grundlegende Variante einer Verantwortungsethik entwickelt, die erfordert, dass Professionelle die Interessen von Menschen vormundschaftlich vertreten, die dies – wie nicht selten in der Sozialen Arbeit – situations- oder zeitgebunden oder vielleicht auch überhaupt nicht selbst vermögen. Neben dem vormundschaftlichen Handeln ist in vielen Situationen eine Bemündigung über verständigungsorientiertes Handeln ( Kap. 4.6) unter Anerkennung und Förderung der Ressourcen und Kompetenzen der KlientInnen möglich und dringend notwendig. Mündigkeit wird also nicht vorausgesetzt und die Würde des Menschen schon gar nicht an seine Mündigkeit gekoppelt. Unter Berücksichtigung gegebener Bedingungen wird in der advokatorischen Ethik das Ziel formuliert, die gleichberechtigten und in einem fragilen Gleichgewicht zueinanderstehenden Prinzipien der Bemündigung und der zu schützenden Integrität von Menschen zugleich zu verfolgen. Aus welchen Gründen auch immer Menschen (situationsspezifisch oder allgemeiner) unmündig geworden sind, sie sollen wieder mündig(er) werden, wobei in diesem Bemündigungsprozess ihre körperliche und geistige Integrität absolut schutzwürdig bleibt. Dies ist ein schwieriges und spannungsreiches Unternehmen, das professionell in methodischem Handeln in der Sozialen Arbeit zu verantworten ist. Dabei muss aber auch berücksichtigt werden, dass die Grundidee der advokatorischen Ethik nicht nur in Richtung der Klienten Gültigkeit besitzt, sondern natürlich auch für die Professionellen der Sozialen Arbeit gilt. Auch sie bedürfen immer wieder der Bemündigung unter Aufrechterhaltung ihrer Integrität etwa in Teamprozessen, in der Supervision oder auch in einer Therapie. Dies sind notwendige Voraussetzungen, um den Anforderungen moderner professioneller Sozialer Arbeit angemessen gerecht zu werden.
Wenn es in der Sozialen Arbeit in Deutschland bislang auch noch keinen allgemein verbindlichen Verhaltenskodex und entsprechende ethische Begründungen gibt, so lassen sich einige Leitsätze zu einer Berufsethik bzw. Praxisethik benennen:
• Allgemeine Grundlage für jegliches Handeln in der Sozialen Arbeit sind das Grundgesetz und die Menschenrechte ( Kap. 4.4.3).
• Berufs- bzw. Praxisethik in der Sozialen Arbeit ist normative Ethik in der Ausprägung der Verantwortungsethik. Handeln in der Sozialen Arbeit
− muss verständigungsorientiert, also dialogisch-partnerschaftlich sein ( Kap. 4.6) und schließt daher strategische Handlungen (Zwang, Manipulation, Täuschung) sowie Verletzungen der Integrität der KlientInnen wie auch der KollegInnen aus;
− ist durch unbedingte Wertschätzung (Rogers) und Achtung dem Klienten gegenüber gekennzeichnet;
− ist parteilich – sie kann nicht neutral sein – sowie auch wertend und Stellung beziehend allerdings unter möglichster Berücksichtigung aller Beteiligten;
− zielt auf größtmögliche Autonomie und Selbstverantwortung der KlientInnen und ist
− durch eine »streitbare Toleranz« (Schlüter 2000, S. 211) ausgezeichnet, durch »die Bereitschaft zu vernünftig-argumentativer Auseinandersetzung um die richtigen Werte mit der Offenheit, auch die eigenen Überzeugungen fortzuentwickeln«.
• Die »streitbare Toleranz« geht sozialethisch in Richtung der Diskursethik (Habermas 1999), die gerade für Diskussionen in den Berufsverbänden um einen Ethik-Code richtungsweisend, wenn auch schwierig umsetzbar ist. Ein herrschaftsfreier Diskurs ist ja die Voraussetzung in deren Rahmen es gelingen könnte, »Konflikte – unter der Annahme der Gleichberechtigung – in Diskussionen zwischen den GesprächsteilnehmerInnen« zu lösen, »wobei die Ergebnisse und Nebenfolgen von allen zwanglos akzeptiert werden müssen« (Stimmer 2010, S. 159). Das Gegenmodell wäre die individualistische Ethik, in deren Zentrum »egozentrische Bewußtseinstrukturen und versachlichte Beziehungsmuster« vorherrschen, denen »eine gegenseitige Bestätigung im kommunikativen Handeln fremd ist« (Stimmer 1987, S. 159).
• Die Handlungsmaximen der Sozialen Arbeit müssen allen Beteiligten und Betroffenen gegenüber zu rechtfertigen sein. Dazu gehört auch das immer wieder neue aktive Bemühen um eine Praxisethik mit der nicht immer leichten Aufgabe der Reflexion der eigenen Menschenbilder und sozialphilosophischen Vorstellungen, aber auch der Anerkenntnis des unterschiedlichen Werteverständnisses der Beteiligten des jeweiligen Handelns.
Neben diesen Leitlinien gibt es auch Bemühungen, ethische Grundlagen zu formalisieren und zwar von den internationalen Berufsverbänden – International Association of Schools of Social Work (IASSW) und International Federation of Social Workers (IFSW) – sowie auch vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. (DBSH), einem der Trägerorganisationen der IFSW. Der Anteil der im DBSH – als berufsständische Vertretung – organisierten Fachkräfte ist mit ca. 6000 Mitglieder (Stand 2010) allerdings relativ gering.
Die IFSW hat 1994 auf ihrem Weltdelegiertentreffen in Colombo »Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit-Prinzipien und Standards« verabschiedet. Dieses Grundsatzpapier ist die Basis für die »Berufsethischen Prinzipien« des DBSH die dieser 1997 für alle Mitglieder verpflichtend auf der Bundesmitgliederversammlung in Göttingen beschlossen hat. Neben der Bekenntnis zu den Prinzipien der Menschenrechte und Menschenwürde sowie zur Sozialen Gerechtigkeit wurden Regeln für das berufliche Verhalten entwickelt: »Allgemeine Grundsätze beruflichen Handelns«, »Verhalten gegenüber Klientel«, »Verhalten gegenüber Berufskolleginnen und Berufskollegen«, »Verhalten gegenüber Angehörigen anderer Berufe«, »Verhalten gegenüber Arbeitgeber/innen und Organisationen« und »Verhalten in der Öffentlichkeit«. Eine Ethikkommission hat die Aufgaben einer kontinuierlichen Revision und Aktualisierung dieser Prinzipien sowie der Erarbeitung konkreter Verfahrensregeln. Über diese Moral-Kodizes oder Verhaltenskodizes soll das Handeln der Fachkräfte richtungsweisend geordnet, gerechtfertigt und legitimiert werden. Diese Normen (Soll- und Musserwartungen (Dahrendorf)) sind aus allgemein-ethischen Grundsätzen (Menschenrechte, Würde der Person, Solidarität, soziale Gerechtigkeit…) abgeleitet und berufsspezifisch formuliert, ohne allerdings, dass sie differenziert begründet und reflektiert werden (Schneider 2006 S. 11 f.).
Was aber tun, wenn die Normen des Berufs-Kodex des DBSH bei einem moralischen Problem nicht weiterhelfen? Hier wird auch die u. U. schwierige Beziehung zwischen Gesetzesnormen, berufsspezifischen Normen und ethischen Grundsätzen deutlich. Punkt 3.6 des Kodex des DBSH beschreibt beispielsweise die Schweigepflicht: Fachkräfte »… sind verpflichtet, anvertraute persönliche Daten geheim zu halten. Sie geben diese Daten nur weiter, wenn sie aus gesetzlichen Gründen offenbart werden müssen.« Die Schweigepflicht ist mit § 203 StGB gesetzlich geschützt, gleichzeitig existiert aber u. U. eine Anzeigepflicht (§ 138 StGB) ( Kap. 7.3) Riskiert eine Fachkraft hier eine Geld- oder Gefängnisstrafe, wenn sie gegen eine eventuelle Anzeigepflicht verstößt oder riskiert sie einen eklatanten Vertrauensbruch? Kann ihr denn die weitere Verpflichtung nach 3.6 für ihre Entscheidung helfen, die wie folgt lautet: »Personen, deren Daten weitergegeben werden, sind darüber zu informieren.« Wird der Vertrauensbruch dadurch egalisiert? Das folgende Beispiel (ausführlich s. Kuhrauh-Neumärker 2005, S. 145 ff.) zeigt die Komplexität eines solchen Dilemmas:
Eine Fachkraft in der Drogenberatungsstelle erfährt von einem HIV-positiven Klienten, der erfolgreich am Methadonprogramm teilnimmt, dass er nun die Frau seines Lebens kennen gelernt hat, dass er sie schon seinen Eltern vorgestellt hat und dass er einfach glücklich ist. Über das Thema HIV-positiv spricht er in der Beratung nicht (»Ich komm damit zurecht«), genau so wenig auch mit seiner Freundin, mit der er bisher mit Kondom schläft. Seine Freundin will aber darauf verzichten und demnächst die Pille nehmen, und er findet das auch in Ordnung. Die Fachkraft kennt die Freundin des Klienten aus einem anderen Zusammenhang her flüchtig.
Wenn die Fachkraft die Freundin aufklärt, verstößt sie gegen die Verschwiegenheitspflicht, die ihr vom Gesetz, aber auch von ihrer Einrichtung und ihrem Berufsethos abverlangt wird. Sie riskiert damit auch u. U. sogar eine Entlassung. Wenn sie der Freundin nichts sagt, riskiert sie, dass diese und eventuell auch ihre Kinder an Aids sterben. Vielleicht, was zu überprüfen wäre, verstößt sie auch gegen die Anzeigepflicht. Was kann, was soll, was muss sie tun?
Moralische Kodizes allein helfen hier für eine Entscheidung kaum weiter. Anders dagegen – zumindest als Chance – die Reflexion der oben beschriebenen Leitsätze und vor allem die der Ethik-Modelle, um gegenüber den Betroffenen und sich selbst gegenüber verantwortungsbewusst handeln zu können. Hilfreich für die Klärung eines solch schwierigen Prozesses, für den es keine einfache Lösung geben wird und für eine Entscheidungsfindung sind sicher diskussionsbereite KollegInnen und die Supervision ( Kap. 10.2) sowie die Stärkung der Selbstkompetenz ( Kap. 11), auch über die Weiterbildung der eigenen professionellen Fähigkeiten.