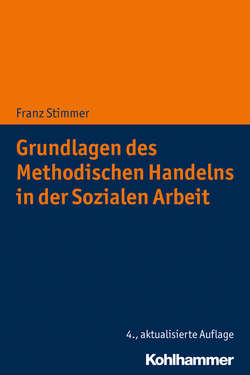Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.4.3 Grundgesetz und Sozialrecht
ОглавлениеIm Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) sind die rechtlichen Rahmenbedingungen formuliert, die grundsätzlich für alle BürgerInnen gelten.
Im Artikel 1 GG sind die höchsten Rechtsgüter und gleichzeitig die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte verankert:
»(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.«
In den Artikeln 2–4 sind weitere besonders bedeutsame Grundrechte geschützt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit; Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2), Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Benachteiligungs- bzw. Bevorzugungsverbot u. a. bezüglich Geschlecht, Abstammung, Sprache, Glauben, politische Anschauung, Behinderung (Art. 3), Glaubens und Gewissensfreiheit (Art. 4). Der Art. 6 (Ehe – Familie – Kinder) hebt die besondere schützenswerte Bedeutung der Ehe- und Familie hervor sowie auch den Schutz von Kindern bei einem Versagen der Erziehungsberechtigten zum Nachteil der Kinder (vgl. SGB VIII).
SozialpädagogInnen unterliegen, wie alle Bundesbürger auch, der Rechtsordnung des Grundgesetzes, haben aber eine besondere Verpflichtung, als Fachkräfte der Sozialen Arbeit diese Rechtsgüter – deren Verletzung eine der Grundlagen für die Soziale Arbeit ist – zu schützen und darüber hinaus, die Menschenrechte weltweit einzufordern. Wenn Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession proklamiert wird (Staub-Bernasconi 2000), dann hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 für das Werteverständnis der Sozialen Arbeit höchste Priorität und kann als idealtypische Richtschnur für das Handeln der Fachkräfte dieser Profession Geltung beanspruchen. Werte, wie die im Grundgesetz verankerten und explizit oder implizit in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erwähnten, finden ihren Niederschlag auch internationalen Berufsverbänden – International Association of Schools of Social Work (IASSW) und International Federation of Social Workers (IFSW) – sowie auch im Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH), einem der Trägerorganisationen der IFSW.
Im Grundgesetz sind zwei für die Soziale Arbeit wesentliche Verfassungsprinzipien festgelegt: das Rechtsstaatsprinzip und das Sozialstaatsprinzip.
Aus dem Rechtstaatsprinzip (Art. 28 Abs.1 GG) ist u. a. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abzuleiten. Über das Verhältnismäßigkeitsprinzip sind Bürger vor übermäßigen staatlichen Eingriffen in ihre Grundrechte geschützt. Dies betrifft vor allem auch die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG). Auch sozialpädagogische Interventionen müssen daher rechtmäßig, geeignet, notwendig und angemessen sein, was in manchen Fällen – angeordnete Beratung, Zwangskontexte (Kähler 2005), Klinikeinweisungen – nicht nur rechtliche sondern auch erhebliche ethische Fragen aufwirft, z. B. Handeln gegen rechtliche Vorschriften aber zum vermuteten momentanen Wohl des Klienten (z. B. Verschaffen von Drogen für einen Klienten mit ausgeprägten Entzugserscheinungen).
Über das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) hat der Gesetzgeber verpflichtend dafür Sorge zu tragen, dass über die Legislative soziale Verhältnisse und eine gerechte soziale Ordnung gewährleistet sind. Im Sozialgesetzbuch (SGB) sind für die Soziale Arbeit ganz wesentliche Vorschriften verankert, vor allem zu »Soziale Förderungssysteme« und »soziale Hilfesysteme« (Kievel u. a. 2010, S. 242), also besonders, als Kernbereich für die Soziale Arbeit, die Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII; auch noch teilweise als Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) bezeichnet) sowie die Sozialhilfe (SGB XII). § 1 SGB I macht den Umfang und die Aufgaben des Sozialrechts deutlich:
(1) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen. (2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.
Zur Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII siehe ausführlich Kapitel 8.4.2 ( Kap. 8.4.2).
Spezielle berufsrechtliche Aspekte in der Praxis der Sozialen Arbeit werden im Kapitel 7.3 behandelt: Schweigepflicht, Anzeigepflicht, Zeugnisverweigerungsrecht und Schadenersatzpflicht ( Kap. 4.3 und Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 2011).