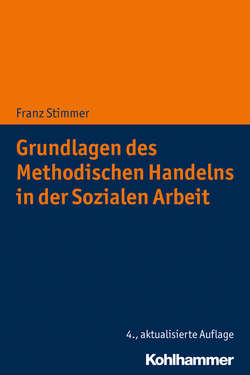Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Basis Methodischen Handelns 4.1 Anthropologie und Sozialphilosophie
ОглавлениеDie Anthropologie beschäftigt sich von unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln (Philosophie, Biologie, Soziologie, Pädagogik …) her mit der Frage »Was ist der Mensch?«. Aber nicht nur Wissenschaftler, sondern jeder Mensch hat, bewusst oder unbewusst, reflektiert oder unreflektiert, ein Bild von sich und den Mitmenschen. Meist begleiten uns diese Bilder diffus, werden aber zumindest als Fragestellung in problematischen Lebenssituationen konturierter, oft drängend und manchmal auch quälend deutlich. Umbruchsituationen wie der Gang in die Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit, aber auch normierte lebensaltersspezifische Übergänge wie die von der Jugend ins Erwachsenenalter oder von diesem in das Rentenalter ziehen, wenn sie nicht verdrängt werden, Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach dem Menschsein nach sich. Zumindest eine »Kryptoanthropologie« (Lassahn 2000, S. 474) ist in allem menschlichen Denken und Handeln nachweisbar. Hinter den verschiedenen Schulen der Sozialen Arbeit und den damit verbundenen Theorieansätzen (geisteswissenschaftlich-hermeneutisch, kritisch-emanzipatorisch, marxistisch-leninistisch, kritisch-rationalistisch, alltagsorientiert …) lassen sich unterschiedliche Auffassungen vom Wesen des Menschseins finden, die mehr oder weniger explizit formuliert werden. Je nachdem, wie die Bilder vom Menschen sich abzeichnen, werden Theorieentwürfe, Handlungsleitende Konzepte und Handlungsstrategien gestaltet sein, manchmal entgegen jeglicher empirisch möglichen Einsicht. Wer der Meinung ist, alte Menschen möchten am liebsten in Ruhe gelassen werden, und wer weiter davon überzeugt ist, dass im Alter die körperlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten zwangsläufig abnehmen, wird vielleicht ein Anhänger der »Dis-engagementtheorie« und wird sich als Sohn oder als jüngere Ehefrau oder als Sozialpädagoge in seinem Verhalten entsprechend darauf einstellen und die Meinung vertreten, dass »die Alten« am besten in Ruhe gelassen werden sollen, weil dies ihrem natürlichen Sein entspricht. Sozialpädagogisch würde sich dann das Interaktionsmedium »Betreuung« anbieten, andere Medien wie »Bildung« oder »(Freizeit-) Beratung« wären kontraindiziert.
Menschenbilder, das war die Annahme, bilden die wesentliche Grundlage für Ethik und Moral. Die Sozialphilosophie erweitert oder – besser vielleicht – fokussiert den Blickwinkel. Sie setzt auf den Menschen als soziales und damit immer auch kulturell und gesellschaftlich mitbestimmtes Wesen, was in den sozialphilosophischen Modellen immer auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Gentilizismus (Kollektivismus) vs. Individualismus beinhaltet. Daran schließt sich die zentrale Frage nach der gerechten Gesellschaft und den sie prägenden Werten und Normen an. So bildet die normative Sozialphilosophie den Kern einer normativen Ethik. Schlüter (2000, S. 683) hat die Aufgabe der Sozialphilosophie prägnant definiert: Sie »hat – ausgehend vom empirischen Befund – die Aufgabe, die Sozialgebilde der Gesellschaft analytisch-kritisch im Hinblick auf die implizierten Axiome, die methodischen Voraussetzungen und die praktischen Handlungskonsequenzen zu reflektieren und konstruktiv-projektiv ihre Umgestaltung vorzudenken. Kriterium für Kritik und Konstrukt ist eine Idee vom Wesen des Menschen und seiner gesellschaftlichen Grundverfasstheit – ein Entwurf, der seinerseits stets der Kritik und Neukonstruktion unterworfen bleibt«. Hier läge eine Möglichkeit, dem viel beklagten Defizit der Theorien Sozialer Arbeit durch Aufnahme sozialphilosophischer Ideen und deren konsequenten Weiterentwicklung unter Einbeziehung sozialpädagogischer Problematiken entgegenzuwirken. Soziale Arbeit als Menschen- und Sozialrechtsprofession (Staub-Bernasconi 2000b) ist in der Sozialphilosophie begründet, aus der heraus sich auch bestimmende Rollenbilder Professioneller der Sozialen Arbeit ableiten lassen, z. B. Anwalt, Vertreter, Unterstützer derjenigen zu sein, die an der Einlösung ihrer Sozialrechte (Rechte auf Bildung, Ausbildung, Arbeit, soziale Sicherheit …) gehindert sind, oder »Normalisierungs-Intervenierer« zu sein mit dem Ziel, über professionelle Interaktionsmedien (Beratung, psycho-soziale Therapie, Erziehung …) im Rahmen ökonomischer und rechtlicher Rahmenbedingungen Autonomie, Selbstverantwortung und Selbstvertretung zu fördern.