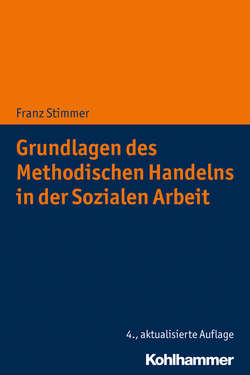Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.1 Person-in-Environment-System (PIE)
ОглавлениеDas PIE zur Einschätzung der Situation von Klienten wurde als mehrperspektivisches Klassifikationssystem in den USA entwickelt (Karls/Wandrei 1994). In den Grundzügen kann das PIE sicher auf deutsche Verhältnisse angewendet werden, eine differenzierte und kritische Transformation steht allerdings noch weitgehend aus.
Das PIE ist ein ganzheitliches System für die Situationsanalyse, das soziale, körperliche und psychische Faktoren umfasst. In der Sozialen Arbeit dient es vorwiegend als Instrument der Beschreibung, der Klassifizierung und Aufzeichnung der sozialen Funktionen und damit verbunden der Lebenswelt des Klienten, wie dieser sie präsentiert. Diese Daten können dann in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit, auch verbunden mit körperlichen und psychischen Faktoren, ein Gesamtbild der Situation ergeben. Dabei werden sowohl Probleme als auch Ressourcen und Copingstrategien ( Kap. 8.1.1) erhoben und daraus mögliche Interventionen abgeleitet. PIE ist, über unterschiedliche Arbeitsfelder, Settings und theoretische Orientierungen hinweg, ein allgemein anwendbares Werkzeug für die Situationsanalyse und Interventionsplanung (Karls/Wandrei 1994, S. VII). Die Beschreibung der Klienten bildet die Grundlage für mögliche Interventionen und erleichtert es dem Professionellen zu entscheiden, ob überhaupt eine Intervention angebracht ist, ob sie vorwiegend auf der individuellen Ebene oder auf der Lebensweltebene oder auf beiden Ebenen sinnvoll ist.
Grundlagen für das PIE sind Probleme in den sozialen Rollen und soziale Probleme in der Lebenswelt der Klienten. Psychische und Verhaltensauffälligkeiten sowie körperliche Erkrankungen werden ergänzend durch entsprechende Fachleute aus der Psychologie und Medizin, seltener durch entsprechend ausgebildete Sozialpädagogen erhoben. So ergeben sich vier Faktoren im PIE-System, wobei die ersten beiden für die Soziale Arbeit zentral sind:
1. Probleme in sozialen Rollen: Typ, Schweregrad, Dauer, Coping-Fähigkeiten (Faktor I)
2. Lebensweltprobleme: Schweregrad, Dauer (Faktor II)
3. Psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten (Faktor III)
4. Körperliche Probleme (Faktor IV).
In einem ausführlichen und differenzierten klientenzentrierten Gespräch ( Kap. 9.2.1) und den entsprechenden Aufzeichnungen werden in den einzelnen Bereichen Daten erhoben und kodiert. Die Abbildungen 7 und 8 aus einem »Mini-PIE« (Karls/Wandrei 1994, S. 49 ff.) sind Beispiele für Erhebungsbögen. Die kompetente Durchführung einer Situationsanalyse nach dem PIE-System bedarf allerdings einer gediegenen Einführung und eines ausführlichen, kontrollierten Trainings mit diesem Instrument, soll nicht nur eine Check-Liste abgehakt werden, was gegen alle ethischen Grundsätze ( Kap. 4.4) der Sozialen Arbeit verstoßen würde.
Im Einzelnen sind die folgenden Inhalte (Faktoren I und II) Gegenstand der PIE-Analyse:
1. Probleme in sozialen Rollen (Faktor I):
− Familiale Rollen (Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Ehepartner usw.),
− interpersonale Rollen (Freund, Freundin, Nachbar usw.),
− berufliche Rollen (Arbeiter, Angestellter, Student, Lehrer usw.) und
− Rollen in spezifischen Lebenssituationen (Patient, Prüfungskandidat, Einwanderer).
Dabei sind nach Karls/Wandrei (1994, S. 49) für die Aufzeichnung die folgenden Teilschritte notwendig ( Abb. 7):
− Alle gegenwärtig problematischen sozialen Beziehungen sind zu erheben und, wenn es mehr als eine ist, in eine Rangfolge zu bringen.
− Für jedes Problem ist der vorrangige Typ zuzuordnen. Wenn z. B. die Klientin ihren Mann durch Tod verloren hat, ist es ein Problem der Ehepartnerrolle (spousal role problem) vom Typ Verlust (loss) und ist mit den entsprechenden Kodierungsnummern aufzuzeichnen.
− Für jedes Problem ist der Schweregrad zu benennen von 2 = gering bis 6 = katastrophal oder eben auch 1 = kein Problem.
− Für jedes Problem ist die Zeitdauer auszuweisen, von 1 = 5 Jahre und mehr bis 6 = erst seit kurzem.
− Für jedes Problem ist die Einschätzung der Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten des Klienten zu benennen auf einer Skala von 1 = der Klient kann dieses Problem mit geringfügiger Hilfe oder auch allein bewältigen bis zu 6 = der Klient hat keine Möglichkeiten, alleine und ohne Hilfestellungen mit dem Problem fertig zu werden.
2. Probleme bzw. Diskriminierungen in der Lebenswelt, im Gemeinwesen (Faktor II):
− Grundlegende Versorgung (Ernährung, Unterkunft, Arbeit, Transportmöglichkeiten) ( Abb. 8) sowie weitere Probleme bezüglich
− Erziehungs- und (Aus-)Bildungssystem,
− Rechtssystem,
− Gesundheits-, Sicherheits- und Sozialdienstsystem,
− System freiwilliger Zusammenschlüsse,
− Emotionale Unterstützung in sozialen Netzwerken.
Für die fünf letztgenannten Punkte wurden auch, wie beim erstgenannten, entsprechend differenzierte Raster für die Auswertung erarbeitet (Karls/Wandrei 1994, S. 53 ff.) und analog zu den oben genannten Teilschritten Hinweise entwickelt (S. 49 f.).
Die beiden Faktoren III und IV werden nur kurz erwähnt, da sie Gegenstand anderer Professionen (Psychologie und Medizin) sind:
3. Psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten (Faktor III).
4. Körperliche Erkrankungen (Faktor IV).
Bei den Faktoren III und IV kann auf die bewährten und oben schon erwähnten Klassifikationssysteme DSM-IV und ICD-10 zurückgegriffen werden. Die Befunde aus diesen beiden Bereichen stehen häufig in Wechselwirkung zu den beiden anderen Systembereichen und sind deshalb unter der Prämisse einer ganzheitlichen Sichtweise in die Situationsanalyse und Interventionsplanung mit einzubeziehen. Unter Umständen ergibt sich aus dieser Analyse auch, dass es ein Fall primär für den Internisten und nicht für den Sozialpädagogen ist. Der vorrangige Fokus des PIE-Systems ist nicht auf die psychischen und körperlichen Probleme gerichtet, sozialpädagogische Interventionen schließen aber öfters medizinische und psychiatrische Behandlungsnotwendigkeiten mit ein. Dies ist besonders in einem Tätigkeitsbereich der Sozialen Arbeit der Fall, nämlich in der Klinischen Sozialen Arbeit ( Kap. 7.2.2), wenn SozialpädagogInnen gelernt haben, kompetent mit den Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 umzugehen. Ansonsten sind die Angaben der Klienten zu psychischen und körperlichen Befunden mit der nötigen Vorsicht und unter Angabe der Quellen aufzunehmen (»Asthma laut Diagnose von Dr. X« oder »Depressionszustände nach Angaben des Klienten«), oder aber es wird eine Kooperation mit den entsprechenden Fachleuten notwendig.
In der beschriebenen Form ist das PIE-System begrenzt auf erwachsene Klienten über 18 Jahre. Für die Arbeit mit Kindern und wohl auch für die Arbeit mit bestimmten Klientengruppen (Menschen aus anderen Kulturkreisen oder Subkulturen, Menschen mit geistigen Behinderungen) ist das PIE-System angemessen zu modifizieren und in die »Sprache« der Klienten zu transformieren. Dies heißt auch, den Zugang zum Klienten und zu seinen Informationen anders als über Verbalisieren zu gestalten, also etwa mit Zeichnungen, Fingerpuppen oder Skulpturen zu arbeiten (vgl. Stimmer und Rethfeldt 2004). Auch in der Arbeit
Abb. 7: PIE-Fragebogen »Probleme in sozialen Rollen« (aus Karls/Wandrei 1994, S. 51)
Abb. 8: PIE-Fragebogen »Probleme in der Lebenswelt, im Gemeinwesen« (aus Karls/Wandrei 1994, S. 52)
Abb. 9: Fallorientierte Lebenslagenanalyse in professionellen Unterstützungsprozessen (aus: Hey, 2000, S. 278).
mit Familien kann die Situationsanalyse mit dem PIE-System wichtige Hinweise über die Probleme einzelner Familienmitglieder innerhalb der Familie vermitteln und damit für die Analyse von Interaktionsproblemen im Rahmen der Familienstruktur. Ähnliches gilt für die Arbeit mit Organisationen. Bei der Erhebung der sozialen Rollen kann auch gut mit den verschiedenen Formen des »Kulturellen Atoms« ( Kap. 5.5.2) gearbeitet werden. Die Inhalte, die unter dem Faktor II erhoben werden, können eigenständig auch als Grundlage für die Gemeinwesenarbeit ( Kap. 8.5.2) dienen.
Eine Differenzierung des PIE-Systems mit dem Fokus auf eine multiprofessionelle Kooperation hat Hey (2000, S. 264 ff.) in einem idealtypischen Modell einer »fallorientierten Lebenslagenanalyse« vorgelegt, deren einzelne Ebenen in Abbildung 9 benannt sind. Eine (notwendige) Erweiterung des PIE-Systems für die Diagnostik in der Sozialen Arbeit stellt Adler (2004) vor (vgl. auch Pantućek 2009, S. 250–265; dort auch eine deutsche Übersetzung der Fragebögen).