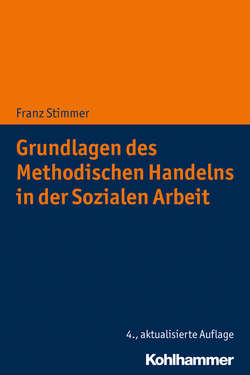Читать книгу Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit - Franz Stimmer - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3 Sozialstaat und Sozialpolitik
ОглавлениеNeben den beschriebenen allgemeineren Folgen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse mit ihren Chancen und Gefährdungen für alle Gesellschaftsmitglieder sind dabei natürlich vor allem Gruppierungen für die Soziale Arbeit bedeutsam, die in besonderer Weise, kurzfristig oder dauerhaft, den Gefährdungen der Gesellschaft oder gesellschaftlicher Umbrüche unterliegen (Armut, Arbeitslosigkeit, Imigration, Sucht, Behinderungen …). Das Sozialstaatsprinzip und die Sozialpolitik geben dabei den Rahmen für die Handlungsmöglichkeiten professioneller Sozialer Arbeit vor, wenn dabei auch, vielleicht zunehmend, privatwirtschaftlich organisierte Hilfen angeboten werden und Laienhilfe und Selbsthilfe wichtige und unterstützende Faktoren des Hilfesystems darstellen.
Die Idee des Sozialstaats bzw. die Begründung des Sozialstaatsprinzips als aktives Regelungsinstrument des Staates zur Lösung gesellschaftlicher Probleme entwickelte sich mit den Verelendungsfolgen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Der Sozialstaat ist heute unter den Begriffen »sozialer Bundesstaat« bzw. »sozialer Rechtsstaat« im Grundgesetz verankert (Art. 20 bzw. 28 GG). Daraus lässt sich das Sozialstaatsprinzip mit der Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit (Angleichung unterschiedlicher Lebenschancen) und zur sozialen Sicherheit (ausreichender Schutz bezüglich der üblichen Lebensrisiken) ableiten und die Notwendigkeit spezieller sozialer Dienste begründen. Mit dem Begriff der Sozialpolitik sind die Bemühungen umschrieben, soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit für benachteiligte Personen oder Gruppen zu gewährleisten. Wie der Begriff Sozialstaatsprinzip ist auch der der Sozialpolitik nicht stringent definiert, was nicht nur von Nachteil ist, da etwa über die Rechtsprechung und über politische Aktivitäten flexibel situationsspezifisch reagiert und agiert werden kann. Neben der staatlichen bzw. kommunalen Sozialpolitik wird diese auch von nicht-staatlichen Organisationen (Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften) und von den Kirchen gestaltet. Die zentralen Inhalte der Sozialpolitik sind Armut und soziale Benachteiligung, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Wohnen und Wohnungslosigkeit, Gesundheit und Krankheit, Behinderung, lebensaltersspezifische Probleme und Mitbestimmungsrechte (Arbeitnehmer, Kinder, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, behinderte Menschen). In diesen Inhalten spiegeln sich zugleich wesentliche Tätigkeitsbereiche Sozialer Arbeit. Die Umsetzung sozialpolitischer Vorgaben ist gesetzlich verankert. Das Sozialrecht beinhaltet all die Leistungsbereiche, die sich aus individuellen und kollektiven Notlagen ableiten lassen, deren Lösung der staatlichen Hilfe bedürfen, da sie von einzelnen nicht mehr zu bewältigen sind. Im Sozialgesetzbuch (SGB) sind die wichtigsten Bereiche zusammengefasst (Sozialversicherung: Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung; Arbeitsförderung; Kinder- und Jugendhilfe; Sozialhilfe). Für die Umsetzung gilt dabei das Subsidiaritätsprinzip, das zwar nicht den Rang einer allgemein gültigen Rechtsnorm besitzt, sondern einen sozialphilosophischen Grundsatz, eine ethische Forderung für die sozialpolitische Praxis darstellt und das die Zuständigkeiten der verschiedenen Trägerorganisationen und auch das Verhältnis zwischen den Leistungsnehmern und den Leistungsgebern regeln soll. Allgemein bezeichnet dieses Prinzip den Vorrang der kleineren Gemeinschaften (etwa Familie und wohlfahrtsstaatliche Verbände wie Caritas oder Diakonisches Werk) gegenüber staatlichen Trägern, was auch die Unterstützung dieser kleineren Gemeinschaften durch die größere Einheit mit einschließt (oder es zumindest sollte). Neben den großen wohlfahrtsstaatlichen Verbänden existieren heute eine Reihe kleinerer sozialer Inititiativen, vor allem auch aus der Selbsthilfebewegung, so dass neben den staatlichen und den kommerziellen Trägern sozialer Hilfeleistungen ein »Dritter Sektor« entstanden ist, der ebenfalls die aus dem Sozialstaatsprinzip, der Sozialpolitik und dem Sozialrecht ableitbaren Aufgaben erfüllt und nach dem Subsidiaritätsprinzip eine öffentliche Förderung und mehr rechtliche und finanzielle Eigenständigkeit fordert ( Kap. 4.4.3).