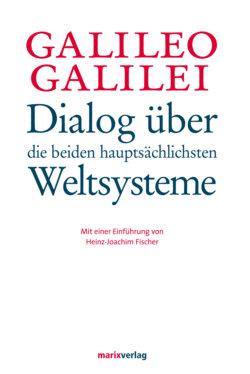Читать книгу Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme - Galileio Galilei - Страница 25
FORTSCHRITTLICHE KALENDERREFORM DANK DER BESTEN ASTRONOMEN
ОглавлениеPapst Gregor XIII. (geb. 1502, 1572–1585) wollte den Kalender reformieren. An der Spitze des wissenschaftlichen Fortschritts. Der alte Julianische Kalender (von Cäsar, aus dem 1. Jh. v. Chr.) war aus dem Sonnentakt geraten und sorgte für fehlerhafte Datierung, zum Beispiel des christlichen Osterfestes, eigentlich am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. So verfügte der Papst, im Oktober 1582 zehn Datumstage ausfallen zu lassen. Daher folgte auf Donnerstag, den 4. Oktober, gleich Freitag, der 15. Oktober, doch nur in denjenigen katholischen Ländern, die diese Reform sofort annahmen. Länder der Reformation brauchten länger für den Fortschritt; die protestantischen deutschen Reichsstände passten sich 1700, England und die amerikanischen Kolonien 1752, Sowjetrussland 1918 und zuletzt die Volksrepublik China 1949 dem genaueren System des Papstes an. Konfession oder Ideologie waren ihnen offenbar wichtiger.
Gregor XIII. standen dabei die besten Astronomen zur Verfügung, zumeist Priester aus dem Jesuitenorden. Diese »Gesellschaft Jesu« wollte nach dem Beispiel ihres Gründers, des Basken Ignatius von Loyola (1491–1556), mit Macht, das heißt, mit Schulen und Universitäten, mit Wissen und noch mal Wissen die Bildung der Katholiken heben, in Treue zum Papst. Die bedeutendsten Jesuiten-Astronomen waren:
• Christophorus Clavius aus Bamberg (1537/8–1612) hat in Rom die wissenschaftliche Leitung der Kalenderreform inne.
• Matteo Ricci aus dem mittelitalienischen Macerata (1552–1610) überzeugt als Missionar den Kaiserhof in China von der Überlegenheit der römischen Astronomie.
• Christoph Scheiner, ein bayerischer Schwabe (1573–1650), wird in Rom (1624–1633) – etwa im Konflikt um die Entdeckung der Sonnenflecken – zum Konkurrenten Galileis. Deren persönliche Rivalität wird schon von berühmten Zeitgenossen, wie René Descartes und Pierre Gassendi (»Beide sind gut, streben nach Wahrheit, sind gleich ehrlich und rechtschaffen. Beide haben sich gegenseitig beleidigt.«), bedauert. Scheiner verlangt im Prozess von Galilei »Beweise«, vielleicht, weil er seine eigenen Zweifel (an der Geozentrik) besiegen wollte. Gleichviel. Es gilt das Fehl-Urteil der Inquisition.
• Athanasius Kircher aus Fulda (1602–1680 in Rom), universal gebildet, ein Forscher ersten Ranges auf vielen Gebieten, als »der erste Gelehrte mit weltweiter Reputation« (Findlen) bezeichnet, leitet als Professor am Collegium Romanum (seit 1634) eine Revision des römischen Weltbildes ein. Er beschreibt das geozentrische System von Tycho de Brahe (geb. 1546 in Dänemark, gest. 1601 in Prag) und das heliozentrische des kaiserlichen Hof-Astronomen Johannes Kepler (geb. 1571 in Württemberg, gest. 1630 in Regensburg) auch als Theologe so behutsam, dass beide mit der Heiligen Schrift vereinbar scheinen.