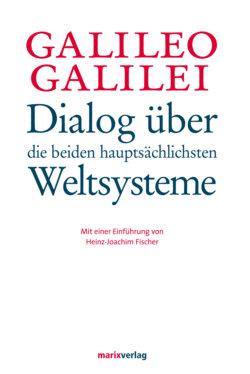Читать книгу Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme - Galileio Galilei - Страница 29
ZWEI NEUE PROZESSE
ОглавлениеNach dem Ende des Prozesses vor dem römischen Tribunal im Juni 1633, nach der Abschwörung Galileis und dem Urteil der Inquisition zu Haft und Buße beginnen zwei neue Prozesse; die Mythologisierung des Astronomen und die Revision durch die Kirche. Beide unmerklich, sehr langsam. Galilei lebte ja noch. Im Unterschied zu dem anderen berühmten oder berüchtigten Kopernikaner, Giordano Bruno (geb. 1548), an dessen Scheiterhaufen am 17. Februar 1600 auf dem Campo de’ Fiori sich die Römer noch erinnern konnten. Dessen Verbrennung war – auch nach päpstlichem Urteil, so von Johannes Paul II. im März 2000 – ein »Unrecht«.
Aber dessen »Ketzerei« war von ganz anderer Art: Schmähungen, als ungeheuerlich empfunden, gegen Christus und das Christentum; provozierende Blasphemie, noch dazu mit schändlichem Antisemitismus, wenn Giordano schreibt:
»Wenn also … einer (Jesus Christus) aus dem unwürdigsten und schmutzigsten Geschlecht der Welt, ein Mensch von niedrigster und gemeinster Natur und Denkart als Zeus angebetet wird, so … erwerben sich, die ihn anbeten, dadurch Geringschätzung und Tadel. Niemals also wird ein Schurke deshalb ehrwürdiger erscheinen, weil er mit Hilfe feindlicher Genien zum Affen und zum Popanz dient für den blinden Pöbelglauben.« Bruno nennt Jesus »einen verächtlichen, gemeinen und unwissenden Menschen … durch welchen alles entwürdigt, geknechtet, in Verwirrung gebracht und das Unterste zuoberst verkehrt, die Unwissenheit an Stelle der Wissenschaft … der echte Adel zu Unehren und die Niederträchtigkeit zu Ehren gebracht« worden sei. Die Juden seien »eine so pestilenzialische, aussätzige und gemeingefährliche Rasse, dass sie schon vor ihrer Geburt ausgerottet zu werden verdienen«. (aus »Die Vertreibung der triumphierenden Bestie«.) Diese Worte rechtfertigen nicht ein Todesurteil, sind freilich auch nicht denkmalswürdig. Sie zeigen, dass Galilei ein ganz anderer war.
Knapp 70 Jahre alt, wird Galilei nach der Verurteilung »zu formaler Haft« – »Kerker« wird es nicht – in den Palazzo der toskanischen Gesandtschaft zu Rom gebracht, kommt im toskanischen Siena unter die gastfreundliche »Aufsicht« des Erzbischofs, einer seiner Bewunderer, und nimmt dann seine Wohnung in einer geräumigen Villa oberhalb von Florenz, in Arcetri. Er ist kein freier Mann, verurteilt und soll auch als Strafe die sieben Bußpsalmen beten – was er an seine Ordensschwester-Tochter delegiert. Keine Frage, »er hatte viel zu leiden durch Männer und Institutionen der Kirche« (Johannes Paul II., 1979). Aber er kann arbeiten, beobachten, forschen, schreiben, bis seine Augen schlechter werden; seinem Sekretär diktieren. Vor allem sein naturwissenschaftliches Hauptwerk, die »Discorsi, über zwei neue Wissenszweige«, die 1638 im holländischen Leiden veröffentlicht werden. Er stirbt zu Hause, in der Villa zu Arcetri, am 8. Januar 1642, im Alter von knapp 78 Jahren. Seine sterblichen Überreste finden zunächst eine provisorische Grablege.
War damit der »Fall Galilei« abgeschlossen? Zumindest war es wohl still geworden um den Italiener. Die Urteile der Römischen Inquisition beschwerten weiter nördlich ebenso wenig wie einige Jahre später der (missverständliche) Protest Papst Innozenz’ X. gegen den Westfälischen Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648). Die Naturwissenschaften und neue, von den Kirchen emanzipierte Philosophien der europäischen Gelehrten nahmen ihren Lauf, einen immer schnelleren.
• Der Engländer Isaac Newton, ein Jahr nach Galilei, am 4. Januar 1643 geboren, 1727 gestorben, findet als Physiker und Mathematiker nicht den Willen Gottes, sondern die Gesetze der Natur.
• René Descartes (1596–1650) und Baruch de Spinoza (1632–1677) interessieren sich als erste von vielen modernen Denkern nicht für die in der Bibel berichteten Launen Gottes, sondern für klare Gedanken und schlüssige Ideen.
• Die Jesuiten als Erzieher der Eliten im katholischen Europa suchen Papsttreue und moderne Erkenntnisse zu verbinden.
• Die Anfang des 18. Jahrhunderts in Konkurrenz zum Christlichen sich erhebende Bewegung der Freimaurerei mit vielen prominenten Anhängern weist auf, dass die Kirchen die intellektuelle Führerschaft in Europa – von der mittelalterlichen Vormundschaft zu schweigen – einbüßt.