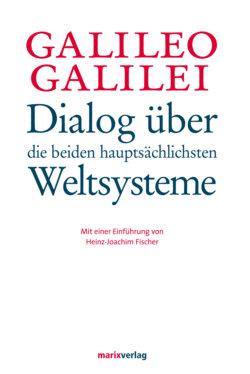Читать книгу Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme - Galileio Galilei - Страница 27
HELIOZENTRIK – EINE ZUMUTUNG
ОглавлениеDie Wissenschaftstheoretiker wie Hans Blumenberg (1920–1996) und Paul Karl Feyerabend (1924–1994) sind sich der Dramatik dieses Wandels gerade im »Fall Galilei« bewusst. Aber niemand hat wohl einfühlsamer als Goethe erfasst, was den Menschen zwischen 1450 und 1650 in Europa zugemutet wurde, und am dramatischsten beschrieben:
»In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehnt werden tüchtige Entdeckungen gemacht, geschehen unerwartete Begebenheiten, treten vorzügliche Menschen auf, welche neue Ansichten verbreiten … Doch unter allen Entdeckungen und Überzeugungen möchte nichts eine größere Wirkung auf den menschlichen Geist hervorgebracht haben als die Lehre des Kopernikus. Kaum war die Welt als rund anerkannt und in sich abgeschlossen, so sollte sie auf das ungeheure Vorrecht Verzicht tun, der Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Vielleicht ist noch nie eine größere Forderung an die Menschheit geschehen: denn was ging nicht alles durch diese Anerkennung in Dunst und Rauch auf: ein zweites Paradies, eine Welt der Unschuld, Dichtkunst und Frömmigkeit, das Zeugnis der Sinne, die Überzeugung eines poetisch-religiösen Glaubens; kein Wunder, dass man dies alles nicht wollte fahren lassen, dass man sich auf alle Weise einer solchen Lehre entgegensetzte, die denjenigen, der sie annahm, zu einer bisher unbekannten, ja ungeahnten Denkfreiheit und Großheit der Gesinnungen berechtigte und aufforderte.« (»Geschichte der Farbenlehre, 16. Jh.«, Zwischenbetrachtung.)
Doch unvereinbar waren jüdisches Auserwählungsselbstbewusstsein und christlicher Erlösungsglaube mit dem heliozentrischen Weltbild nicht. Denn seit Jahrtausenden gab es in der jüdisch-christlichen Tradition nie nur eine allgemeine wortwörtliche Auslegung der Heiligen Schriften – im Unterschied etwa zum offiziell-amtlichen Islam, für den der Koran schlechthin das undiskutierbare »Wort Gottes« ist. Rabbiner lehrten in den Synagogen die fromme Unterscheidung und die orthodoxe Auslegung im Alltag. Die Kirchenväter, wie etwa Origines im 3. Jahrhundert, unterschieden einen dreifachen Sinn, den buchstäblichen, den moralischen und den pneumatischen. (So konnte etwa jemand einen anderen wirklich umbringen, ihn aber auch nur moralisch vernichten oder geistig erledigen.) Diese Unterscheidungsfähigkeit war wohl begründet. Die Kundigen wussten, dass die Heiligen Schriften der Bibel nicht plötzlich vom Himmel gefallen waren, sondern im Lauf von Jahrhunderten und Jahrzehnten (nach Christus) allmählich entstanden und zum Kanon zusammengefasst worden waren. Für Juden und Christen war die Bibel kein Physikbuch, sondern die Gewähr von Auserwählung und Erlösung. Eigentlich.
Aber im »Fall Galilei« platzt diese Revolution des Weltbildes auf. Zwischen einem Astronomen, der das Richtige sieht und der Kirche sagen will, wie sie die Bibel auszulegen hat. Die römischen Theologen der Inquisition besaßen nicht die Klugheit zu erwägen, was wäre, wenn Galilei richtig gesehen hätte. Stattdessen hielten sie in der Borniertheit der »Fundamentalisten« ihre Sicht für die einzig mögliche, allein seligmachende.