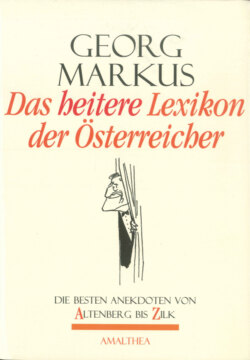Читать книгу Das heitere Lexikon der Österreicher - Georg Markus - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JOHANNES BRAHMS Komponist
Оглавление* 7. 5. 1833 Hamburg † 3. 4. 1897 Wien. Der Komponist entschied sich im Alter von 29 Jahren für Wien als Wahlheimat. Ein Großteil seines Werks wurde in Wien uraufgeführt, darunter vier Symphonien, vier Konzerte, zwei Serenaden, Orgelmusik, Chorwerke, Lieder und Kammermusik. Er leitete die Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde und war mit Clara und Robert Schumann befreundet.
Der aus kleinen Verhältnissen stammende Brahms hatte es zu großem Wohlstand gebracht. Immer wenn er seinen Vater in Hamburg besuchte, versuchte er ihm etwas Geld zuzustecken, dessen Annahme der alte Mann jedoch verwehrte. Als er sich wieder einmal von seinem Vater verabschiedete, sagte er: »Glaub mir, Vater, der größte Trost, wenn es einem schlecht geht, ist immer noch die Musik. Wenn du einmal vor Schwierigkeiten nicht mehr weiter weißt, dann nimm diese alte Partitur von Händel und blättere ein wenig darin. Du wirst sehen, du findest, was du brauchst.«
Als Brahms Vater dies einige Wochen später wirklich tat, fand er zwischen jeder Seite eine Banknote.
Nachwuchskünstler ersuchten den großen Brahms immer wieder, ihnen seine Meinung über ihr Werk mitzuteilen. Einmal wurde ihm von einem jungen Wiener eine Komposition gesandt, wobei der Begleitbrief mit der Bitte um Begutachtung folgendermaßen endete: »Wenn Sie etwas an meiner Partitur auszusetzen haben, dann dürfen Sie mir ruhig die Wahrheit sagen, Meister Brahms. Denn selbst wenn Ihr Urteil noch so vernichtend ausfällt, nichts würde mich mehr adeln als die Kritik von Johannes Brahms.«
Brahms schickte die Partitur mit der charmant verpackten Bemerkung zurück: »Mein lieber junger Kollege, ich möchte Sie am liebsten zum Erzherzog ernennen …«
Ein Mädchen wiederum wandte sich an Brahms, um ihn zu fragen, ob es eine Gesangskarriere wagen solle. Nachdem sie ihm vorgesungen hatte, erklärte die junge Frau: »Neues Kleid und Handschuhe habe ich schon gekauft.«
»Schade«, meinte Brahms, »sonst hätte ich geraten: Lieber nicht!«
Wer so oft und so hart urteilte wie Brahms, konnte natürlich auch irren. Als ihm der junge Hugo Wolf eines seiner frühen Lieder mit der Bitte schickte, »an den Stellen ein Kreuz zu machen, die Ihnen nicht gelungen erscheinen«, antwortete Brahms: »Ich kann Ihnen doch keinen Friedhof einrichten.«
Kein Wunder, dass Hugo Wolf später nicht besonders gut auf Brahms zu sprechen war. Das wurde insofern unangenehm, als Wolf viele Jahre als Kritiker im Wiener Salonblatt schrieb, in dem Brahms fortan immer nur schlecht weg kam. Als Wolf einmal überraschenderweise eine außerordentlich lobende Kritik über eines seiner Werke schrieb, meinte Brahms: »Heute kann man sich auf keinen Menschen mehr verlassen. Jetzt fängt der auch schon an, mich zu loben!«
Brahms ließ einen Schüler ein Stück von Schubert spielen. »Zu dieser Komposition«, sagte der Meister, »wurde Schubert durch den Gedanken an eine geliebte Frau inspiriert. Fühlen Sie sich also entsprechend in die Musik ein.« Kaum hatte der Schüler ein paar Takte gespielt, wurde er auch schon von Brahms unterbrochen: »Sie haben mich falsch verstanden. Das Stück richtet sich an eine Geliebte. Nicht an eine Schwiegermutter.«
Eine wenig begabte Sängerin versuchte Brahms ein Kompliment zu machen, indem sie ihn fragte, welche seiner Lieder er ihr zu singen empfehle. Brahms knappe Antwort lautete: »Meine posthumen.«
Der starke Raucher paffte so ziemlich alles, was ihm zwischen die Finger kam – sowohl die teuren ausländischen, als auch die billigen österreichischen Sport-Zigaretten. Eines Tages spielte ihm ein junger Musiker namens Erich J. Wolff vor. Brahms lobte ihn und fragte, ob er rauche.
Als Wolff ja sagte, lächelte Brahms: »Dann sollen Sie was Gutes bekommen«, worauf er ihm eine teure ägyptische Zigarette mit Goldmundstück reichte. Wolff bedankte sich und steckte die Zigarette in seine Brieftasche. »Wollen Sie sie nicht gleich hier rauchen?«, fragte Brahms.
»Oh, nein«, antwortete Wolff. »Die rauche ich nicht. Die hebe ich mir zur Erinnerung auf. Man bekommt nicht jeden Tag eine Zigarette von Brahms!«
»Dann geben Sie sie nur wieder her«, brummte Brahms. »Als Erinnerung genügt auch eine Sport.«
Als Hans von Bülow, der zu den großen Förderern von Brahms zählte, einmal dessen Erste Symphonie dirigierte, regte sich keine Hand. Bülow wandte sich daraufhin dem Publikum zu und sagte: »Meine Damen und Herren, ich habe diese Symphonie auch nicht beim ersten Hören verstanden, ich musste sie zweimal spielen, um sie zu genießen, und nun erlauben Sie mir, dass ich sie Ihnen auch noch einmal vorspiele.«
Nachdem die ganze Symphonie wiederholt wurde, gab es großen Applaus. Ein Zuhörer meinte freilich: »Die Leute klatschten nur, damit er sie ihnen am Ende nicht noch ein drittes Mal vorspielt.«
Seine große Verbeugung vor Wien und der Wiener Musik machte Johannes Brahms durch ein paar schnell hingekritzelte Noten des Donauwalzers, denen er die Worte beifügte: »Leider nicht von mir. J. Brahms.«
Eine Aristokratin war von dem Wunsch beseelt, Brahms zu einem musikalischen Abend in ihrem Palais überreden zu können. Als er nach einigen Gesprächen fast schon zugesagt hatte, schickte sie ihm eine Gästeliste mit 200 Namen. Darunter stand die Bemerkung, er möge ungeniert jeden Namen streichen, dessen Träger ihm bei seinem Konzert nicht genehm sei. Brahms schickte die Liste schon am nächsten Tag zurück. Nur ein einziger Name war gestrichen: Johannes Brahms.
Wie stellen Sie es nur an«, wurde Brahms von einer Tischnachbarin gefragt, »dass Sie immer so zu Herzen gehende Musik schreiben?« »Sehr einfach«, antwortete Brahms. »Die Verleger wollen sie so haben.«
Wenn es hier irgendjemanden geben sollte, den ich noch nicht beleidigt habe«, verabschiedete sich der Zyniker Brahms einmal bei einem großen Empfang, »dann bitte ich um Entschuldigung.«
Brahms kam jeden Sonntag zum Mittagessen in den bürgerlichen Salon der Wiener Familie Eibenschütz – nicht nur der vielen Künstler wegen, die er dort traf, sondern auch, weil hier ein Gulasch von unerreichter Qualität serviert wurde.
Als man den großen Komponisten dort eines Tages fragte, warum er gar so deprimiert wirkte, erzählte er von der eben erst erfolgten Mitteilung seines Arztes, dass er an einem unheilbaren Leberleiden laborierte. Die Anwesenden bedauerten ihn, und als man zum traditionellen Mittagstisch schritt, meinte Frau Eibenschütz: »Aber nach dieser Diagnose dürfen Sie unser Gulasch nicht mehr nehmen, Meister, das wäre zu schwer für Sie!« »Ach was«, wehrte Johannes Brahms ab, »stellen wir uns vor, ich wäre erst nächste Woche zur Untersuchung gegangen.«
Sprach’s und ließ sich sein Gulasch einmal noch schmecken.
Gegen Ende seines Lebens sagte Brahms zu einem Bekannten: »Vor einiger Zeit begann ich mit einem neuen Werk, aber es wollte mir nicht und nicht gelingen. Da erkannte ich, dass ich jetzt wohl zu alt sei, und beschloss, mit dem Komponieren aufzuhören. Ich fand, ich hätte doch genug geleistet, jetzt könnte ich mir ein sorgenfreies Alter machen und es in Frieden genießen. Und das machte mich so glücklich und zufrieden, dass das Komponieren mit einem Mal wieder wunderbar ging.«
Befragt, was er von der Unsterblichkeit halte, antwortete Johannes Brahms, skeptisch in die Zukunft blickend: »Ach Gott, wenn sie heutzutage dreißig Jahre dauert, dann ist das schon sehr viel.«