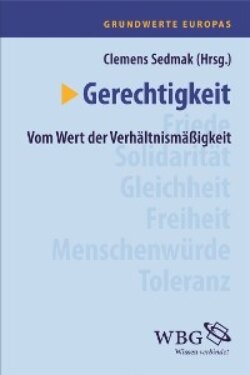Читать книгу Gerechtigkeit - Группа авторов - Страница 24
Literatur
ОглавлениеAnderson, Elizabeth S. (2000): Warum eigentlich Gleichheit?, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main, S. 117–171.
Arendt, Hannah (2011): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. München.
Aristoteles (1985): Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes. Hrsg. v. G. Bien. Hamburg.
Aristoteles (1993): Rhetorik. Übersetzt, mit einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz G. Sievecke. München.
Cicero (1993): Der Staat. Studienausgabe. Lateinisch-Deutsch. Hrsg. u. übers. v. Karl Büchner. München.
Coing, Helmut (1989): Europäisches Privatrecht. Band II. 19. Jahrhundert. Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern. München.
Die Vorsokratiker (1968), hrsg. von Wilhelm Capelle. Stuttgart.
Dreier, Horst (2004): Artikel 1, Menschenwürde, in: ders. (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar. Band 1. Tübingen.
Dürig, Günther (1956): Der Grundsatz von der Menschenwürde, in: Archiv des öffentlichen Rechts 42, S. 117–157.
Dworkin, Ronald (2000): Sovereign Virtue. Cambridge/Mass.
Funke, Andreas (2003): Überlegungen zu Gustav Radbruchs „Verleugnungsformel“. Ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsbegriff, in: ARSP 89, S. 1–16.
Gröschner, Rolf (2013): Entwurfsvermögen, in: ders.; Kampust, Antje; Lembcke, Oliver W. (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 330–331.
Hart, Herbert L. A. (1987): Recht und Moral. Frankfurt am Main.
Henning, Christoph (2013): Karl Marx, in: Gröschner, Rolf; Kampust, Antje; Lembcke, Oliver W. (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 46–47.
Hobbes, Thomas (1984): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Hrsg. u. eingeleitet v. I. Fetscher. Übers. v. W. Euchner. Frankfurt am Main.
Hoffmann, Klaus Friedrich (2002): Überlegungen zum Homo-Mensura-Satz des Protagoras, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 17–32.
Hutcheson, Francis (2004): An inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue. Indianapolis.
Jakl, Bernhard (2009): Recht aus Freiheit. Berlin.
Jakl, Bernhard (2013): Human Dignity as a Fundamental Right to Freedom in Law, in: Kirste, Stephan; Brugger, Winfried (Hrsg.): Human Dignity as a Foundation of Law. Stuttgart (ARSP-Beiheft 137), S. 93–104.
Kant, Immanuel (MS) (1982): Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Immanuel Kant Werkausgabe, Bd. VIII. Hrsg. v. W. Weischedel. Frankfurt am Main, S. 305–499.
Kelsen, Hans (1925): Allgemeine Staatslehre. Berlin.
Kelsen, Hans (2000): Was ist Gerechtigkeit. Stuttgart.
Kersting, Wolfgang (2000): Theorien der sozialen Gerechtigkeit. Stuttgart.
Kim, Hyong-Kon (2007): The Idea of Human Dignity in Korea. Lewiston/Queenston/Lampeter.
Kirste, Stephan (2002): Einleitung, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 7–16.
Kirste, Stephan (2008): Menschenwürde und Freiheitsrechte des Status Activus. Renaissancehumanismus und gegenwärtige Verfassungsdiskussion, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Des Menschen Würde: (wieder)entdeckt oder erfunden im Humanismus der italienischen Renaissance? Tübingen, S. 187ff.
Kirste, Stephan (2010): Einführung in die Rechtsphilosophie (= Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reihe: Einführung Philosophie). Darmstadt.
Kirste, Stephan (2010a): Menschenwürde im internationalen Vergleich der Rechtsordnungen, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Das Dogma der Unantastbarkeit. Eine Auseinandersetzung mit dem Absolutheitsanspruch der Würde. Tübingen, S. 175–214.
Kirste, Stephan (2010b): Die Würde des Menschen als Grundlage des Rechtsstaats, in: Kirste, Stephan; Sprenger, Gerhard(Hrsg.): Menschliche Existenz und Würde im Rechtsstaat. Beiträge zum Kolloquium für Werner Maihofer zum 90. Geburtstag. Berlin, S. 103–120.
Kirste, Stephan (2011): Eine deskriptive Rechtsethik, in: Jahrbuch für Recht und Ethik, S. 241– 260.
Kirste, Stephan (2011a): Harter und Weicher Rechtspaternalismus unter besonderer Berücksichtigung der Medizinethik, in: JZ 2011, S. 805ff.
Kirste, Stephan (2013): Das Fundament der Menschenrechte, in: Der Staat, S. 119–138.
Kirste, Stephan (2013a): The Human Right to Democracy as the Capstone of Law, in: Rocha, B.A.; Salgado, K.; Galuppo, M.C. u.a.: Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Social Challenges in Complex Societies. Belo Horizonte, S. 103–120.
Kirste, Stephan; Brugger, Winfried (2013): Human Dignity as a Foundation of Law. (= ARSP-Beiheft 137). Stuttgart.
Kondylis, Panajotis (2004): Würde II-VIII, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Band 7. Stuttgart, S. 645–677.
Krebs, Angelika (2000): Einleitung: Die neue Egalitarismuskritik im Überblick. In: dies. (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main.
Luhmann, Niklas (1993): Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main.
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main.
Maihofer, Werner (1968): Rechtsstaat und menschliche Würde. Frankfurt am Main.
Nussbaum, Martha Craven (2010): Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Berlin.
Parfit, Derek (2000): Gleichheit und Vorrangigkeit, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main, S. 81–106.
Pfordten, Dietmar von der (2009): Zur Würde des Menschen bei Kant, in: ders. (Hrsg.): Menschenwürde, Recht und Staat bei Kant. Fünf Untersuchungen. Paderborn.
Pico della Mirandola (1990): Über die Würde des Menschen. Übersetzt von N. Baumgarten. Hrsg. u. eingeleitet von A. Buck. Hamburg.
Platon (1993): Gesetze. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd VII.). Hamburg.
Platon (1993): Der Staat. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. V.). Hamburg.
Platon (1993): Protagoras. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. I). Hamburg.
Platon (1993): Theätet. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. IV.). Hamburg.
Radbruch, Gustav (1990): Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Hassemer, Winfried (Hrsg.): Rechtsphilosophie III. (= Radbruch Gesamtausgabe, Bd. 3). Heidelberg, S. 83–93.
Rawls, John (1975): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt.
Raz, Joseph (2000): Strenger und rhetorischer Egalitarismus, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main, S. 50–81.
Sartre, Jean-Paul (1985): Drei Essays. Frankfurt am Main.
Sattler, Martin (2002): Der Mythos des Protagoras, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 32ff.
Savigny, Friedrich Carl von (1840): System des heutigen römischen Rechts, Bd. 2. Berlin.
Schaefer, Jan (2013): Human Dignity: A Remedy fort the Clash of Cultures? – Human Dignity and the Mind of Mencius, in: Kirste, Stephan; Brugger, Winfried: Human Dignity as a Foundation of Law. Human Dignity as a Foundation of Law. (= ARSP-Beiheft 137). Stuttgart, S. 181–192.
Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Brief 1 bis 27.
Schmitt, Carl (1914): Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Tübingen.
Sen, Amartya (2010): Die Idee der Gerechtigkeit. München.
Tiedemann, Paul (2012): Menschenwürde als Rechtsbegriff. Berlin.
Unruh, Christoph (2002): Die Gleichheit des Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik. Stuttgart, S. 59–82.
Vögele, Wolfgang (2013): Gottebenbildlichkeit, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 158–159.
1 Platon (1993): Theätet. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. IV.). Hamburg. Hier 152 Af., S. 45.
2 Vgl. Hoffmann, Klaus Friedrich (2002): Überlegungen zum Homo-Mensura-Satz des Protagoras, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 17–32. Hier S. 21.
3 Platon (1993): Theätet. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. IV.). Hamburg. Hier 167, S. 71.
4 Vgl. ebd. hier 168 D, S. 73.
5 Vgl. ebd. hier 178 Dff., S. 88f.
6 Vgl. ebd. hier 178 E, S. 89.
7 Vgl. Platon (1993): Der Staat. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. V.). Hamburg. Hier 433f., S. 154f.
8 Vgl. Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main. Hier S. 81. „Die Antwort auf die Frage, welche Operationen das Recht als Recht produzieren, muß vorausgesetzt werden. Psychische Systeme beobachten das Recht, sie erzeugen es nicht, denn sonst bliebe es tief verschlossen in dem, was Hegel einmal die ‚finstere Innerlichkeit des Gedankens‘ genannt hat. Deshalb ist es nicht möglich, psychische Systeme, Bewußtsem oder gar den ganzen Menschen für einen Teil oder auch nur für eine interne Komponente des Rechtssystems zu halten. Die Autopoiesis des Rechts kann nur über soziale Operationen realisiert werden. “ (Luhmann 1993, S. 48f.).
9 Vgl. Kirste, Stephan (2013a): The Human Right to Democracy as the Capstone of Law, in: Rocha, B.A.; Salgado,K.; Galuppo, M.C.: Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Social Challenges in Complex Societies. Belo Horizonte, S. 103–120. Hier S. 103ff.
10 Luhmann nennt die Vorstellung, „dass eine Gesellschaft aus konkreten Menschen und aus Beziehungen zwischen Menschen bestehe“ neben der Vorstellung, dass sie auf dem Konsens der Menschen beruhe, regional gegliedert und von außen beobachtbar sei, eine „Erkenntnisblockierung“ der modernen Sozialtheorie (Luhmann 1997, S. 24f.).
11 Zu einer deskriptiven Rechtsethik vgl. Kirste (2011), S. 241ff.; das schließt eine externe, normative Ethik insbesondere als Teil einer praktischen Philosophie nicht aus. Zu einer derartigen normativen Ethik vgl. die verschiedenen Arbeiten von Von der Pfordten, insbes. Von der Pfordten (2010), S. 17f. und 2011, S. 7ff; eine Rechtsphilosophie, die sich als Philosophie des juristischen Denkens versteht, wird jedoch zunächst mit der Rekonstruktion des normativen Gehalts in der Form des Rechts beginnen.
12 Vgl. Kirste, Stephan (2010): Einführung in die Rechtsphilosophie (= Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reihe: Einführung Philosophie). Darmstadt. Hier S. 110ff.
13 Vgl. ebd. hier S. 86.
14 Für manche Autoren und etwa auch die deutschen Gerichte gilt das nur bis zu einer Grenze, die nach der Radbruch’schen Formel markiert wird: Sobald ein „unerträgliches Maß“ an Ungerechtigkeit erreicht wird, hat nach der sog. Unerträglichkeitsformel das staatlich gesetzte Unrecht der Gerechtigkeit zu weichen, auch wenn dieses Unrecht den Wert der Rechtssicherheit und der Zweckmäßigkeit erfüllt. Nichtrecht ist eine Norm nach der Verleugnungsformel dann, wenn Gerechtigkeit gar nicht erstrebt wird: „Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ‚unnchtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unnchtiges‘ Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen“ (Radbruch 1990, S. 89); dazu auch Funke (2003), S. 1ff. Während die Verleugnungsformel unproblematisch ist, wenn man mit Radbruch die Bezogenheit auf Gerechtigkeit als Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis von Recht akzeptiert und nicht auf einer formalen Grundnorm im Sinne von Hans Kelsen besteht, verwischt die „Unerträglichkeitsformel“ die formale Grenze von Rechtsnormen und anderen Normen. Man mag ein im moralischen Sinn ungerechtes Recht moralische Geltung absprechen; die rechtlichen Geltungskriterien festzulegen, ist Sache des positiven Rechts selbst.
15 Vgl. Kirste, Stephan (2010): Einführung in die Rechtsphilosophie (= Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reihe: Einführung Philosophie). Darmstadt. Hier S. 112ff.
16 Vgl. Kirste, Stephan (2002): Einleitung, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 7–16. Hier S. 7ff.
17 Vgl. Platon (1993): Der Staat. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. V.). Hamburg. Hier 353e: „Tüchtigkeit der Seele und Ungerechtigkeit dagegen ihre Schlechtigkeit“.
18 Vgl. Platon (1993): Politikos oder vom Staatsmann. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. VI.). Hamburg. Hier 294 a–c.
19 Vgl. Platon (1993): Gesetze. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. VII.). Hamburg. Hier wird es zwar weiterhin als erstrebenswert bezeichnet wird, dass ein einsichtsvoller, weiser Mensch den Staat regiere, einen solchen aber zu finden als kaum realistisch angesehen und deshalb dem Gesetz als der zweitbesten Lösung, das zwar nicht alles und jedes berücksichtigt aber doch vieles und das regelmäßig Auftretende, notgedrungen der Vorzug eingeräumt wird.
20 Vgl. Aristoteles (1985): Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes. Hrsg. v. G. Bien. Hamburg. Hier V, 3, 1129b 28.
21 Ebd. hier V, 7, 1132a3.
22 Vgl. ebd. hier V, 14, 1137b 14f.
23 Vgl. Hobbes, Thomas: Leviathan XIII, S. 98 und XV, S. 120: „Aber wenn ein Vertrag geschlossen ist, dann ist es ungerecht, ihn zu brechen; und die Definition der Ungerechtigkeit ist nichts anderes als die Nichterfüllung von Verträgen. Und was nicht ungerecht ist, ist gerecht“.
24 Vgl. Kant, Immanuel (MS) (1982): Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Immanuel Kant Werkausgabe, Bd. VIII. Hrsg. v. W. Weischedel. Frankfurt am Main, S. 305–499. Hier AB 33, S. 337: Recht ist der „Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“.
25 Ebd. S. 423: „Der nicht-rechtliche Zustand, d.i. derjenige, in welchem keine austeilende Gerechtigkeit ist, heißt der natürliche Zustand (status naturalis). Ihm wird nicht der gesellschaftliche Zustand …, der ein künstlicher (status artificialis) heißen könnte, sondern der bürgerliche (status civilis) einer unter einer distributiven Gerechtigkeit stehenden Gesellschaft entgegen gesetzt… Man kann den ersteren und zweiten Zustand den des Privatrechts, den letzteren und dritten aber den des öffentlichen Rechts nennen“.
26 Etwa durch den Wertskeptizismus eines Hans Kelsen, der von der Nichterkennbarkeit der Gerechtigkeit ausgeht und daher auch den Streit zwischen Gerechtigkeitsvorstellungen für nicht entscheidbar hält, vgl. Kelsen (2000), S. 16f. und 43: „[I]ch weiß nicht und kann nicht sagen, was Gerechtigkeit ist, die absolute Gerechtigkeit, dieser schöne Traum der Menschheit. Ich muß mich mit einer relativen Gerechtigkeit begnügen und kann nur sagen, was Gerechtigkeit für mich ist“.
27 „… ein Minimum an Gerechtigkeit wird notwendigerweise immer dann verwirklicht, wenn menschliches Verhalten durch allgemeine Normen kontrolliert wird, die öffentlich verkündet und von den Gerichten angewendet werden. Die Idee der Gerechtigkeit in ihrer einfachsten Form (Gerechtigkeit bei der Rechtsanwendung) verlangt lediglich, den Gedanken ernstzunehmen, dass es ein und dieselben allgemeinen Regeln sind, die unbeeinflußt von Vorurteilen, Interessen und Launen auf eine Vielzahl verschiedener Personen angewendet werden sollen… Dem widerspricht nicht, dass man auch solche Normen in gerechter Weise anwenden kann, die äußerst verwerflich sind. “ (Hart 1987, S. 69)
28 Fragment 1 aus: Platon, Gorgias, in: Die Vorsokratiker (1968), hrsg. von Wilhelm Capelle. Stuttgart. Hier S. 353f.: „Doch die Natur selber offenbart ja, dass es gerecht ist, dass der tüchtigere Mann mehr hat als der weniger tüchtige und der stärkere mehr als der schwächere“. Hierzu gehört auch Thrasymachos, der die freie Entfaltung der Kräfte des Menschen propagiert.
29 Vgl. Unruh, Christoph (2002): Die Gleichheit des Menschen bei Antiphon dem Sophisten, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik. Stuttgart, S. 59–83. Daraus folgte die mutige Folgerung, die allerdings erst Alkidamas etwas später formuliert hat: „Als Freie hat Gott alle entsandt, niemanden hat die Natur als Sklaven geschaffen“ (Aristoteles: Rhetorik 1 13, 1373b 18). Für eine starke Umverteilung im Interesse der Gleichheit treten etwa Phaleas von Chalkedon und Hippodamos ein. Rechtsstaatliche Gleichheit ist nach Lykophron Folge der Gesetzesherrschaft. Sie ist nach dem Anonymus Iamblichi am ehesten in der Lage, jedem das Seine zu gewähren – Gerechtigkeit durch Recht.
30 Vgl. Kersting, Wolfgang (2000): Theorien der sozialen Gerechtigkeit. Stuttgart. Hier S. 48: „Im Mittelpunkt der Gerechtigkeitstheorie des libertarianism steht maximale Handlungsfreiheit, die am besten durch den klassischen Anspruch auf den ungeschmälerten Besitz der direkten und indirekten Früchte der eigenen Arbeit, eigener Anstrengungen ausgedrückt wird … “.
31 Vgl. Parfit, Derek (2000): Gleichheit und Vorrangigkeit, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main, S. 81–106. Hier S. 86: „Für eine wirklich egalitaristische Position hat Gleichheit intrinsischen Wert, ist Gleichheit an sich gut… Dem Egalitarismus geht es um Relationen, darum, auf welchem Niveau im Vergleich zu anderen sich eine jede Person befindet“.
32 Vgl. Zum Begriff der egalitaristischen Gerechtigkeit: Krebs, Angelika (2000): Einleitung: Die neue Egalitarismuskritik im Überblick. In: dies. (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main. Hier S. 10f.
33 Dworkin, Ronald (2000): Sovereign Virtue. Cambridge/Mass. Hier S. 1.
34 Vgl. ebd. hier S. 181.
35 „When we declare our faith of liberty, we are only affirming the form in which we embrace equality, only declaring, that is, what is meant by it.“ (Ebd. hier S. 182)
36 Ebd. hier S. 130.
37 Vgl. Anderson, Elizabeth S. (2000): Warum eigentlich Gleichheit?, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik. Frankfurt am Main, S. 117–171. Hier S. 124.
38 Vgl. Rawls, John (1975): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt. Hier S. 29 und 159f.
39 Vgl. ebd. hier S. 81: „1. Jedermann soll gleiches Recht auf das das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. 2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen.“
40 Inst. 1, 1 pr., und Ulpian D 1, 1, 20 pr.
41 Auch Cicero greift diesen Gedanken auf, versteht aber den Würdeaspekt noch ganz objektiv im Sinne der „Menschheit“: „[D]ie Gerechtigkeit … schreibt vor, alle zu schonen, für das ganze Menschengeschlecht zu sorgen, jedem das Seine zukommen zu lassen, Gottgeweihtes, Öffentliches, Fremdes nicht anzutasten.“ (Cicero, Staat, III, 15, S. 241f).
42 Kant, Immanuel (1982): Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Immanuel Kant Werkausgabe, Bd. VIII. Hrsg. v. W. Weischedel. Frankfurt am Main, S. 305–499. Hier AB 44/46f., S. 345.
43 Deshalb ist auch die Würde des Menschen nicht selbst das Recht auf Freiheit, sondern das vorausliegende Recht auf Anerkennung der Freiheitsfähigkeit eines jeden Menschen. Darin unterscheidet sich meine Auffassung der Menschenwürde von derjenigen Jakls (2013, S. 101).
44 Obwohl bei ihm die Würde aus der Gerechtigkeit und nicht umgekehrt folgt: „Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann“ (Rawls 1975, S. 20).
45 Vgl. Sen, Amartya (2010): Die Idee der Gerechtigkeit. München. Hier S. 253ff.
46 Vgl. Nussbaum, Martha Craven (2010): Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Berlin. Hier S. 14f.
47 Vgl. Rawls, John (1975): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt. Hier S. 133.
48 Vgl. Nussbaum, Martha Craven (2010): Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Berlin. Hier S. 34f.
49 Ebd. hier S. 142.
50 Ebd. hier S. 42f.
51 Ebd. hier S. 227: „Die Leitidee ist daher nicht die der Würde selbst – als ob man diese von den Fähigkeiten, ein Leben zu leben, abtrennen könnte -, sondern vielmehr die eines Lebens in Würde bzw. eines menschenwürdigen Lebens, wobei dieses Leben zumindest teilweise durch den Besitz der auf der Liste zusammengestellten Fähigkeiten konstituiert wird“.
52 Ebd. hier S. 307.
53 Vgl. auch ebd. hier S. 224, 127: „Der aristotelischen Sichtweise zufolge ist der Mensch ein ‚politisches Tier‘, also nicht nur ein moralisches und politisches Wesen, sondern ein Wesen mit dem Körper eines Tieres, dessen Menschenwürde seiner tierischen Natur nicht entgegengesetzt, sondern dieser Natur und ihrer zeitlichen Entwicklungsbahn im Gegenteil inhärent ist“. Nussbaum schwankt hier ein wenig. Während sie einerseits auf die Vernunftfähigkeit als Grundlage der Würde des Menschen verzichten will (ebd., S. 143), meint sie an anderen Stellen, dass die „Würde sich nicht vollständig aus einer idealisierten Vernunft ableiten läßt“ (ebd., S. 134), also offenbar doch jedenfalls teilweise.
54 Ebd. hier S. 183.
55 Ebd. hier S. 129.
56 Ebd. hier S. 229f. und 233.
57 Vgl. ebd. hier S. 112f.
58 Vgl. Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Brief 15: „Aber was heißt denn ein bloßes Spiel, nachdem wir wissen, dass unter allen Zuständen des Menschen gerade das Spiel und nur das Spiel es ist, was ihn vollständig macht und seine doppelte Natur auf einmal entfaltet? “
59 Nussbaum, Martha Craven (2010): Die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Berlin. Hier S. 236.
60 Das sieht Nussbaum (2010, S. 263) durchaus. Damit erkennt sie also die Differenz zwischen Potentialität und Aktualität einer Fähigkeit an.
61 Vgl. Tiedemann, Paul (2012): Menschenwürde als Rechtsbegriff. Berlin. Hier S. 117ff.
62 Vögele, Wolfgang (2013): Gottebenbildlichkeit, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 158–159. Hier S. 158f.
63 Schaefer, Jan (2013): Human Dignity: A Remedy fort the Clash of Cultures? – Human Dignity and the Mind of Mencius, in: Kirste, Stephan; Brugger, Winfried: Human Dignity as a Foundation of Law. Human Dignity as a Foundation of Law. (= ARSP-Beiheft 137). Stuttgart, S. 181–192. Hier S. 180 und 186f. Kim, Hyong-Kon (2007): The Idea of Human Dignity in Korea. Lewiston/Queenston/Lampeter. Hier S. 85ff. und 170 zu buddhistischen und konfuzianistischen Würdeverständnissen etwa in Südkorea.
64 Gröschner, Rolf (2013): Entwurfsvermögen, in: ders.; Kampust, Antje; Lembcke, Oliver W. (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 330–331. Hier S. 330f.: „Entwurfsvermögen ist die Fähigkeit eines Menschen, sein Leben planen und eigener Planung gemäß gestalten zu können“.
65 Pfordten, Dietmar von der (2009): Zur Würde des Menschen bei Kant, in: ders. (Hrsg.): Menschenwürde, Recht und Staat bei Kant. Fünf Untersuchungen. Paderborn. Hier S. 9ff.
66 Vgl. Henning, Christoph (2013): Karl Marx, in: Gröschner, Rolf; Kampust, Antje; Lembcke, Oliver W. (Hrsg.): Wörterbuch der Würde. München, S. 46–47.
67 Näher hierzu Tiedemann, Paul (2012): Menschenwürde als Rechtsbegriff. Berlin. Hier S. 9ff.
68 Vgl. Kirste, Stephan (2010a): Menschenwürde im internationalen Vergleich der Rechtsordnungen, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Das Dogma der Unantastbarkeit. Eine Auseinandersetzung mit dem Absolutheitsanspruch der Würde. Tübingen, S. 175–214. Hier S. 175. Präambel der Verfassung der Republik Irland vom 1. Juli 1937: „In the name of the Most Holy Trinity, And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution“.
69 Vgl. Dreier, Horst (2004): Artikel 1, Menschenwürde, in: ders. (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar. Band 1. Tübingen. Hier Rn, 42f.
70 Vgl. Kirste, Stephan (2013a): The Human Right to Democracy as the Capstone of Law, in: Rocha, B.A.; Salgado, K.; Galuppo, M.C. unda.: Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Social Challenges in Complex Societies. Belo Horizonte, S. 103– 120. Tiedemann, Paul (2012): Menschenwürde als Rechtsbegriff. Berlin. Hier S. 71ff.
71 Zur Menschenwürde als Schutz vor Erniedrigung und „Verknechtung“ vgl. Maihofer, Werner (1968): Rechtsstaat und menschliche Würde. Frankfurt am Main. Kirste, Stephan (2010b): Die Würde des Menschen als Grundlage des Rechtsstaats, in: Kirste, Stephan; Sprenger, Gerhard (Hrsg.): Menschliche Existenz und Würde im Rechtsstaat. Beiträge zum Kolloquium für Werner Maihofer zum 90. Geburtstag. Berlin, S. 103–120. Hier S. 111ff.
72 Vgl. auch die Darstellung bei Coing, Helmut (1989): Europäisches Privatrecht. Band II. 19. Jahrhundert. Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern. München. Hier S. 284ff. in historischer und systematisch-dogmatischer Hinsicht.
73 „Darum muß der ursprüngliche Begriff der Person oder des Rechtssubjekts zusammenfallen mit dem Begriff des Menschen, und diese ursprüngliche Identität beider Begriffe läßt sich in folgender Formel ausdrücken: Jeder einzelne Mensch und nur der einzelne Mensch, ist rechtsfähig. “ (Savigny 1840, S. 239)
74 Vgl. Kelsen, Hans (2000): Was ist Gerechtigkeit. Stuttgart. Hier S. 45.
75 Schmitt, Carl (1914): Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Tübingen. Hier S. 114.
76 Kritisch zu dieser Entwicklung Dürig 1956, S. 128; er entwickelte dort die sog. „Objektformel“ der Menschenwürde, mit der er derartige Missachtungen auf den Begriff bringen wollte.
77 Arendt, Hannah (2011): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. München. Hier S. 602.
78 Dieses Recht ist den anderen Freiheitsrechten und auch einem „Recht auf Freiheit“ vorgelagert, denn es ist das Recht auf Anerkennung des rechtlichen Status eines freiheitsfähigen Wesens. Jakl (2013, S. 102) setzt daher mit der aus Kants ursprünglichem einzigen Freiheitsrecht abgeleiteten Prinzip der Menschenwürde als Recht auf Freiheit zu spät an.
79 Gerade der so fokussierte Begriff der Menschenwürde kann verhindern, dass aus ihr eine höhere Angleichung der Lebensverhältnisse und Aussichten resultiert als aus manchen egalitaristischen Theorien der Gerechtigkeit. Zu dieser Gefahr Krebs (2000), S. 32.
80 Auch Joseph Raz (2000, S. 76f.) versteht die Gleichheit als einen abgeleiteten Wert, wobei er freilich nicht die Würde des Menschen, sondern Leben, körperliche Integrität etc. anführt.
81 Die Problematik des „Brute luck“ hat also nur im Bereich, der dem freien Handeln des Einzelnen zugänglich ist, eine gerechtigkeitsrelevante Bedeutung.
82 Vgl. Kirste, Stephan (2008): Menschenwürde und Freiheitsrechte des Status Activus. Renaissancehumanismus und gegenwärtige Verfassungsdiskussion, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Des Menschen Würde: (wieder)entdeckt oder erfunden im Humanismus der italienischen Renaissance? Tübingen, S. 187ff. Hier S. 192ff. Kirste, Stephan (2013): Das Fundament der Menschenrechte, in: Der Staat, S. 119–138. Hier S. 136f.
83 Kirste, Stephan (2011a): Harter und Weicher Rechtspaternalismus unter besonderer Berücksichtigung der Medizinethik, in: JZ 2011, S. 805ff.
84 Vgl. Kirste, Stephan (2008): Menschenwürde und Freiheitsrechte des Status Activus. Renaissancehumanismus und gegenwärtige Verfassungsdiskussion, in: Gröschner, Rolf; Kirste, Stephan; Lembcke, Oliver (Hrsg.): Des Menschen Würde: (wieder)entdeckt oder erfunden im Humanismus der italienischen Renaissance? Tübingen, S. 187ff. Hier S. 191f.
85 „Mit der Umformulierung eines bekannten kantischen Satzes, demzufolge Gedanken ohne Inhalt leer sind, Anschauung ohne Begriffe aber blind sind, lässt sich daher auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie sagen, dass eine Freiheit ohne Gleichheit blind, eine Gleichheit ohne Freiheit aber leer ist“. Damit meint er, dass zum einen das „Zusammenspiel von Freiheit und Gleichheit konkretere Bedeutung im Handeln gewinnt und zum andern vor allem, dass beide Konzepte bei jeder rechtlichen Erwägung miteinander verbunden sind, da es sonst keine rechtliche Erwägung im vollen Sinne mehr wäre“. (Jakl 2009, S. 121).
86 Vgl. Platon (1993): Protagoras. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. I). Hamburg. Hier 320 dff., S. 54ff.
87 Vgl. Sattler, Martin (2002): Der Mythos des Protagoras, in: Kirste, Stephan; Waechter, Kay; Walther, Manfred (Hrsg.): Die Sophistik – Entstehung, Gestalt und Folgeprobleme des Gegensatzes von Naturrecht und positivem Recht. Stuttgart, S. 32ff. Hier S. 36.
88 Vgl. ebd. hier S. 32ff.
89 Vgl. Platon (1993): Protagoras. Übersetzt und erläutert von Otto Apelt (= Sämtliche Dialoge, Bd. I). Hamburg. Hier 320 dff., S. 54ff. Hier 322 d, S. 57f.
90 Hier S. 5 läßt den jüdisch-christlichen Gott sagen: „Wir haben dir keinen festen Wohnsitz gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen noch irgendeine besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die du selbst dir ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch und Entschluß habest und besitzest. Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selbst bestimmen. “ (Pico della Mirandola 1990, S. 5) Adam tritt in der Renaissanceliteratur zur Menschenwürde an die Stelle von Prometheus (Kondylis 2004, S. 659).
91 „Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, anderweit aber dennoch frei, da er, einmal in die Welt geworfen, für alles verantwortlich ist, was er tut. “ (Sartre 1986, S. 16)