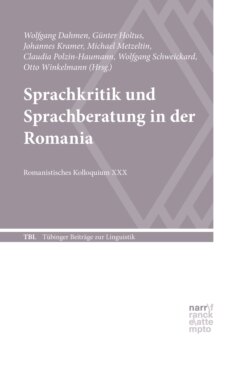Читать книгу Sprachkritik und Sprachberatung in der Romania - Группа авторов - Страница 39
1 Historischer Abriss der sprachlichen Situation im frankophonen Kanada
ОглавлениеNachdem sich die Frankophonie fast 200 Jahre lang in Nordamerika etablieren konnte – Jacques Cartier nahm die Nouvelle France 1534 für François I in Besitz –, kommt es im 18. Jahrhundert zur politischen und auch sprachlichen Abspaltung vom Mutterland. Zunächst verliert Frankreich mit dem Frieden von Utrecht 1713 nach dem Spanischen Erbfolgekrieg die Akadie an die Briten, 1763 auch den Rest der Nouvelle France. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sich Frankreich nach der Niederlage im Siebenjährigen Krieg wegen des Zuckerrohranbaus für die Kolonie Guadeloupe und gegen die Nouvelle France, und so wird denn auch der Vertrag von Paris „von den Quebeckern als ‚Verrat von Paris‘“ (Wolf 1992, 522) bezeichnet: „[La France] nous a cédé sans remords à l’Angleterre“ (Tardivel in Wolf 2009, 25). Das markiert den Beginn einer problembehafteten Beziehung zwischen ehemaliger Kolonie und Mutterland. Schon 1753 hatte Voltaire Kanada als „pays couvert de neiges et glaces huit mois de l’année, habitée par des barbares, des ours et des castors“ (Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, chapitre CLI) beschrieben. Während des Siebenjährigen Krieges beklagt er mehrfach den Einsatz Frankreichs: „On plaint ce pauvre genre humain qui s’égorge dans notre continent à propos de quelques arpents de glace en Canada“ (1757, Lettre à M. de Moncrif); „[…] j’aime mieux la paix que le Canada, et je crois que la France peut être heureuse sans Québec“ (1762, Lettre à Gabriel de Choiseul). Die Zuwanderung aus Frankreich reißt 1763 denn auch schlagartig ab, und die kanadische Frankophonie bleibt sich selbst überlassen. Nach dem Act of Union 1840, mit dem Englisch zur einigen offiziellen Sprache wurde, versuchen es die Quebecker zunächst mit der „revanche des berceaux“ – um die 10 Kinder pro Familie –, doch die (vorübergehende) zahlenmäßige Überlegenheit der Frankophonen kann gegen die wirtschaftliche und politische Dominanz der Anglophonen nur wenig ausrichten. Mit der Gründung des modernen Kanada 1867 wird die Zweisprachigkeit zwar offiziell anerkannt, die kanadische Frankophonie bleibt jedoch geprägt vom Kampf gegen die Anglophonen und vom Bruch mit dem Mutterland. Im kollektiven Gedächtnis ist man von Frankreich im Stich gelassen worden, allein gegen eine anglophone Übermacht, was explizit in „Je me souviens“ ausgedrückt ist, 1883 geprägt und seit 1939 offizielle Devise Quebecs. Sprachlich gesehen ist Quebec wie auch andere Regionen der Frankophonie von einem sprachlichen Minderwertigkeitskomplex geprägt, der im „Spannungsverhältnis zwischen dem als perfekt angesehenen Französisch Frankreichs und der eigenen, als mangelhaft empfundenen Sprachqualität“ (Wolf 1992, 523) begründet liegt. Die Wende bringt erst die Révolution tranquille der 60er und 70er Jahre, im Zuge derer sich Quebec auf seine eigene Geschichte, Kultur und Identität besinnt – „ein Emanzipationsprozess, der für das Selbstverständnis vieler Québécois einschneidend war“ (Neumann-Holzschuh 1995, 202), nicht zuletzt deshalb, weil er auch und gerade den sprachlichen Bereich betrifft:
Related to the linguistic nationalism that accompanied the Quiet Revolution of the 60s, Standard Québécois Français (a prestige variety) began to entrench itself. This movement was related to the parallel emergence of a young Québécois middle class which emerged from its traditional domination by the Catholic Church, became a confident, outward-looking society and began to compete with its Anglophone peers for control of the province’s commercial and industrial sectors. It was felt that a standard French would aid in this enterprise […] (Conrick/Regan 2007, 144).
Die Bewegung in Quebec erfasst auch andere frankophone Regionen Kanadas, insbesondere die Akadie. 1963 wird die französische Université de Moncton in Nouveau-Brunswick gegründet, 1968 in Neuschottland die FANE, die Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, „dans le but de relier entre elles les régions acadiennes dispersées de la Nouvelle-Écosse et de leur donner une organisation au niveau provincial“ (Hennemann 2014,105). 1969 erfolgt mit der Loi sur les langues officielles die Anerkennung des Französischen durch die kanadische Regierung, New Brunswick setzt die Zweisprachigkeit im selben Jahr auch auf Provinzebene durch (wobei die vollständige Umsetzung des Gesetzes erst innerhalb der folgenden acht Jahre erfolgt; vgl. Boudreau/Dubois 2001, 42), und 1977 erreicht die Parti québécois unter René Levesque mit der Loi 101, der Charte de la langue francaise, die französische Einsprachigkeit für Quebec, allerdings mit bisweilen etwas seltsam anmutenden Auswüchsen. Nicht nur müssen innerhalb von 10 Jahren alle Verkehrsschilder einsprachig französisch sein – das berühmteste Beispiel ist wohl der Ersatz von „Stop“ durch „Arrêt“ ungeachtet der Tatsache, dass es das Wort „stop“ im Französischen gibt und es von Linguisten als „französischer“ als „arrêt“ eingestuft wird –, auch in der Arbeitswelt kommt es zu massiven Konflikten. So klagt beispielsweise die Familie einer verstorbenen Patientin 1983 gegen ein Krankenhaus, weil die Patientin dort nicht zu 100 % auf Französisch betreut worden sei. Sie habe nicht „auf französisch sterben“ können. Künftig werden Arbeitnehmer im öffentlichen und halböffentlichen Bereich einem Französischtest unterzogen, was nicht zuletzt zu einem Exodus der Anglophonen führt: in nur fünf Jahren verlassen 113.000 von ihnen Quebec.1 1984 modifiziert der Oberste Gerichtshof das Gesetz zwar, die Fronten scheinen jedoch verhärtet, denn es ist abgesehen von der wirtschaftlichen Dominanz des anglophonen Teils Kanadas eben in erster Linie der englische Einfluss auf die französische Sprache und Kultur, der als Bedrohung empfunden wird (vgl. Maurais 1993, 84ff.). Und so werden die Unabhängigkeitsbestrebungen immer konkreter: 1980 kommt es zum ersten, 1995 dann zum zweiten Unabhängigkeitsreferendum. Beide scheitern zwar (knapp), es wächst sich aber ungeachtet dessen in Quebec zunehmend ein solides Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Sonderstellung der frankophonen Minderheit in Nordamerika aus, die auch vom anglophonen Kanada als solche wahrgenommen und 2006 durch die konservative Harper-Regierung offiziell bestätigt wird: „This House recognizes that the Québécois form a nation within a united Canada“.2 Darauf basierend werden die Bestrebungen, eine genuin frankokanadische Norm zu fixieren, die dem Monozentrismus Frankreichs etwas entgegenzusetzen hat, verstärkt vorangetrieben. Die Quebecker wollen endlich wie von Levesque propagiert „maîtres chez eux“ sein, wenn schon politisch als Provinz nur eingeschränkt, dann wenigstens in sprachlicher und kultureller Hinsicht.