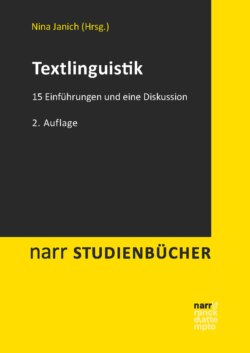Читать книгу Textlinguistik - Группа авторов - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.1 Kommunikativ-kognitive Textauffassung und textgrammatische Beschreibung
ОглавлениеGegenstand von Systemgrammatiken mit ihren Regeln der Wohlgeformtheit sind die Normen der Standardsprache – bei Coseriu (1988: 52f.) auch „exemplarische Sprache“. Diese Normen stellen eine Abstraktion bzw. Idealisierung einer „üblichen“ oder „normalen“ Realisierung dar. Sie sind weitgehend habitualisiert und konventionalisiert und können daher als Grundlage für den breiten öffentlichen Sprachverkehr betrachtet werden.
Traditionell steht die Beschäftigung mit der paroleparole mehr oder minder neben der so genannten Systemlinguistik. Diese zwei Seiten der sprachwissenschaftlichen Forschung gehen zurück auf Saussure (vgl. 1967: 20ff.), nach dessen Auffassung die rein gesellschaftliche und vom Individuum unabhängige Sprache (die languelangue) von der individuellen Seite des Sprechens (der parole) zu trennen ist. Nach dem Modell von Saussure liegt alles Regelhafte und Soziale allein in der langue, während es in der parole nichts Kollektives bzw. Soziales gibt. Die parole sei rein individuell und überdies nebensächlich und mehr oder weniger zufällig. In der Grammatiktheorie ist daher die Ansicht verbreitet, dass mit der Untersuchung des Sprachgebrauchs nur deformierende Performanzphänomene in die linguistische Forschung „eingeschleppt“ werden. Eine sprachliche Ordnung außerhalb der Systemgrammatik wird quasi ausgeschlossen.
Die strukturellen Gesetzmäßigkeiten einer Sprache ungeprüft an den präskriptiven Normen des schriftsprachlichen Standards festzumachen bedeutet aber, dass die Möglichkeit strukturell signifikanter Daten außerhalb der kodifizierten Norm von vornherein ausgeschlossen wird. Dies scheint nach mehreren Jahrzehnten variationslinguistischer Forschung nicht haltbar. Deshalb muss es auch auf der grammatischen Beschreibungsebene künftig darum gehen, Regelhaftigkeiten des Sprachgebrauchs herauszuarbeiten. Erst auf dieser Grundlage wird es möglich sein zu ermessen, ob und inwieweit der faktische Sprachgebrauch den strukturellen Gesetzmäßigkeiten einer Sprache entspricht.
Die Auswahl der sprachlichen Mittel in einer beliebigen Textsorte (= Sprachgebrauch) wird zu einem bestimmten Anteil immer der Standardnorm entsprechen. Daneben können für die Textsorten-Norm aber auch Abweichungen vom „Üblichen“, von der Standardnorm, durchaus ganz charakteristisch sein. Dies ist überall dort möglich, wo das System eine Reihe von fakultativen Realisierungsvarianten zulässt, und gilt keineswegs nur für den Bereich der MündlichkeitMündlichkeit, sondern ausdrücklich auch für zahlreiche geschrieben realisierte Textsorten wie z.B. Anzeigentexte, Kochrezepte, Lexikoneinträge usw. Das lässt den Begriff der Standardnorm in einem kritischen Licht erscheinen, und zwar aus dreierlei Gründen:
1 Es wird niemand auf die Idee kommen, etwa Lexikoneinträgen wegen des Fehlens wohlgeformter Sätze ihre Standardsprachlichkeit abzusprechen:(3–4) Oldenburger, eine Pferderasse in Dtld.; früher starkes, schweres, leistungsfähiges Zug- und Arbeitspferd; durch Einkreuzung von Englischem Vollblut und Trakehner Hengsten in den letzten Jahrzehnten Umzüchtung zu einem erfolgreichen, ausdauernden, athletischen Sportpferd. (Der Knaur. Universallexikon. Band 10. München 1991 [21993], S. 3732)
2 Insofern ist der Terminus Standardnorm irreführend. Es handelt sich vielmehr um die in Grammatiken kodifizierte Norm, die idealisiert und zur so genannten Standardnorm erhoben wurde.Es ist erkennbar, dass die standardsprachliche Norm keineswegs mit der schriftsprachlichen Norm gleichzusetzen ist, sondern lediglich mit der Norm bestimmter, nicht explizit genannter Textsorten.
3 Zuzustimmen ist auch Henn-Memmesheimer (1986: 7), dass die Auswahl der Muster, die als Standard gelten und infolgedessen Eingang in Standardgrammatiken finden, vom Standpunkt des Systems her betrachtet eher „zufällig“ ist: „Als zusammenfassende Bezeichnung der Menge der standardisierten Muster wird der Terminus Standardvarietät gewählt, um Standard zu kennzeichnen als eine – wie auch immer, unter welchen Einflüssen entstandene – Norm innerhalb des Systems deutsche Sprache.“ (Henn-Memmesheimer 1986: 7; Hervorhebungen Ch. G./F. J.)
Insofern wird immer nur ein Ausschnitt aus dem Sprachsystem dargestellt, weshalb auch die Bezeichnung Systemgrammatik im Grunde nicht korrekt ist. Voraussetzung für eine wirkliche Systemgrammatik wäre eine Analyse des Sprachgebrauchs, die auch unorthodoxe Phänomene nicht von vornherein als reine Performanzerscheinungen abtut.
Quintin schlägt deshalb vor, solche Phänomene nicht mehr nur als halbwegs tolerierbare Extensionen eines strikt gefassten Einheitsprinzips zu betrachten, „sondern als Ausdruck eines an sich offenen Systems, dessen Potenzial von den Sprechern meistens nur partiell ausgenutzt wird“ (Quintin 1993: 94). Deshalb ist es nachdrücklich zu unterstützen, wenn Coseriu eine radikale Änderung des linguistischen Untersuchungsansatzes vorschlägt, indem das Sprechen zum Maßstab für alle Manifestationen der Sprache gemacht wird:
Das Sprechen ist nicht von der Sprache her zu erklären, sondern umgekehrt die Sprache nur vom Sprechen. Das deswegen, weil Sprache konkret nur Sprechen, Tätigkeit ist und weil das Sprechen weiter als die Sprache reicht […] Daher muß unserer Meinung nach Saussures bekannte Forderung umgekehrt werden: statt auf den Boden der Sprache muß man sich von Anfang an auf den des Sprechens stellen und dieses zur Norm aller anderen sprachlichen Dinge nehmen (einschließlich der Sprache). (Coseriu 1988: 58)
Ausgangspunkt aller Überlegungen sollten also die Normen des realen Sprachgebrauchs sein, wie sie z.B. in schriftlichen wie mündlichen Textsorten gegeben sind. Die Norm einer Textsorte zeichnet sich dadurch aus, dass von den Möglichkeiten des Sprachsystems regelhaft auf eine ganz spezifische Weise Gebrauch gemacht wird.
Mit der Orientierung auf den Sprachgebrauch erhält die Grammatik nun eine pragmatische Dimension. Der Terminus PragmatikPragmatik geht zurück auf das semiotische ZeichenmodellZeichenmodell, semiotisches von Charles W. Morris (1938, dt. 1972), in dem das Verhältnis vom Zeichen zum Zeichenbenutzer thematisiert wird (siehe 5.2.1).
Thema der Pragmatik ist das, was im Sprachgebrauch die Form und/oder die Interpretation sprachlicher Äusserungen regelhaft beeinflusst kraft der Tatsache, dass Sprache in einer Situation und zur Kommunikation, zum sprachlichen Handeln mit anderen, gebraucht wird. Pragmatik hat es demgemäss immer mit dem Verhältnis sprachlicher Äusserungen zu ihrem situativen und kommunikativen Kontext zu tun. (Linke u.a. 52004: 201)
Primärer Gegenstand der Pragmatik im engeren Sinne sind die Regularitäten des kommunikativen Handelns, weshalb SprechakteSprechakt, PräsuppositionenPräsupposition, ImplikaturenImplikatur, KonversationsmaximenKonversationsmaximeKommunikationsmaximeKonversationsmaxime u.Ä. zentrale pragmalinguistische Kategorien sind (siehe 5.2.2).
Pragmatik in einem weiteren Sinne betrachtet als ihren Gegenstand übergreifend die Sprache im Gebrauch. Allerdings ist eine so verstandene Pragmatik – bedingt durch die Fixierung auf die geschriebene Sprache und damit im Zusammenhang stehende normierende Grammatikkonzeptionen – erst sehr spät als Arbeitsbereich der Linguistik akzeptiert worden. Dies hat sich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem verstärkten Interesse an der gesprochenen Sprache ganz grundlegend geändert. Ein weiter Pragmatikbegriff gilt inzwischen als Grundlage für eine an der natürlichen Sprache orientierte deskriptive Grammatik. Mehr noch: Es scheint der Weg geebnet für eine „radikale Pragmatisierung der Syntaxschreibung“ (Schlobinski 1997a: 11).
Dieser Ansatz wurde durch die so genannte modulare Auffassung maßgeblich befördert und im Rahmen des Lunder Forschungsprogramms „Sprache und Pragmatik“ entwickelt (vgl. u.a. Rosengren 1988, Fries 1988 und Motsch/Reis/Rosengren 1989). Die modulare Auffassung besagt, dass Grammatik und PragmatikPragmatik verschiedene Module (möglicherweise auch Mengen von Modulen) sind, wobei „die für das jeweilige Modul (bzw. dessen Submodule) konstitutiven Prinzipien, Einheiten und Regeln […] sich nicht auf konstitutive Prinzipien, Einheiten und Regeln des anderen Moduls reduzieren lassen“ (Motsch/Reis/Rosengren 1989: 2).
Betont wird also zunächst die Autonomie und Eigengesetzlichkeit der Module ‚Grammatik‘ und ‚Pragmatik‘:
Zugleich gibt es aber eine systematische Interdependenz zwischen ihnen, insofern einerseits die pragmatischen Funktionen mit Hilfe von grammatischen Strukturen realisiert, andererseits die grammatischen Strukturen nur als pragmatische Einheiten aktualisiert werden können. Pragmatik ohne Grammatik kann es also nicht geben. Die Grammatik ihrerseits muß kommunikativ verwendbar sein, d.h. die kommunikativen Erfordernisse erfüllen können. Untersuchung des Grammatik-Pragmatik-Verhältnisses heißt dann, die Gesetzmäßigkeiten dieser Interdependenz zu untersuchen […]. (Motsch/Reis/Rosengren 1989: 2)
Mit Oller kann davon ausgegangen werden, dass jede Theorie, die Sprache unabhängig von ihrem Gebrauch zu erklären versucht, zirkulär bleiben muss und dass also jede Betrachtung von Sprache als Kommunikationsmedium eine integrierte Theorie von Syntax, Semantik und Pragmatik erfordert, nicht bloß ein additives Hinzufügen einer pragmatischen Komponente, denn selbst bei einfachen Sätzen (Der Junge schlägt gerade den Ball.) sei ein Bezugnehmen auf die Situation unverzichtbar:
Unabhängig von der Weltkenntnis, über die der Sprecher/Hörer etwas mitteilt, existiert keine Sprachstruktur. Weder Bedeutung noch Syntax existieren in einem Vakuum, und beide zusammen existieren nicht unabhängig von Situationen. (Oller 1974: 132ff.)
In diesem Verständnis wäre Pragmatik als eher ganzheitliche Theorie zu begreifen, „welche die systemlinguistischen Fragestellungen einschliesst und sogar das Fundament für die systemlinguistischen Theorien liefert“ (Linke u.a. 52004: 206).
Eine solche Auffassung geht im Grunde zurück auf Karl Bühler (1934). Dessen pragmatische Ansätze sind, obgleich sie lange Zeit weitgehend unbeachtet blieben, bis heute richtungweisend (siehe 5.2.2). Der Vorteil einer solchen integrativen Sicht auf Grammatik, Semantik und Pragmatik ist darin zu sehen, dass somit auch die Form selbst in den Fokus gerückt und als pragmatisch determinierte Größe beschrieben werden kann.
Zusammenfassend kann festgehalten werden:
1 Textgrammatik muss empirisch fundiert sein. Ziel ist es, eine realistische Grammatik des Deutschen in geschrieben und gesprochen realisierten Textsorten vorzulegen, eine Grammatik, die den realen Sprecher/Hörer und Schreiber/Leser in den Mittelpunkt stellt und die Regelhaftigkeiten des Sprachgebrauchs in Texten/Textsorten herausarbeitet. Strukturelle Gegebenheiten der natürlichen gesprochenen Sprache sind dabei expliziter Bestandteil einer solchen Grammatik. In der Grammatik empirisch zu arbeiten heißt vor allem, sprachliche Phänomene auf der Basis eines gesicherten Datenmaterials zu beobachten und zu beschreiben. Eine empirisch kontrollierte Linguistik sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Theorie und entsprechende Theoreme und Kategorien an den Daten misst, die der Wahrnehmung zugänglich sind.
2 Textgrammatik muss eine pragmatische Grammatik sein. Das ist keineswegs selbstverständlich. Mit Recht weist Schlobinski (1997a: 11) darauf hin, dass die Erweiterung des Blicks auf komplexe pragmatische Faktoren nicht zwangsläufig ist, wie zum einen die Rezeption textlinguistisch fundierter Syntaxbeschreibungen zeigt und zum anderen die Grammatik von Weinrich (1993), in der zwar Verschriftungen gesprochener Sprache zitiert werden, aber letztlich nur als Belege für Analysen im Rahmen einer traditionellen Grammatikschreibung.
Eine pragmatisch fundierte Beschreibung grammatischer Strukturen in Texten muss sich von traditionellen textgrammatischen Ansätzen unterscheiden. Es kann nicht mehr nur um eine formale Betrachtung des Textes als transphrastischetransphrastisch Einheit gehen, nicht mehr nur darum, allgemeine oberflächenkonstituierende Merkmale von Texten zu beschreiben oder Pronominalisierungsketten als grammatischsyntaktische Bedingung der KohärenzKohärenz von Texten aufzuzeigen.
Die pragmatische Ausrichtung der Textgrammatik wird darin erkennbar sein, dass sie die in Texten und DiskursenDiskurs regelhaft verwendeten sprachlichen Strukturen zu ihrem Gegenstand erhebt und diese Strukturen mit Blick auf die kommunikativen Gegebenheiten der Äußerung analysiert. Texte werden nicht als isolierte, statische Objekte behandelt, sondern als kommunikative Entitäten. Die grammatischen Strukturen im Text sollen vor dem Hintergrund kognitiver, funktionaler und situativer Faktoren beschrieben werden. Damit legen wir der textgrammatischen Beschreibung eine kommunikativ-kognitive Textauffassung zugrunde, denn zwischen TextfunktionTextfunktion und Textstruktur besteht insofern ein enger Zusammenhang, als „die Textfunktion – zusammen mit gewissen situativen und medialen Gegebenheiten – die Textstruktur, d.h. die Gestaltung des Textes in grammatischer und thematischer Hinsicht, regelhaft bestimmt“ (Brinker 62005: 121).
Solcherart Determiniertheiten für die Grammatik an verschiedenen Texten und Textsorten nachzuweisen, muss Anliegen einer modernen Textgrammatik sein. Voraussetzung dafür ist aber ein funktionierendes Beschreibungsinstrumentarium, das den grammatischen Besonderheiten des Sprachgebrauchs, vor allem aber denen der MündlichkeitMündlichkeit gerecht wird. Ein Vorschlag für ein solches Instrumentarium soll hier im Folgenden entwickelt werden.