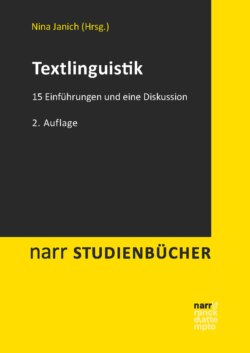Читать книгу Textlinguistik - Группа авторов - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.3 Das textgrammatische Beschreibungsinstrumentarium: Syntaktische Formen und ihr interner Bau
ОглавлениеNach der Abgrenzung syntaktischer Einheiten rückt ein nächstes, unseres Erachtens zentrales Problem in den Blickpunkt. Es gilt, die segmentierten Basiseinheiten syntaktisch zu kategorisieren, und zwar auf Grundlage der Gegebenheiten der jeweiligen Konstruktion, wie sie in der Rede konkret beobachtet werden können.
Dabei ist der Satz als eine spezifische (und dabei sicher als die idealtypische) syntaktische Form einzubeziehen, die neben anderen Formen existiert, um eine Äußerung zu tätigen.
Die Betonung liegt dabei auf dem Grundwort -form, denn da der Satz in aller Regel als syntaktische Kategorie eingeführt wird, sollte er auch primär syntaktisch definiert werden. In diesem Sinne bestimme ich den Satz als relativ selbständige grammatisch-strukturelle Einheit, die sich durch eine wohlgeformte prädikative Struktur auszeichnet. Der deutsche Satz ist zweigliedrig, nominativisch und verbal. Er besteht also im Minimalfall aus einem Verbkomplex mit finitem Verb und einer Ergänzung im Nominativ. (Jürgens 1999: 83)
Im Folgenden soll es darum gehen, Kategorien für die syntaktischen Äußerungsformen zu finden, die im Sprachgebrauch regelmäßig vorkommen, aber nicht Sätze im Sinne oben aufgeführter Definition sind. Es handelt sich vor allem um Formen, die in der Grammatik üblicherweise als Reduktionen (des vollständigen Satzes) bzw. als EllipsenEllipse behandelt werden.
Der Begriff ‚Ellipse‘ (griech. elleipein: ‚mangeln, fehlen‘) bewirkt die Vorstellung von Unvollständigkeit und meint die „Aussparung von sprachlichen Elementen, die auf Grund von syntaktischen Regeln oder lexikalischen Eigenschaften […] notwendig sind“ (Bußmann 32002: 187), die aber aus dem sprachlichen bzw. außersprachlichen Kontext regelhaft erschlossen werden können. Als Ausgangspunkt wird dabei immer eine vollständige Struktur, nämlich wiederum der wohlgeformte Satz, unterlegt.
Die GDS (Zifonun u.a. 1997: 413ff.) geht bei der Klassifizierung der Ellipsen daher von dem aus, was fehlt, und unterscheidet insgesamt drei Arten:
1 Bei der SITUATIVEN ELLIPSE fehlt ein Element der Sprechsituation, das aber aufgrund einer „gemeinsamen Vor-Orientierung von Sprecher und Hörer“ ohne weiteres erschließbar ist. Solche Situationselemente können z.B. sein:der Sprecher bzw. Hörer (Person-Ellipse): Bin fix und fertig. – Kannst jetzt gehen. – Bist gemein!;im gemeinsamen Aufmerksamkeitsbereich aktuell ablaufende Ereignisse (Ereignis-Ellipse): Könnte dir so passen! – Find ich klasse! – Hast du doch gesagt!
2 Die STRUKTUR-ELLIPSE ergibt sich aus der Reduktion grammatischer Konstruktionselemente:Ellipse der Präposition: Allianz Bonn/Moskau (Spiegel, 23.7.1990, Titel) – Gespräche Kohl – Gorbatschow;Ellipse des Kopulaverbs: Notanschluß unvermeidlich (Spiegel, 20.8.1990, S. 16) – Alles paletti;EllipseEllipse des Vollverbs: Uwe Seeler: Ich rette den HSV (BILD, 22.8.1990, S. 1) – Rekonstruktion: Uwe Seeler sagt(e)/äußert(e)…: Ich rette den HSV – Afrika vor dem Einmarsch in Liberia (taz, 14.8.1990, S. 9) – Rekonstruktion: Afrika steht/befindet sich … vor dem Einmarsch in Liberia.
3 Für die so genannten EMPRAKTISCHEN ELLIPSEN (vgl. auch Bühler 1934: 154ff.) hingegen macht es keinen Sinn, nach den weggelassenen Teilen zu fragen: Heiße Würstchen (Aufschrift an einer Würstchenbude) – Für Hunde verboten! (Schild auf einem Spielplatz) – Die Nachrichten (Ankündigung der Nachrichtensendung durch den Sprecher in Hörfunk oder Fernsehen) – Zeuge Müller (Aufruf des Zeugen vor Gericht).
Zumindest für die empraktischen Ellipsen ist es überaus fraglich, ob es sich um Reduzierungen einer vollständigen Struktur handelt. Das machen Versuche, die empraktischen Ellipsen zu vervollständigen, überaus deutlich, denn a) führen diese oft zu keinem eindeutigen Ergebnis und b) sind entsprechende Ergänzungen häufig sehr willkürlich und gezwungen.
Manchmal kommt man sich dabei wie ein dummer Schulbub oder (vielleicht richtiger gesagt) wie ein pedantischer Schulmeister vor, wenn man, wo die naive Praxis völlig unzweideutig ist, mit Satzergänzungen zu theoretisieren beginnt. (Bühler 1934: 157)
Deshalb scheint der Ellipsenbegriff insbesondere bei der Erforschung der überaus kontextverwobenen gesprochenen Sprache und darüber hinaus eigentlich in jeder satzübergreifenden Grammatikbeschreibung nicht produktiv zu sein. Eine schlüssige Argumentation zur Stützung dieser Auffassung findet sich bereits bei Bühler:
Wenn der wortkarge Kaffeehausgast ‚einen schwarzen‘ bestellt, kann er dies tun, weil in der Kaffeehaus-Situation nur noch eine Wahl zwischen den paar gleich wahrscheinlichen Getränken getroffen werden (muß) und dazu genügt das Nennwort ‚schwarz‘ oder auch die isolierte Präposition ‚ohne‘ […] Damit ist […] psychologisch alles gesagt.
Ein unbekehrbarer Anhänger der generellen Ellipsentheorie wird darauf hinweisen, daß man doch in allen Fällen einen Satz um die empraktische Nennung herumkonstruieren kann. Die Antwort lautet, das sei zwar unbestreitbar, beweise aber nichts. Denn ein sprachlich geschickter Interpret kann auch zu jeder Phase eines völlig stummen Verkehrsaktes einen mehr oder minder treffenden Text liefern; der aufgehobene rechte Arm mit dem Geld des Passagiers im Straßenbahnwagen ‚sagt‘ zum Schaffner: ‚bitte, geben Sie mir einen Fahrschein!‘
Es wäre schlimm bestellt um die mimischen Gebärden und Gesten im menschlichen Verkehr, wenn alles lautsprachlich unterbaut und adäquat lautsprachlich übersetzbar, (interpretierbar) sein müßte. Ein Elliptiker hätte den Beweis zu erbringen, daß die empraktisch verwendeten isolierten Nennungen ohne ein irgendwie mitgedachtes (vom Sender oder Empfänger mitgedachtes) Satzschema unfähig wären, als eindeutige Verkehrszeichen zu fungieren. (Bühler 1934: 157f.)
Mit Recht spricht Busse (1997: 23) von einem verbreiteten sprach- und kommunikationstheoretischen Missverständnis, dass die Funktion sprachlicher Äußerungen darin bestehe, einen zu kommunizierenden Inhalt möglichst vollständig in eine sprachliche Ausdrucksgestalt zu fassen.
Deshalb wird den hier zur Diskussion stehenden Konstruktionen von den so genannten Autonomisten der Ellipsenstatus abgesprochen. Sie werden vielmehr zunehmend als eigenständige Strukturen begriffen. Die Form sei, so wie sie im konkreten Sprechereignis vorliegt, souverän. Ausgangs- und Zielpunkt der Analyse sollte deshalb immer genau die Konstruktion sein, die tatsächlich formuliert wird. Somit wären die so genannten EllipsenEllipse ganz reguläre, abgeschlossene und vollwertige syntaktische Formen, die alternierend zum vollständigen Satz abgerufen werden können und die unter bestimmten Bedingungen angemessener sind als der Satz. Deshalb ist es nur zu unterstreichen, wenn Busse (1997: 23f.) feststellt: „Das, was üblicherweise mit dem Terminus ‚Ellipse‘ bezeichnet wird, ist – in einem weiteren Sinne verstanden – weniger der Ausnahmefall als vielmehr der Standardfall sprachlicher Kommunikation.“
Ein Verwerfen des Ellipsenbegriffs wirft allerdings zwingend die Frage nach einer Alternative auf. In der Vergangenheit sind dazu einige z. T. sehr produktive Ansätze entwickelt worden, die sich in entsprechend alternativen Termini widerspiegeln, z.B. „kompakte Strukturen“ (vgl. Werner 1994: 138), „satzwertige Äußerungen“ (vgl. u.a. Caroli 1977, Schank/Schwitalla 1980: 316 oder Lindgren 1987), „Satzäquivalente“ (vgl. Wundt 1901: 73, Schlobinski 1992: 120f. oder Jürgens 1997: 215). Insbesondere die letzteren beiden Begriffe sind geeignet zu signalisieren, dass es sich um Strukturen handelt, die dem Satz gleichwertig sind.
Gleichwertig in dem Sinne, daß der Sprecher in bestimmten Kommunikationssituationen bzw. Redekonstellationen die Möglichkeit hat, statt eines Satzes eine äquivalente Äußerungsform zu verwenden, die in gleicher Weise geeignet ist, die Intentionen des Sprechers zu realisieren und einen relativ abgeschlossenen psychischen Inhalt sprachlich zum Ausdruck zu bringen. (Jürgens 1999: 88f.)
In 3.2.2 ist bereits der Terminus der SYNTAKTISCHEN BASISEINHEIT eingeführt worden, der die Vollwertigkeit der entsprechenden Konstruktionen gar nicht erst in Frage stellt und der deshalb hier als Oberbegriff beibehalten werden soll, wenn es darum geht, die Vielfalt der möglichen Formen syntaktischer Basiseinheiten in einer begrenzten Anzahl von Kategorien zu reflektieren. Es handelt sich – wie noch zu zeigen sein wird – keineswegs um regellose oder willkürliche Strukturen, sondern um solche, die in mündlich wie schriftlich realisierten Texten regelhaft vorkommen und die klaren syntaktischen Baumustern folgen – Baumustern, die sich allerdings von den standardisierten Normen der SchriftlichkeitSchriftlichkeit sehr deutlich unterscheiden.
Der hier im Folgenden erläuterte Vorschlag einer Kategorisierung solcher Muster (vgl. Jürgens 1999: 155ff.) orientiert sich vom Zugang her an dependenziellen Grammatiken. Der Vorteil eines solchen Zugangs besteht darin, dass bisher nicht beschriebene Muster nach derselben Methode beschrieben werden können wie standardisierte Muster, denn Dependenzen lassen sich in allen Syntagmen ausmachen (vgl. Henn-Memmesheimer 1986: 26). Auch Engel weist darauf hin, dass Dependenzgrammatik nicht automatisch mit Satz- oder Verbgrammatik gleichzusetzen sei, denn das dependenzielle Prinzip erstrecke sich keineswegs nur auf den Verbalsatz:
Es kann ebensogut für Wortgruppen verschiedener Art wie für Texte angewandt werden. Und es eignet sich auch, wie mittlerweile gezeigt wurde, für Sprachen, in denen Sätze ohne Verb häufig sind. (Engel 1994: 28)
Die Strukturbeschreibung der nachfolgend aufgelisteten Einheiten erfolgt auf der Grundlage des für die jeweilige Konstruktion anzunehmenden Zentralregens. Das Zentralregens ist das die syntaktische BasiseinheitBasiseinheit, syntaktische regierende Element, von dem alle anderen Elemente abhängig sind.
Neben dem SATZ sind die folgenden Formen syntaktischer Basiseinheiten zu unterscheiden:
1. NOMINALKONSTRUKTIONEN:
Nominalkonstruktionen bestehen aus einem substantivischen Kernwort (Zentralregens) und einem oder mehreren Attributen. Sie sind also in ihrer inneren Struktur der substantivischen Wortgruppe vergleichbar, sind aber im Unterschied zu dieser nicht mittels verknüpfender Elemente als Satzglied oder Satzgliedteil in eine übergeordnete Einheit eingebunden, sondern syntaktisch selbstständig.
(3–12) Wer gegen Walkman ist, hat keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn man am Morgen in der S-Bahn sitzt und zur Schule fährt. Nur verkniffene Gesichter. Aber wenn man dann seinen Kopfhörer aufsetzt […] (T. Brussig: Wasserfarben [Roman])
(3–13) Immer erschütterndere Nachrichten über Judenverschickungen nach Polen. Sie müssen fast buchstäblich nackt und bloß hinaus. (V. Klemperer: Das Tagebuch 1933–1945)
2. PRÄPOSITIONALKONSTRUKTIONEN:
Das Wesen der Wortklasse Präposition besteht in der Fähigkeit, sprachliche Elemente miteinander zu verknüpfen. Wenn aber innerhalb der gegebenen syntaktischen Einheit kein Element existiert, zu dem die Präposition eine Relation herstellt, muss dies zu der Konsequenz führen, dass es sich nicht um eine eingebettete Präpositionalgruppe handelt, sondern um eine relativ selbstständige Einheit, deren Form durch die Präposition regiert wird. Im nachfolgenden Beispiel ist die Eigenständigkeit der Präpositionalkonstruktion durch die Interpunktion hinreichend gekennzeichnet.
(3–14) Sie hatten mir übrigens ein sehr schönes Geschenk gemacht. Sie hatten mir einen Walkman geschenkt. Mit Radio und Kassettenteil. Diese Dinger sind einmalig. (T. Brussig: Wasserfarben [Roman])
Der Autor führt den Satz (Sie hatten mir einen Walkman geschenkt.) an dieser Stelle ganz bewusst nicht weiter, sondern hebt die nachfolgende Einheit durch deren Isolierung deutlich hervor.
3. VERBALKONSTRUKTIONEN (mit Finitum):
Die Verbalkonstruktion enthält – wie der Satz – ein finites Verb, das (bei zusammengesetzten Tempora ggf. zusammen mit einem infiniten Verb) das Zentralregens der Konstruktion bildet. Allerdings wird die für einen Satz notwendige Nominativergänzung nicht realisiert. Das Vorfeld, also die Position vor dem Finitum, bleibt unbesetzt.
(3–15) August, Kurfürst von Sachsen (1553–86) […],
strenger Lutheraner;
förderte die Wirtschaft des Landes und legte den Grund für die meisten Dresdener Kunstsammlungen. (Lexikon: Der Knaur, Bd. 1, S. 380)
(3–16) Stefan Reuter gestern (.) noch mit oberschenkelproblemen lief er nur seine einsamen runden da auf’m trainingsplatz,
(4.5)
hatte letzte woche übrigens noch ein sehr freudiges ereignis (.)
ist vater geworden
Ein besonderes Problem ist in diesem Zusammenhang der zusammengezogene Satz. Wenn koordinierte Sätze ein gemeinsames Satzglied enthalten wie hier (Stefan Reuter […] lief […] seine einsamen runden und [er] hatte ein freudiges ereignis), können sie zu einem Satz zusammengezogen werden. Die relativ lange Pause von 4,5 Sekunden steht aber ganz eindeutig für eine Einheitengrenze.
4. PARTIZIPIAL- BZW. INFINITIVKONSTRUKTIONEN:
Die Partizipial- bzw. Infinitivkonstruktion unterscheidet sich von der partizipialen bzw. infinitivischen Wortgruppe – ebenso wie die Nominalkonstruktion von der Substantivgruppe – dadurch, dass sie nicht mittels verknüpfender Elemente als Satzglied oder Satzgliedteil in eine übergeordnete Einheit eingebunden, sondern syntaktisch selbstständig ist. Das Partizip bzw. der Infinitiv ist Zentralregens der gesamten Einheit.
(3–17) Andamanensee,
Meeresgebiet im NO des Indischen Ozeans,
durch die Malakkastraße mit dem Südchin. Meer (Pazifik) verbunden,
bis 4.200 m tief. (Lexikon: Der Knaur, Bd. 1, S. 218)
(3–18) Honiglimonade:
Zitronenschalen in feine Streifen schneiden und mit Zucker und Honig in einer Schüssel vermischen.
Kochendes Wasser darübergießen.
Abkühlen lassen.
Zitrone auspressen und zur Flüssigkeit dazugeben.
Alles durchsieben und in ein Glas füllen. (Kochrezept aus „Leckerbissen aus der Kinderküche“)
5. ADJEKTIVKONSTRUKTIONEN:
Zentralregens dieser Form einer syntaktischen BasiseinheitBasiseinheit, syntaktische ist ein Adjektiv. Solche Konstruktionen sind z.B. in Wettervorhersagen nicht selten anzutreffen:
(3–19) und nun das wetter für heute;
(.)
überwiegend wolkig mit einzelnen aufheiterungen –
schwach windig;
6. KONSTRUKTIONEN OHNE ZENTRALREGENS:
Konstruktionen ohne Zentralregens sind kompakte Strukturen, in denen Ergänzungen bzw. Angaben zu einem implizit gegebenen, sprachlich aber nicht realisierten semantischen Prädikat direkt zueinander in Relation stehen, ohne dass diese Relation durch ein regierendes Element vermittelt wird.
(3–20) Das Gepäck ins Haus!
Dr. Färber sofort zum Chef! (Beispiele zitiert nach Lindgren 1987: 290)
(3–21) Die Nervenfolter immer unerträglicher. Am Freitag morgen dauernde Verdunkelung befohlen. Wir sitzen eng im Keller […] (V. Klemperer: Das Tagebuch 1933–1945)
(3–22) Dahlin;
(5.5)
ja jetzt noch mal zurück auf Pflipsen
7. EINGLIEDRIGE EINHEITEN:
Der Terminus eingliedrig zielt darauf, dass die gesamte Struktur nur aus einem isolierten Element besteht, das sprachlich nicht zu einem anderen Element in Relation gesetzt wird. In der Regel handelt es sich um Einzelwörter. Auch solche Segmente können, obwohl sie sich dem traditionellen Verständnis von Syntax als der Lehre von der Verknüpfung einzelner Wörter zu komplexeren Einheiten völlig entziehen, als syntaktische BasiseinheitenBasiseinheit, syntaktische gelten, da sie formal, funktional und inhaltlich relativ abgeschlossen und eigenständig sind wie in dem folgenden Werbeslogan:
(3–23) Rittersport.
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Eingliedrige Einheiten sind auch typisch für TV-Sportreportagen, in denen der Sprecher nicht selten ausschließlich die Namen der jeweils ballführenden Spieler benennt, weil der Fernsehzuschauer deren Handlungen ja ohne weiteres selbst auf seinem Bildschirm verfolgen kann:
(3–24) Reinhardt
(2.0)
Tretschok –
(.)
Herrlich
(19.5)
Matthias Sammer
Eine Begründung für die Existenz eingliedriger Einheiten findet sich bereits bei Paul:
Damit eine Mitteilung zustande kommt, muß die durch ein Wort ins Bewußtsein gerufene Vorstellung erst an eine andere geknüpft werden. Dies geschieht in der Regel dadurch, daß mindestens ein zweites Wort hinzugefügt wird […] Allerdings kann eine Mitteilung […] auch durch das Aussprechen eines einzelnen Wortes gemacht werden. Aber auch dann muß die Vorstellung, welche die Bedeutung des Wortes ausmacht, an eine andere unausgesprochene angeknüpft werden, die durch die Situation gegeben ist. Wenn z.B. jemand den Angst- oder Hilferuf Diebe ausstößt, so will er, daß der Allgemeinbegriff Diebe mit einer von ihm in dem Augenblick gemachten Wahrnehmung in Beziehung gesetzt werde […] Es darf überhaupt nicht übersehen werden, daß zum Verstehen des Gesprochenen die Situation vieles beiträgt und daß daher der Sprechende, weil er mit der Ergänzung durch die Situation rechnet, vieles unausgesprochen läßt. (Paul 1919: 3f.)
Neben diesen Formen syntaktischer Basiseinheiten gilt es natürlich auch in einer Textgrammatik, die in komplexere Einheiten eingebetteten abhängigen Strukturen zu kategorisieren, die jeweils als Glied bzw. Gliedteil der übergeordneten Einheit fungieren. Zu diesen syntaktisch sekundären Einheiten zählen Nebensätze und eingebettete Wortgruppen wie Substantivgruppen, präpositionale, infinitivische und partizipiale Wortgruppen, wie sie in jeder traditionellen Grammatik beschrieben werden.
Allerdings können auch vermeintliche Nebensätze syntaktisch unabhängig sein und damit den Status einer syntaktischen BasiseinheitBasiseinheit, syntaktische einnehmen:
(3–25) Kohnert gratulierte. Und dann die Benjamin. Daß sie sich ja so freut und ihr weiterhin alles Gute wünscht und daß sie hofft, daß sie auch die kommenden Aufgaben so gut meistert wie bisher, und so weiter. Sie meinte es ernst. (T. Brussig: Wasserfarben [Roman])
Abschließend sei noch einmal darauf verwiesen, dass hier nur regelhaft vorkommende Strukturen einbezogen wurden, nicht aber akzidentielle, also eher zufällige Erscheinungen und Konstruktionen, die auch in der gesprochenen Sprache als Fehler angesehen werden müssen. Zum Beispiel sind Konstruktionsabbrüche bzw. -mischungen – anders als in der interaktiven Situation des Dialogs – im monologischen DiskursDiskurs in der Regel der psychischen Situation des Sprechers geschuldet und hier als gescheiterte Äußerungshandlungen und damit als defektiv anzusehen.
Allerdings können sie natürlich von einem Autor als bewusste Stilmittel eingesetzt werden, wobei dann mit der Defektivität der entsprechenden Äußerungen gespielt wird:
(3–26) Dann die Rede von Schneider. Irgendwas mit Nation war wieder dabei, und daß unsere Perspektive jetzt Konturen annimmt, und daß heute der wichtigste Tag unseres Lebens und all dieses Gewäsch. (T. Brussig: Wasserfarben [Roman])