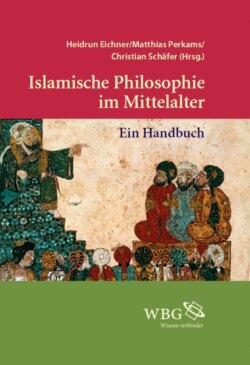Читать книгу Islamische Philosophie im Mittelalter - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Philosophie und Religion: ein neuartiges Problemfeld
ОглавлениеDas Problemfeld, auf dem das arabisch-islamische Denken philosophiegeschichtlich in besonderem Maße bedeutsam wurde, stellt das Verhältnis von Philosophie und Religion dar, das für beide Größen von Anfang an zentral war. Bedeutende Gemeinsamkeiten zwischen arabisch-islamischem und europäischem Denken ergeben sich daraus, dass die Religionen Islam, Christentum und Judentum in einigen Punkten übereinstimmen, die für das Verhältnis ebendieser Religionen zur Philosophie wichtig sind.6 Hierzu gehört zunächst einmal ein pointierter Monotheismus, der in allen drei Religionen auf die Offenbarung des einen Gottes an Abraham zurückgeführt wird. Diese Gemeinsamkeit wird im Islam dadurch betont, dass der Koran selbst die „Schriftbesitzer“ (ahl al-kitāb, wörtlich: Leute des Buches), nämlich Juden und Christen, unter besonderen Schutz stellt.7 Die Formulierung „Schriftbesitzer“ weist auf die allen drei Religionen gemeinsame Überzeugung hin, dass sich Gott nicht vollständig durch die Vernunft begreifen lässt, sondern dass an ihn so geglaubt werden muss, wie es aus einer schriftlich vorliegenden Offenbarung ersichtlich ist. Aber auch in inhaltlichen Fragen gibt es zwischen den drei Religionen philosophisch relevante Gemeinsamkeiten: Sowohl Muslime als auch Juden und Christen glauben nicht nur an einen einzigen Gott, sondern auch daran, dass dieser die Welt erschaffen hat sowie jederzeit direkt und unvermittelt in sie eingreifen kann.
Parallelen gibt es weiterhin in dem philosophischen Erbe, auf das alle drei monotheistischen Religionen zurückgriffen.8 Denn sowohl die christlich-europäische als auch die arabisch-islamische Kultur sehen sich in der Tradition der griechischen Antike, deren Selbstverständnis wesentlich durch eine philosophisch-rationale Deutung des menschlichen Lebens sowie der Wirklichkeit als ganzer geprägt war, die bereits in der Antike auf Judentum und Christentum abgefärbt hatte.9 Damit kannten alle drei Religionen den Anspruch der philosophischen Vernunft, die Welt als ganze in ihrem Verhältnis zu ihrem göttlichen Ursprung zu erklären. Sie erfuhren dabei die hieraus resultierende Spannung, die darin begründet liegt, dass eine so verstandene Philosophie strukturell unabhängig von der Offenbarungswahrheit ist und folglich geeignet, deren alleinigen Wahrheitsanspruch infrage zu stellen.
Noch vertieft wird diese Problematik dadurch, dass der Gottesbegriff der griechischen Philosophen mit demjenigen der monotheistischen Religionen nicht leicht vereinbar ist: Viele antike griechische Philosophen sprechen zwar auch von einem (höchsten) Gott, verstehen diesen aber als eine erste Ursache, welche nur gemäß bestimmten Gesetzmäßigkeiten und über mehrere Stufen, die zumindest teilweise selbst „göttlich“ genannt werden, in die Welt hineinwirken kann. Zumindest unter der, von den meisten von ihnen geteilten, Voraussetzung, dass die Verbindung von Gott und Welt ewig, notwendig und prinzipiell unveränderlich ist – weswegen eine rationale Beschreibung von ihr überhaupt möglich ist –, wirft das griechische Erbe für Denker in monotheistischen Kontexten, in denen von der Möglichkeit eines freien Eingriffs Gottes in die Welt ausgegangen wird, beträchtliche inhaltliche Probleme auf. Dies fiel bereits in der Antike dem Arzt und Philosophen Galen auf:
„Das ist nämlich das, worin sich unsere Meinung, d.h. die Platons und die der anderen bei den Griechen, die die Untersuchungen über die Natur richtig angegangen sind, von der des Mose unterscheidet: Denn ihm genügt es, dass Gott die Materie ordnen will, und sofort ist sie geordnet. Er glaubt nämlich, dass Gott alles möglich ist, selbst wenn er will, dass die Asche ein Pferd oder ein Ochse wird. Wir aber erkennen, dass das nicht so ist, sondern sagen, es gebe Dinge, die natürlicherweise unmöglich sind und dass Gott diese gar nicht erst in Angriff nimmt, sondern dass er aus dem Möglichen auswählt, dass das Beste geschieht.“10
Mit den methodischen und inhaltlichen Problemen, die aus derartigen Unterschieden resultierten, wurden die arabisch-islamischen Philosophen in einer im Vergleich zur Antike deutlich gesteigerten Schärfe konfrontiert: Denn sie waren einerseits selbst Muslime, das heißt sie erkannten den Wahrheitsanspruch einer monotheistischen Religion mit dem universalen Geltungsanspruch einer Offenbarung an. Andererseits war für sie als Philosophen letztlich nur die Vernunft, deren Prämissen sie mit ihren griechischen Vorgängern weitgehend teilten, ein angemessenes Wahrheitskriterium. Die von Galen offengelegte Spannung war also innerhalb ihrer eigenen Persönlichkeiten und Biographien vorhanden.
Zudem mussten die arabisch-islamischen Philosophen die Philosophie in einem religiösen und gesellschaftlichen Spannungsfeld definieren, das die Antike in dieser Form nicht kannte. Zwar hatte es auch in dieser Epoche philosophische Religionskritik und Repressionen gegen Philosophen aus religiösen Gründen gegeben. Insgesamt überwog aber ein Verhältnis gegenseitiger Anerkennung: Die philosophische Kritik an der Religion erwuchs aus dem Bemühen um deren rechtes Verständnis und um die, nicht zuletzt ethisch und politisch motivierte, Reinigung von irrationalen Elementen. Vielfältige religiöse Inhalte, zum Beispiel Götternamen, Kulte und Mythen, wurden von der Philosophie aufgegriffen und in einer Weise gedeutet, die eine Integration der philosophischen Lebensführung in die antike Religiosität ermöglichte.11 Dies lag unter anderem daran, dass die antiken Religionen nicht auf Offenbarungsschriften mit festgelegten Glaubenslehren und einem universal-exklusiven Geltungsanspruch beruhten, sondern sehr mannigfaltig, wandlungsfähig und für neue Elemente offen waren.12
Insofern trat die Philosophie weder als platonische Mythenkritik noch als stoische Schicksalslehre oder neuplatonische Hypostasenmetaphysik in einen direkten Gegensatz zur Religion, auch wenn ihr Verhältnis zu konkreten Formen antiker Religiosität nicht selten schwierig war. Das Ideal „Allein der Weise ist ein Priester“ einte trotzdem viele Stoiker und Platoniker.13 Selbst skeptische Philosophie und paganer Kult schlossen sich nicht unbedingt aus.14 In der Spätantike, dem unmittelbaren philosophischen Bezugspunkt der arabischen Philosophen, etablierte sich die neuplatonische Philosophie sogar als systematisches Erklärungsmodell antiker Religionen, das dem Christentum, das sich seinerseits häufig als wahre Philosophie verstand,15 zumindest eine Zeitlang Paroli bieten konnte. Trotzdem bestehende Spannungen zwischen Philosophie und Volksreligion wurden, wie schon zuvor in Aristoteles’ Metaphysik, durch die Annahme erklärt, die göttlichen Wahrheiten, welche die Philosophen rational erklärten, vermittle die Religion dem Volk durch Mythen und Symbole.16
Im Vergleich zu dieser Situation sahen sich die falāsifa, die Philosophen in der islamischen Welt, mit einem deutlich stärker akzentuierten offenbarungsreligiösen Wahrheitsanspruch konfrontiert und mussten des Verhältnis der Philosophie zu diesem bestimmen. Von Anfang an taten sie dies recht dezidiert, wobei sie an spätantike Verhältnisbestimmungen anknüpften.17 Bereits al-Kindī behauptete um 850 eine sachliche Einheit der Philosophie mit dem vom Propheten verkündeten Islam: Die Philosophen seien in der Lage, mit rationalen Mitteln dieselbe Wahrheit zu erkennen wie die Propheten, wenn auch langsamer und mit mehr Mühe. Diese harmonistische Position dürfte er auch deswegen für richtig gehalten haben, weil er das islamische Grunddogma der Einheit Gottes mithilfe neuplatonischer Ideen beschreiben und auch andere wichtige religiöse Themen philosophisch stützen konnte. So konnte er zum Beispiel für die creatio ex nihilo Argumente des christlichen Philosophen Johannes Philoponos nutzen. Al-Kindī vertrat also eine methodische Unabhängigkeit der Philosophie von religiösen Wahrheitsansprüchen, bestritt aber einen inhaltlichen Unterschied beider.18
Noch entschiedener wurde die Eigenständigkeit der Philosophie von al-Fārābī verfochten, dessen methodische und inhaltliche Überlegungen ihm den Titel eines „zweiten Lehrers“ (al-muʿallim aṯ-ṯānī) der arabischen Philosophen nach Aristoteles einbrachte. Er fasst seine Überlegungen in seiner eigenen Bearbeitung der Metaphysik, dem Buch der Buchstaben (Kitāb al-ḥurūf),19 prägnant folgendermaßen zusammen:
„Weil durch das Verfahren der apodeiktischen Beweise etwas erst im Anschluss an die Dialektik (ğadal) und die sophistischen Schlüsse gewusst wird, ist es nötig, dass diese Fähigkeiten, beziehungsweise die auf Meinung beruhende und die verfälschte Philosophie, der methodisch abgesicherten Philosophie (al-falsafa al-yaqīnīya), d.h. der apodeiktisch beweisenden (al-burhānīya), zeitlich vorangehen. Nun folgt die Religion (milla), wenn sie als menschliche verstanden wird, der Philosophie nach, sowohl zeitlich als auch überhaupt, weil sie nur zur Belehrung der großen Menge über die theoretischen und praktischen Dinge dient, welche die Philosophie erforscht, und zwar derart, dass den Menschen das Verständnis hiervon entweder durch Überredung (iqnāʿ) oder durch das Hervorrufen vorgestellter Bilder (taḫyīl) oder durch beides zugleich erreicht.“20
Auch al-Fārābī hält also daran fest, dass sich Philosophie und Religion auf dieselbe Wahrheit beziehen, aber er stellt den methodischen Vorrang der Philosophie stärker heraus: Letztlich beruht jede Religion auf einem philosophisch ermittelten Weltbild und vermittelt dieses der ungeschulten Masse der Menschen. „Die Philosophie geht der Religion auf dieselbe Weise voran, wie in der Zeit der Benutzer des Werkzeugs dem Werkzeug vorangeht.“21 Die Qualität des von einer Religion vertretenen Weltbildes hängt näherhin davon ab, ob die zugrundeliegende Philosophie selbst deduktiv-apodeiktisch bewiesen ist und daher zuverlässig die Wahrheit erfasst, oder ob sie nur auf unzuverlässigen dialektisch-topischen Schlüssen oder gar sophistischen Fehlschlüssen22 beruht. Ist die Richtigkeit einer Religion schon insofern von ihren philosophischen Voraussetzungen abhängig, so besteht zudem die Gefahr, dass die auf Überzeugung ausgerichteten Mittel, mit denen die Religion das breite Volk anspricht, zu einer weiteren Verzerrung der philosophischen Grundlage führen.
Al-Fārābī hält also auch im islamischen Kontext strikt an der antiken Idee des epistemischen Vorrangs der Philosophie, die nur wenige begreifen, gegenüber der Religion fest, die sich an das breite Volk wendet. Im Sinne seines Aristotelismus erweitert er die oben erwähnte Bemerkung aus der Metaphysik zu einer systematischen Gesamtdeutung des Verhältnisses von Philosophie und Religion.23 Religion hängt nach dieser Theorie, wenngleich sie auch gelegentlich heuristisch auf verborgene Wahrheiten hinweisen kann,24 letztlich immer von der Philosophie ab, die also selbst gegenüber einer idealen, die Wahrheit verkündenden Religion immer einen klaren methodischen Vorrang behält. Dem exklusiven Anspruch der Offenbarungsreligion Islam wird so eine elaboriertere Theorie des Vorrangs der wissenschaftlich-apodeiktischen Philosophie gegenübergestellt, als die Antike sie je gekannt hatte.
Al-Fārābī hat damit die Grundposition formuliert, von der aus sich die späteren falāsifa bis hin zu Averroes prinzipiell orientierten: „Das Wahre steht nicht im Gegensatz zum Wahren, sondern es stimmt damit überein und bezeugt es.“25 Mit dieser Maxime, die ebenfalls Aristoteles entnommen ist,26 vertraten sie im Rahmen einer monotheistischen Offenbarungsreligion einen eigenständigen philosophischen Wahrheitsanspruch, der sich zwar nur methodisch von der religiösen Verkündigung abheben sollte – die Wahrheit der islamischen Offenbarung wurde nicht bestritten –, aber zumindest in dieser Hinsicht „einen Vorrang für die Vernunft angesichts religiöser und sozialer Auseinandersetzungen beanspruchte“27. Damit wurde erstmals außerhalb des griechischen Kulturraums, und noch dezidierter als dort, der Vorrang des philosophischen Wahrheitszugangs gegenüber religiösen Ansprüchen betont.