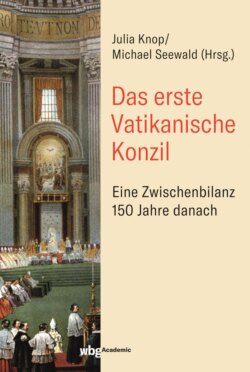Читать книгу Das Erste Vatikanische Konzil - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Franz Hettinger (1819–1890) und seine „Apologie des Christentums“
ОглавлениеFranz Hettinger galt zu Lebzeiten als einer der bedeutenden Systematiker seiner Generation: Nach der Promotion (1845) am germanischen Kolleg in Rom und einigen Jahren der Tätigkeit sowohl in der Seelsorge wie auch in der akademischen Theologie erfolgte 1852 die Ernennung zum Subregens am Würzburger Klerikalseminar. Es folgten Berufungen zum Professor der Patrologie (1857), der Apologetik und Homiletik (1867) und der Dogmatik (1884) jeweils an der Universität Würzburg, an der er zudem zweimal das Amt des Rektors ausübte. Als Konsultator wirkte er ab 1868 an der Vorbereitung des Konzils mit.1
Hettingers „Apologie des Christentums“ erschien erstmals 1863. Es handelt sich ursprünglich um eine Sammlung von Vorträgen „für Studierende aus allen Fakultäten“. Er wolle, so der Autor in seinem Vorwort, „den christlichen Glauben mit dem Ideenkreise der intelligenten Welt vermitteln, irrige Anschauungen berichtigen, und dort, wo das geistige Leben bereits zwiespältig geworden, heilend und versöhnend einwirken“.2 Das Werk erfuhr zu Lebzeiten Hettingers sechs Auflagen und nach seinem Tod vier weitere. Dieser Erfolg ist sicher zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzuführen, dass es Hettinger gelang, ein grundlegendes Bedürfnis katholischer Intellektueller in der zweiten Jahrhunderthälfte zu bedienen: In einer Zeit, in der die Divergenzen zwischen einer traditionell christlichen Weltauffassung und den inzwischen zur Verfügung stehenden weltanschaulichen Alternativen niemandem mehr verborgen blieben, betonte Hettinger, es sei „ein Gesetz im Reiche Gottes und seiner Gnade, dass aller Kampf gegen ihn und sein ewiges Werk ein Segen werden muss für die Kirche, die immer wieder neu gestärkt aus ihm hervor geht.“3 In diesem Sinne suchte er insbesondere im ersten Band seines Werks mit dem Titel „Der Beweis des Christentums“ die direkte Konfrontation mit gegnerischen Modellen, hauptsächlich mit den primären Protagonisten des seit der Jahrhundertmitte erstarkten Materialismus. Hettingers Selbstsicht als Apologet und die Erwartungshaltung der Zeitgenossen an eine katholische Apologetik ergänzten sich dabei im Ziel der vollständigen Ausräumung etwaiger Irritationen: Es handelt sich um eine klassische demonstratio christiana, die darauf ausgelegt ist, externe kritische Anfragen zugunsten des Christentums zu lösen. Das Panorama der gegnerischen Positionen, die Hettinger dabei zu Wort kommen lässt, deckt die ganze Breite der in der zweiten Jahrhunderthälfte verfügbaren Religionskritik ab: Feuerbach und Strauß, Haeckel und Büchner, Moleschott und Eduard von Hartmann werden ausgiebig zitiert und widerlegt (als Traditionsquellen dienen dabei nicht nur Augustinus und Thomas, sondern auch Bacon, Goethe und Schelling); auch Darwins „Deszendenztheorie“, von deren Unvereinbarkeit mit der christlichen Schöpfungslehre Hettinger überzeugt ist, wird ausgiebig besprochen. Da keiner dieser einzelnen Dispute hier in der gebotenen Ausführlichkeit zur Sprache kommen kann, soll im Folgenden lediglich das in den Blick genommen werden, was Hettinger seinem Werk als eine zeitdiagnostische Eröffnung voranstellt – das erste Kapitel mit dem Titel „Der religiöse Zweifel“.