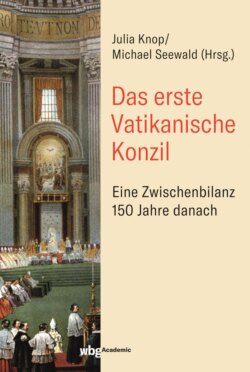Читать книгу Das Erste Vatikanische Konzil - Группа авторов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Das Ende der gewissen Gotteserkenntnis: Apologetik und Fundamentaltheologie als Diagnosen mangelnder Vermittelbarkeit
ОглавлениеSowohl der Kleutgen-Schüler und Konzilskonsultator Franz Hettinger wie auch der Dominikanertheologe Albert Maria Weiß sind, wie sich in dieser kurzen Betrachtung gezeigt hat, für überraschende Einsichten gut. An ihnen wird – unter anderem – deutlich, wie sehr sich die Wahrnehmung der Situation des Christentums in der Öffentlichkeit binnen einer Generation gewandelt hatte. Hettingers Ausgangspunkt ist das Konzept einer allein durch die historische Wirkmacht der Kirche belegten „christlichen Wahrheit“. Die darin zum Ausdruck kommende Zirkellogik – Geschichte bedeutet Bewahrheitung des Christentums, Christentum bedeutet Wahrheit in Geschichte – steht bereits dem um eine Generation jüngeren Weiß als Argumentationsbasis nicht mehr zur Verfügung. Interessanterweise kann nun Hettinger, gerade weil er seinen Ausgangspunkt für derart unangreifbar hält, die eigenen Geltungsansprüche im Anschluss bei seiner Diagnostik des „religiösen Zweifels“ eher locker handhaben. Der erste „Grund des Zweifels“ nimmt die weltanschaulichen Gegner, allen voran die Materialisten, in den Blick und macht diesen den Vorwurf, sie würden subjektive Erkenntnisse als absolut setzen und letztlich das „Gesamtgebiet der intelligiblen Welt“ durchschauen wollen (ein dem damaligen Materialismus gegenüber durchaus berechtigter Einwand)34 – der Christ dagegen sei hier bescheidener, er überlasse solche Erkenntnisfähigkeiten allein Gott und sehe in allen Dingen ein letztes und unauflösbares „Geheimnis“. Die „Gleichgültigkeit“, die als „zweiter Grund“ des Zweifels identifiziert wird, kommt der eigentlich fast trivialen, theologisch aber dennoch nicht unbedeutenden Feststellung gleich, dass der Alltag vieler Menschen keinen Raum lässt für das „Höhere“ – religiöses Empfinden, so Hettingers Standpunkt, ist keine anthropologische Konstante, sondern eine eingeprägte und immer wieder einzuübende Praxis. Die „Leidenschaft“ schließlich, die als „dritter Grund“ des Zweifels fungiert, steht im Sinne einer Zweiteilung des menschlichen Wesens für ein Überhandnehmen der „niederen“ Begierden, die für das „höhere“ Streben keinen Raum mehr lässt. Erlösen kann sich der Mensch hiervon nicht selbst – das, so Hettinger, ist Sache der Gnade.
Gut zwanzig Jahre später als Hettinger sieht sich Albert Maria Weiß bereits nicht mehr in der Lage, mit Gelassenheit auf die Situation des Christentums in den intellektuellen Debatten seiner Zeit zu blicken: Der Darwinismus ist zum Leitmodell der Naturerklärung geworden, die Religionen werden zum Gegenstand wissenschaftlich-komparativer Untersuchung, auch auf sozialem Gebiet ist der Reformdrang unübersehbar; kurz: alle althergebrachten Werte scheinen gegen Ende des Jahrhunderts außer Geltung, und mit ihnen auch der christliche Glaube. Da die Menschen aber bei allen Modernisierungstendenzen immer noch an „sich selber“ glauben, stellt Weiß seine Apologetik unter den Gedanken „des Menschen und der Menschheit“: Ohne Gott, so der Kern seines Argumentes, verfügt der Mensch über keinen Grund- und Abschlussgedanken und auch die menschlichen Sozialstrukturen, die Verfasstheit des Staates mit Rechten und Pflichten, drohen in das Extrem eines zügellosen „Libertinismus“ abzugleiten. Die altbekannte Strategie einer naturrechtlichen Letztbegründung des christlichen status quo wird auf diese Weise verbunden mit der innovativen – dabei aber noch wenig Reflexionstiefe erreichenden – Bemühung um eine anthropologische Fundierung der Theologie.
Sowohl Hettingers wie auch Weiß’ Diagnosen sind sicherlich nicht geeignet, in gegenwärtigen theologischen Diskursen Anwendung zu finden – zu obsolet sind ihre Ausgangspunkte, zu fern der historische Kontext, aus dem heraus sie ihre Überlegungen anstellen. Allerdings lässt sich abschließend ein Punkt betonen, in dem ihre Haltung auch gegenwärtigen Systematikern zumindest zu denken geben kann: Die Diagnose beider Theologen entspricht der überraschend fortschrittlich anmutenden Einsicht, dass der Glaube ein Vermittlungsproblem hat; zugleich sind sie bescheiden genug, davon auszugehen, dass sich dieses Vermittlungsproblem auch durch ihre apologetische Arbeit nicht lösen lässt. „Hat [dieses Buch]“, so schreibt Hettinger im Vorwort seines Werkes, „auch nur in einem Einzigen die Glaubensfreudigkeit gestärkt, auch nur einen Wankenden gestützt, so ist dem Verfasser der beste Lohn geworden.“35 – Man könnte es auch so formulieren: Das Faktum des „religiösen Zweifels“ und der prinzipiellen Infragestellung des Christentums ist nichts, das sich allein durch theoretische Argumentation aus der Welt schaffen lässt. Fundamentaltheologie ist daher nicht nur die Verteidigung der Inhalte des Glaubens, sondern zuvor noch die Diagnose, dass sich religiöser Glaube seit Beginn der Moderne in einer Krise befindet, der man mit einer Verteidigung der Inhalte des Glaubens meint begegnen zu müssen.
1 Vgl. Josef Hasenfuß, Hettinger, Franz, in: Neue Deutsche Biographie 9, Berlin 1972, 30f.; Johann Baptist Renninger, Prälat Hettinger. Ein Lebensbild, in: Der Katholik 77 (1890), 385–402.
2 Franz Hettinger, Apologie des Christentums. Erster Band: Der Beweis des Christentums. Erste Abtheilung, Freiburg i. Br. 61885, V.
3 Das Zitat stammt aus dem Vorwort einer im Jahr 1875 eigens publizierten Schrift gegen D. F. Strauß und sein Werk „Der alte und der neue Glaube“: Franz Hettinger, David Friedrich Strauß. Ein Lebens- und Literaturbild, Freiburg i. Br. 1875, 3.
4 Hettinger, Apologie, 6.
5 Ebd., 7.
6 Ebd., 7f. – Dass Faust zur Stillung dieses Verlangens einen Pakt mit dem Bösen eingehen musste, dürfte Hettinger bei seinen Lesern als bekannt vorausgesetzt haben.
7 Ebd., 11f.
8 Ebd., 17.
9 Ebd., 20f.
10 Ebd., 26.
11 Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg i. Br. 122008, 56.
12 Hettinger, Apologie, 30f.
13 Ebd., 41.
14 Ebd., 43.
15 Ebd., 31.
16 Natürlich kann diese knappe Konfrontation von Hettingers Thesen mit einem kurzen Ausschnitt aus „Gaudium et spes“ keine adäquate Bestimmung der Rolle des Autonomiegedankens im Kontext des II. Vaticanum erbringen. Allerdings scheint mir die generelle These, dass die Konzilstheologen des 20. Jahrhunderts das autonome Subjekt (mit bis in die Gegenwart reichenden Konsequenzen) übermäßig stark bestimmt haben, plausibel und einer weiteren Verfolgung wert.
17 Siehe hierzu Karl Josef Rivinius, Art. Weiss, Albert Maria, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon 13, Herzberg 1998, 647–652; Gallus M. Häfele, P. Albert Maria Weiß OP, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 79 (1926), 281–296. 552–567. 774–784.
18 Albert Maria Weiß, Apologie des Christentums. Erster Band: Der ganze Mensch. Handbuch der Ethik, Freiburg i. Br. 31894, 2f.
19 Ebd., 3f.
20 Ebd., 7.
21 Ebd., 8.
22 Ebd., 8.
23 Ebd., 9.
24 Ebd., 11.
25 Ebd., 12.
26 Ebd., 14.
27 Ebd., 14f.
28 Ebd., 15f.
29 Ebd., 20f.
30 Ebd., 23.
31 Ebd., 22.
32 Ebd., 25.
33 Ebd., 27.
34 Vgl. Florian Baab, Geltung und Sein. Philosophiehistorische Überlegungen in theologischer Absicht, in: Michael Seewald (Hg.), Glaube ohne Wahrheit? Theologie und Kirche vor den Anfragen des Relativismus, Freiburg i. Br. 2018, 37–55.
35 Hettinger, Apologie, VI.