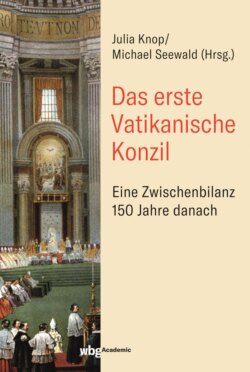Читать книгу Das Erste Vatikanische Konzil - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Der dritte Grund des Zweifels: Leidenschaft
ОглавлениеAls einen dritten „Grund des Zweifels“ identifiziert Hettinger die „Leidenschaft“: Wenn erst die „Seele der Tummelplatz geworden“ sei, „auf dem die wilden Begierden wie entfesselte Bestien einander bekämpfen und sich zerfleischen“, werde der Mensch – so Hettinger unter Berufung auf Platons „Timaios“ – „auch nur sterbliche Gedanken haben“ statt „zur Unsterblichkeit [zu] gelangen“. Hettinger betont, dass „Sinnlichkeit und Geist, Vernunft und Leidenschaft“ in jedem Menschen als widerstrebende Elemente präsent seien; er verlange daher „nicht dies […], dass der Kampf aufgehört [hat] und beendet ist zwischen dem niederen und höheren Menschen […], wohl aber dies, dass er begonnen hat, dass es der Seele einmal Ernst ist mit ihrer Selbstbefreiung“.12 Je nach der Stärke der Leidenschaften divergiere dabei die Haltung zur „Wahrheit“ des Christentums:
„Entweder fürchtet der Mensch die christliche Wahrheit, oder er wünscht sie. Je tiefer der sittliche Verfall, desto größer die Furcht und innere Abneigung, die alles aufbietet, sich der Wucht ihrer Anklagen zu entziehen. Wer sie nicht zu fürchten hat, wem sie eine Quelle höheren Lichtes, reicherer Erkenntnis und sittlicher Erhebung aufschließt, der wird emsig suchend und raschen Schrittes die Wege gehen, die zu ihr hinführen. Er ist ein Freier und die Wahrheit wird immer mehr ihn frei machen.“13
Diese innere Umkehr, die Zügelung der Leidenschaften, ist allerdings, wie Hettinger betont, dem Menschen nicht aus eigener Kraft möglich; „das vermag nur einer, Gott und seine Gnade, die in geheimnisvollem Ringen […] den lange widerstrebenden Willen überwindet“. In diesem Sinne sei „jede Rückkehr aus Zweifel und Unglaube eine Wiedergeburt, zu welcher der Mensch sich vorbereiten und mitwirken mag, die aber nur Gottes Gnade beginnt und vollendet“.14
Dem gegenwärtigen Systematiker wird angesichts dieses dritten von Hettinger genannten Punktes womöglich auffallen, dass ihm hierzu selbst nur wenig einfällt: Das Motiv der Leidenschaften und der Emotionalität ist in der systematischen Theologie seit Jahrzehnten ein nur marginal bearbeitetes, obwohl es durchaus aktuell und relevant ist – genannt sei nur das stetig virulente Thema „Missbrauch“, mit dem die Kirche mehr als andere Institutionen ein Problem zu haben scheint. Dass zur Unterbestimmung dieser Thematik auch ein überhöhtes Verständnis menschlicher Autonomie einen Beitrag geleistet haben mag, wurde bisher nur wenig gesehen. Die Väter des Zweiten Vaticanums behandeln die Leidenschaften in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“; die entsprechende Passage im Abschnitt 17 „Die hohe Bedeutung der Freiheit“ lautet:
„Die Würde des Menschen erfordert also, dass er in bewusster und freier Wahl handle, das heißt personal, von innen her bewegt und geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder unter bloßem äußerem Zwang. Eine solche Würde aber erlangt der Mensch, wenn er sich aus aller Knechtschaft der Leidenschaften befreit und so sein Ziel in freier Wahl des Guten verfolgt und sich die geeigneten Hilfsmittel wirksam und in angestrengtem Bemühen verschafft“ (DH 4317).
Eine derartige aus individueller Freiheit ermöglichte Elimination der Leidenschaften ist nun gar nicht das, was Hettinger im Sinn hat: Der Mensch kann aus seiner Sicht nur zur Erkenntnis der Notwendigkeit einer Beschränkung seiner Leidenschaften kommen; er kann sich „vorbereiten und mitwirken“, alles Weitere ist Sache der göttlichen Gnade. In keiner Weise ist es dabei das Ziel, „dass stete Stille in der Seele herrsche, […] durch keine leidenschaftliche Aufwallung getrübt“, sondern nur, dass sie nicht mehr „willenlose Sklavin finsterer Gewalten“ ist.15 Die Frage sei erlaubt: Entspricht nicht Hettingers Konzept – die Zügelung der Leidenschaften als durch den Menschen initiierter Akt göttlicher Gnade – einer theologischen Anthropologie, die in gesundem Maße sowohl Autonomie wie auch Selbstbeschränkung berücksichtigt? Hat daher die Generation der Konzilstheologen der Autonomie des Menschen, wenn es um die heikle Frage der Selbstkontrolle geht, womöglich etwas mehr zugetraut, als sie leisten kann?16