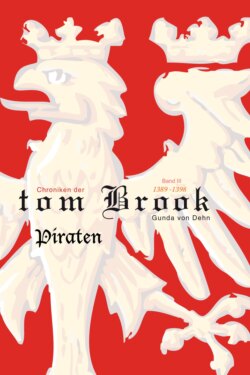Читать книгу Chroniken der tom Brook - Gunda von Dehn - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 10 - Frühjahr 1390
ОглавлениеDer Winter brachte so spärlich Schnee, dass die Wintersaat fast gänzlich erfror. Infolgedessen würde für die Sommersaat jenes Getreide als Saatgut benutzt werden müssen, welches die Familien für sich zum Essen bevorratet hatten. Gezwungenermaßen wurde allenthalben der Brotkorb höher gehängt.
Das bedeutete jedoch auch den Zukauf von Saatgetreide. Die Hanse bestimmte brutal die Preise und zog den Bauern in lang erprobter Vorgehensweise von wachsender Nachfrage und Teuerung skrupellos das Fell über die Ohren. Der Preis unterlag keiner Verhandelbarkeit mehr.
Die Wirtschaftslage verbesserte sich im Frühjahr, als das Wasser für die Schifffahrt offen war, nur wenig. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die Hanse sich mehr und mehr zur tödlichen Gegnerschaft für Brookmerland und ganz Friesland entwickelte.
Die Flotte der Hanseschiffe nahm stetig zu, so dass der Frachtanteil der Friesen kontinuierlich zurückging, da die Handelsgemeinschaft vorrangig ihre eigenen Schiffe befrachtete. Aufgrund fürstlicher Privilegien, durch welche die Hanse wertvolle Vorteile erlangte, wurden die Friesen unentwegt mit größter Schärfe aus dem Handelsgeschäft gedrängt.
Erst anderen das Geschäft ruinieren, um dann die Preise hochzuschrauben! Ein einfaches, aber wirksames Prinzip, das immer glattgeht, seit tausend Jahren und mehr.
Auch Herzog Albrecht von Bayern hatte der Hanse Privilegien nicht verweigern können, denn sie drohte mit Handelsabbruch. Das wiederum hatte die Hanse schon des Öfteren praktiziert. Jeder Fürst oder sonstige Potentat wusste, was das bedeutete. Schon vor einem Jahr, am 27. Mai 1389, hatte Herzog Albrecht deswegen die Hansen mit “vorläufigen“ Privilegien beglückt.
Um diesen Verhältnissen zu entrinnen, wäre für Widzelt im Grunde eine Mitgliedschaft im Hansebund zweckmäßig gewesen. Fürsten aber nahmen die Hanseaten nicht in ihre Gemeinschaft als Mitglieder auf, sondern nur Städte. Eine Ausnahme bildete der Deutsche Ritterorden, der aber zu den Gründern der Hanse zählte und deshalb nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden konnte, was vielen Kaufleuten ohnehin wie ein Dorn ins Auge stach.
Widzelts Territorium wurde von der Hanse als “Herrschaft“ angesehen, so dass die Türen zum Kaufmannsbund für ihn verschlossen blieben und eine Stadt gab es nicht in seinem Herrschaftsgebiet. Die Lehnherrschaft des Grafen von Holland hemmte überdies zusätzlich eine Aufnahme in den Hansebund. Wollte Widzelt den Teufelskreis durchbrechen, dann mußte er Stadtrechte verleihen. Dazu hätten sich sowohl Norden als auch Aurichhove angeboten, doch das wiederum setzte den Lehnbrief und die Billigung des Grafen voraus. Darüber hinaus: Ein mit Stadtrechten ausgestatteter Ort hätte kaum zur Einigkeit in seinem eher unruhigen Land beigetragen. Widzelt musste das aus Herrschaftsgründen hintansetzen. Allerdings bestand weiterhin ein Abkommen mit den Hamburger und Bremer Bürgermeistern und Ratsherren aus Ockos Zeiten, das die Hansischen vom Zoll befreite. Anno 1388 war es Ocko gelungen, seinen Schwager Edzard Circsena mit ins Boot zu ziehen. Hamburger Schiffe lagen damals im Hafen von Greetsiel vor Anker und hatten eigentlich Zoll zu entrichten. Somit konnte die Hanse auch in Greetsiel zollfreien Handel betreiben, was dem Ort großen Aufschwung verlieh. Ocko hatte die Interessen der Kaufleute zum Nutzen seines Landes unterstützt und dies nicht zuletzt auch im Hinblick auf Hisko Abdena und sein für Emden erwirktes Stapelrecht. (Ostfrs. Urkundenbuch Bd. III S. 37 No. 143)
Umso bitterer die sich nun zuspitzende Lage mit der Hanse. Dem entgegenzuwirken, fiel hauptsächlich Widzelt als mächtigstem Regenten zwischen Jade und Ems zu. Mit dem Tode Ockos waren viele Kauf-, Liefer- und Transportverträge zwangsläufig ungültig geworden. Diese Verträge mussten nicht nur erneuert oder verlängert werden, sondern es galt, darüber hinaus zusätzliche Handelspartner zu finden und möglichst günstige Bedingungen und Zollvorteile zu erlangen, um dabei gut bemessene Erlöse zu erwirtschaften.
Umso gewichtiger erwiesen sich die guten Handelsbeziehungen der tom Brook zum Prämonstratenser-Orden. Durch die Zusammengehörigkeit von Norder-, Brookmer- und Auricherland und Teilen der Krummhörn entfielen einige Wegezölle. Der springende Punkt aber waren die vielen Zollstationen an den Grenzen von Widzelts Beritt, die für seine Untersassen erhebliche Belastungen bei Ein- und Ausfuhr von Gütern mit sich brachten. Zum Glück genossen Widzelts Untersassen Zollprivilegien bei der Güterein- und -ausfuhr nach Holland. Widzelt strebte daher weitere Zollabkommen mit Anrainern an, wie zum Beispiel dem Bischof von Münster.
„Da bekommen wir ja weniger Einnahmen", nörgelte Keno altklug und Widzelt erklärte ihm: „Mindern sich auch unsere Zolleinkünfte, so verbilligen sich die eingeführten Waren entsprechend, was wiederum allen zugute kommt. Das ist es, was die Menschen in unserem Land bewegt."
„Ja, Widzelt, zu wissen, was unsere Untertanten bewegt, das ist der Schlüssel zur Macht", pflichtete Foelke ihm leidenschaftlich bei.
„So ist es. Am besten wäre es freilich", äußerte Widzelt vergnügt, „wenn wir die Oberhoheit gewinnen könnten."
„Oberhoheit? Wie meinst du das? Wo denn?"
„Rüstringen und Rheiderland zum Beispiel oder Harlingen jenseits der Ems."
Keno machte große Augen und senkte den Blick. Die langen Wimpern warfen Schatten auf seine hohen, hervortretende Wangenknochen und betonten dadurch die schmalen Wangen. Mit rascher Handbewegung strich er sein volles, dunkles Haar zurück. Im Unterbewußtsein registrierte Foelke diese Geste und stimmte leise seinen Ausführungen zu. Harlingen sei schwierig, aber wenn er Edo Wiemken von Rüstringen aus dem Groninger Kerker frei bekäme, schulde er Widzelt etwas. Uko Focken sei auch in ihrer Schuld, schließlich sei sein Sohn von Ocko in der Waffenkunst ausgebildet worden und beim Aufbau der Focken-Burg in Neermoor habe Ocko ihn ebenfalls unterstützt. „Es geht ihnen wirtschaftlich kaum besser als uns“, schloß Foelke. „Es käme ihnen zugute, Dir zu helfen... Locke mit Gewinnanteilen, Widzelt. Du solltest entsprechende Schritte einleiten.“
Er habe bereits Boten auf den Weg gebracht, bedeutete Widzelt der überraschten Foelke und es durchzuckte sie bohrend: Eigenmächtiges Handeln, ohne mich zu fragen? Seit wann treibt er das und mit wem alles? Was alles verschweigt er mir noch?
Sie beschloss, etwas dagegen zu unternehmen, denn, das wusste sie, würde sie ihn ungehemmt walten lassen, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann von ihrem eigenen Einfluss kein Quäntchen mehr übrig blieb. Erst einmal Befehle erteilen, dachte sie und nötigte Widzelt, bei der Eintreibung des Zehnten großzügig vorzugehen. Er möge die Vögte anweisen, bisweilen ein Auge zuzudrücken. Wer wusste denn besser als jene Männer, wo dem Bauern Not und Elend drohte?
Foelke hatte die Frauen bei der Erbsenernte gesehen. Da gab es mehr Kletten im Feld als Erbsenstauden. Das war eine elende Plackerei für die Frauen gewesen. Viele von ihnen bekamen von den Kletten juckenden Ausschlag bis hoch über die Ellenbogen. Ganz und gar nicht lustig.
Widzelt erkannte haarscharf die von Foelke angestrebten Absichten. Ha, sie will meine Macht beschneiden, dachte er belustigt. Sofort wehrte er sich, den Zins zu schmälern und wandte ein, dass die neue Zehntscheune dann nur halb gefüllt sein werde und er folglich, und weil die Ernte ohnedies zu mager sei, Getreide zukaufen müsse.
„Richtig, und wenn den Bauern nicht genügend Saatgut übrig bleibt, gibt es gar keine Ernte mehr“, stimmte Foelke ihm zu.
Widzelt stutzte zuerst und wandte dann ein, dass ihm der gekürzte Zins für andere wichtige Vorhaben fehlen werde.
Wichtige Vorhaben, dachte Foelke. Damit meint er Eroberungen, Geld für Söldner… Nein, damit ließ sie sich nicht verwirren. Geschickt schmeichelte sie ihm, dass er fraglos als milder Herrscher angesehen werde, wenn er Großmut walten lasse und man ihm umso lieber treu dienen und folgen werde – auch in den Kampf. Damit hatte sie einen empfindlichen Nerv getroffen. Nur allzu gern wollte er als „Widzelt der Gute“ betitelt werden, war doch seine bisherige Eroberungspolitik alles andere als das. Zähneknirschend gab er nach. Somit konnten aber vorerst keine neuen Deichabschnitte in Angriff genommen werden, was auch bedeutete, dass nach wie vor in großen Landesteilen Ebbe und Flut gingen, denn wer keine Dämme baut, dem rollt die Flut ins Haus. Gezwungenermaßen würde man sich auf notwendige Instandsetzungsarbeiten an den bestehenden Deichen beschränken müssen.
Ocko hatte ja bereits vor langer Zeit Lahnungen (=Schlengen) zur Uferbefestigung anlegen und sogenannte Grüppen, parallel verlaufende Gräben, ziehen lassen, um das Vorland zu entwässern. Die im Meeresboden verankerten Schlengen aus Holzpflöcken und Weidenflechtwerk fingen bei ablaufender Flut den Sand und verhinderten damit nicht nur den Sandabtrieb vom Strand, sondern hielten weitgehend jene Sedimente zurück, die von der Flut angeschwemmt wurden. Dadurch entstand Aufschlickung und Landgewinnung. Überdies dienten die Lahnungen natürlich auch dem Schutz des Bodens gegen starke Erosion bei Sturmfluten. Denn so ist die Sache: jede Flut schwemmt Schwebeteilchen ins ufernahe Watt. Wenn nämlich zur Hochwasserzeit die Strömung für kurze Zeit ruht, sinkt feines Material ab und bildet nach und nach eine Schlickschicht, auf der sich der Queller ansiedelt. So wächst das Land vor dem Deich etwa um eine Daumenbreite im Jahr an, und wenn es nicht mehr vom täglichen Hochwasser überflutet wird, fassen mehr und mehr Pflanzen Fuß. Es entstehen Salzwiesen, die als Schafweide genutzt werden können.
Foelke äußerte, dass es vielleicht sogar von Vorteil sei, das Land noch nicht einzudeichen. Das Tief hatte während der letzten Jahre einen Arm gebildet, der fast heran an Aurichhove reichte. Diesen Arm könnte man später doch als Fahrrinne nutzen, wenn er genügend ausgeschwemmt sei, meinte sie. Dem stimmte Widzelt uneingeschränkt zu. Gleiches hatten seine Räte ihm ebenfalls anempfohlen.
Und dann gab es ja noch die Buttjer, auf die man Rücksicht nehmen müsse, meinte Foelke. Buttjer, das waren Wattfischer, die ihre Reusen, viereckig angelegte Zäune aus geflochtenen Birken- und Weidenreisern von der Größe eines Zimmers, in der Emsmündung ins Watt hinein bauten und zwar von der Insel Osterende, die erst seit der letzten Sturmflut von der Insel Bant abgetrennt worden war, bis hinüber in holländische Delfszijl. In den Wänden der Reusen verfingen sich Fische aller Art, wenn das Meer zurückflutete. Jede dieser Fanggruben barg dann etliches an zappelndem Meeresgetier. Die Buttjer glitten bei Ebbe mit dem Schlickschlitten, der sogenannten Kreie, weit hinaus ins Watt, um ihre Reusen zu entleeren. Gewiß, harte Arbeit, aber welche Arbeit ist schon leicht? Da gab es weitaus üblere Dinge, die getan werden mussten. Die Buttjer aber konnten stets sicher sein, sich nicht erfolglos zu plagen, denn auf jedem dieser Schlickschlitten konnte stets ein großes Fass Fisch nach Hause befördert werden.
Das Land im Gezeitenstrom, es war ungeheuer wichtig für die Bevölkerung, denn Buttjer und Reusenfischer belegten einen wichtigen Gewerbezweig für die Versorgung der Menschen mit hochwertiger, schmackhafter Nahrung. Besonders dann, wenn das Brotgetreide schlechte Ernten hergab - wie das so häufig der Fall war – und so kostbar wurde, dass der einfache Mann sich kaum noch Brot leisten konnte.
In Rüstringen, wo Sturmfluten das Land so sehr zerrissen hatten, dass es kaum noch möglich war, Getreide anzubauen, da lebte die Bevölkerung vornehmlich von Fisch. Da sah man in der Wattlandschaft ständig ganze Familien nach Plattfisch und Krebsen grabbeln und es gab tagtäglich Meeresgetier in allen möglichen Formen: gekocht, gebraten, geräuchert, getrocknet, als Suppe, als kleingehackten Brei, in saurer Brühe mit Meerrettich, in Oel, mit Ingwer und Honig gewürzt. Häufig beinhaltete das tägliche Mahl der Armen von morgens bis abends Pfahl- oder Miesmuscheln, Austern, Fischeier und -milch. Ohne genug Salz und Würze unerträgliche Speisen. - Etliche der Austernbänke hatte noch König Knut der Große anlegen lassen. Erstaunlich, dass sie immer noch gediehen.
Wenn die Buttjer bei Ebbe mit ihren „Kreien“ den Fang einholten, fanden sie manch fette Beute im Käfig: Butt, Schellfisch, Schollen, Makrelen, Seezungen, Stinte, Krabben zu Tausenden und auch so mancher große Kabeljau verfing sich dort. Bis zur Paap, einer Sandbank in der Ems gegenüber von Delfszijl, waren die Reusen der Buttjer aufgebaut. Jede trug ein Zeichen des Besitzers und niemand stahl dem anderen den Fang oder auch nur einen Stint. Oh ja, Widzelt kannte sich dort gut aus, obwohl er – als junger Herr – von den Buttjern nicht so gern dort gesehen war, weil sie sich von ihm überwacht fühlten. Ja, das war auch so, aber er kontrollierte nicht nur die Fänge. Der Junker mochte das Treiben auf dem glitschigen Watt, sein Gären und Glucksen im warmen Sonnenschein, den eigenen Geruch nach Salz und Jod. Ganz besonders aber liebte er die wilde Rutschpartie mit der Kreie, diesem komischen Fahrzeug, das einem Hundeschlitten ohne Gespann glich.
„Vorwärts!“ hieß es. Vorwärts über den feuchten, welligen Meeresgrund, die bläulich schimmernden Watten, ehe die Flut brandend zurückkommt und mit wilden Wogen alles verschlingt. So schnell jagten die Buttfanger mit der Kreie über Rinnen und Lachen, die hoch aufspritzten, dass sie mühelos mit der Geschwindigkeit eines Pferdes hätten mithalten können.
Der Schrei der Möwen begleitete die Wattfischer und in Scharen bevölkerten Kampfhähne, Austernfischer, Brandenten und andere Meeresvögel das Watt auf der Suche nach Nahrung. Ab und zu flogen sie zeternd auf, flüchtend, wo der Mensch sich ihnen zu sehr näherte, um gleich wieder hinabzustoßen auf den reich gedeckten Tisch. Während Raubvögel sich kreischend um jene Beutefische stritten, die den Fischern zu gering schienen, dann war Widzelt in seinem Element. Das machte Spaß. Das heiße Ringen der Raubvögel um den besten Platz an der großen Festtafel, Kampf und Streit mit Schnabelhieben und Flügelschlagen. Ha, das erfreute Widzelts Herz.
War der Fang eingeholt, fanden sich die Buttjer an ihrer gemeinsamen flachbodigen Emspünte ein und luden ihre Fischkörbe dort auf. Und manchmal ging es erst heim, wenn der Mond hell am nächtlichen Himmel stand und Watt und Schlammfischer geisterhaft beleuchtete. – Zurück mit dem Schlickrutscher! Auf, auf zur Fahrt! Hei, welch höllischer Spaß! Wenn das Meer anrollte hinter dem dahinfliegenden Gefährt, wenn die windgepeitschte Flut den Männern drohte, sie zu verschlingen. Wenn auf den schwellenden Wassermassen blitzende Funken tanzten wie Millionen funkelnder Edelsteine, dann flog das Schlittengefährt über das nasse Watt nur so dahin. Der Schweiß triefte von heißen Stirnen und in atemloser Hast jagten die Männer vorwärts, stießen ihren Fuß mit gewaltiger Wucht in den Grund, um ihre Kreie vorwärts zu treiben, ständig das Rauschen der Kufen und das gurgelnde Geräusch der von hinten anrennenden Flut im Ohr.
Ein Kampf auf Leben und Tod! Da schwingt manch heimlich Gebet in den nächtlichen Himmel. Die bange Frage: „Sind wir auf dem rechten Weg? Die Rinne, das breite Loch, ich hab es nicht gesehen...“
„Wie lange bleibt uns noch, bis die Flut uns überrollt?“
„Der Boden steigt an. So sind wir am Loch vorbei.“
„Es ist die Furt. Jesus Maria sei Dank!“
Möwen lachen und kreischen im Sturmgebraus. Schon rollt schäumend die Flut um die Füße, um sogleich wieder zurückzuweichen, der Atem des Meeres…
„Eilt euch! Eilt euch! Du liebe Güte! Wir müssen zum Hilgenried!“
„Es ist noch weit! Weitab!“
„Nein, es ist ganz nah. Haltet nicht an. Weiter, weiter! Vorwärts! Nur noch zwanzig, dreißig Schritte voraus. Seht doch! Licht auf den Dünen! Das muss das Haus von Hauke sein. Nur ruhig Blut. Gleich ist das heilige Ried erreicht.“
Dann der rettende Deich – ein hell leuchtender Streifen im Mondlicht voraus. Letzte Anstrengungen. Keuchend gurgelt ein „Dem Herrn sei Dank!“ zum Himmel...
Foelke störte Widzelts Gedankengänge: „Und wenn das Land zwischen Norden und Marienhafe erst eingedeicht ist, dann könnte es doch auch möglich sein, dass in absehbarer Zeit alles versumpft“, sagte sie, aber Widzelt antwortete nicht. „Weil doch die Siele traditionsgemäß am Vorabend von St. Petri (22.2.) geschlossen und erst am Michaelistag (29.9.) wieder geöffnet werden, um das Binnenwasser abfließen zu lassen“, fuhr sie fort.
Diese Anschauung fand Widzelt äußerst drollig. Dann müsse man halt die Siele früher öffnen, rief er lachend und fügte hinzu, er werde genügend Siele bauen lassen, um ein Versumpfen zu verhindern.
Ach, wenn er so herrlich lachte, konnte sie ihm alles vergeben und vergessen.
Aber Foelke beharrte trotzdem auf ihrer Meinung, denn das koste ja alles viel Geld. Obwohl…, eigentlich hatte sie nur Furcht, dass die prächtigen Vogelschwärme wegbleiben könnten, wenn das Land eingedeicht und als Ackerland genutzt wurde.
Wenn im Frühjahr und Herbst Tausende von Zugvögeln die Salzwiesen bevölkerten, dann sah man Foelke häufig ganz still bäuchlings in dem Meer aus hohen Gräsern liegen, das sich sanft im Wind wiegte. Sie beobachtete dann Kampfläufer und Austernfischer, Sumpfohreulen und Uferschnepfen, Gänse und Enten. Besonders die Austernfischer hatten es ihr angetan. Diese Vögel beeindruckten sie. Von weitem hoben sich Augen, Beine und Schnabel rot vom schwarzen Federkleid ab. Es faszinierte sie, wie die Vögel elegant über das Watt stolzierten und mit dem leuchtenden, gebogenen Schnabel in der bizarren Wattlandschaft stocherten.
„Ich will dich vor einem Fehler bewahren“, sagte Foelke, weil sie wusste, dass Widzelt die Vogeljagd liebte.
„Einem Fehler? Ich bin der Herr! Ich mache keine Fehler.“
„Du vergisst, niemand ist unfehlbar, außer Gott…“
„Ja, und?“
„Liebst du nicht die Vogeljagd?“ Leise bedeutet sie ihm, dass er diesen reich gedeckten Tisch auf dem Vorland wohl vermissen werde, wenn dort alles zu Ackerland werde, denn dann würden die Vögel wohl bald weiter hinüber nach Holland fliegen.
Sie ist klug, dachte Widzelt und schaute ihr in die Augen, das ist es eben… „Ha, das ist wahr!“ Er strahlte sie an. „Es gibt immer eine gute Strecke und fetten Gänse- und Entenbraten auf der Tafel! Aber bis dein Prophezeiung eintritt, das dauert.“
Er hat schöne Augen, dachte sie. - Wie Ockos Augen sind sie geschnitten und auch so leuchtend… und die langen dunklen Wimpern... Blau und strahlend waren Ockos Augen… hinreißend schön, ganz besonders dann, wenn er auch noch blaue Kleider trug. Blau waren seine Augen, himmelblau und wunderschön... Dann…, oh Gott, ich träume… Wenn ich weiterhin so träume, dann werde ich heute Nacht vor lauter süßen Träumen nicht einschlafen können und... – Aber hat Widzelt je etwas Gutes getan? Sie räusperte sich und bemerkte schlicht: „So ist es. Alle haben sich damit abgefunden, wie es jetzt ist. Sie leben damit und nutzen die Vorteile der Salzwiesen. – Und…, weiß du Widzelt, bei Sturmflut richtet sich die Gewalt des Meeres ja geradewegs auf diese Deiche mit ihren Sielen, wenn sie denn fertig sind. Du liebe Güte, ich denke, die Deiche würden ohnehin gleich wieder zerstört und die Siele herausgerissen werden.“
Das könne wohl so sein, beschied Widzelt wohlwollend. Die Strömung bilde ähnliche Strudel wie ein Wirbelsturm. Man werde eine andere Lösung finden und die Siele so anlegen, dass sie nicht herausgerissen werden. Darüber hinaus stelle die Beweidung der Salzwiesen durch Schafherden einen erheblichen Wirtschaftsfaktor dar, so dass der Landverlust relativ ausgeglichen werden könne. Wichtig sei nur, dass man die Wölfe fernhalte von den Schafherden. Erst kürzlich seien in der Heide sieben seiner Schafe gerissen worden.
„Und du weißt genau, dass der Schäfer nicht nur seine Einnahmen aufbessern will?“, fragte Foelke. „Es ist ein hartes Leben auf der Heide – regenzerzaust, sonnverbrannt, hart und entbehrungsreich. Die ärmlichen Katen... Kein Wunder, dass Schäfer oft wunderlich werden in der Einsamkeit der Heide...“
Widzelt warf ihr solch einen vernichtenden Blick zu, dass sie eingeschüchtert schwieg. Was sie denn von ihm denke, hieß das. Nein, das könne er wohl unterscheiden, wer die Schafe zerrissen habe. Ob sie es mal gesehen habe, wie Wölfe die Tiere zerreissen, mit eigenen Augen, fragte er sie. Foelke verneinte das und Widzelt malte ihr blutig aus, wie schrecklich es für die Tiere ist, bei lebendigem Leibe in Stücke gerissen zu werden.
„Hör auf, hör auf damit!“ rief sie entsetzt. Der Gedanke daran verursachte plötzlich Übelkeit in ihr. „Ich will es nicht wissen, aber ich kann’s mir denken. Aber sie jagen doch nur, wenn sie Hunger haben, oder?“
„Nein, das ist ein Irrtum, wenn sie etwas ergreifen können, dann tun sie es und legen sich einen Vorrat an, der nicht selten vergammelt oder von anderen Tieren verspeist wird.“
„Früher einmal, da hat mich ein Wolfsrudel verfolgt. Es war fürchterlich, die aufgesperrten Rachen mit den riesigen gebleckten Reißzähnen so nah vor sich zu sehen, das wilde Bliffen und Blaffen zu hören. Wenn Wölfe zum Sprung ansetzen, gerät wohl jeder in Panik, auch dann, wenn er zu Pferde sitzt.“
Das bestätigte Widzelt, schaute sie prüfend an und fügte hinzu, dass sie von zierlicher Gestalt sei und ausgewachsene Wölfe nicht nur bedeutend größer, sondern auch schwerer seien als sie. Der letzte, der gefangen worden war, habe satte 115 Pfund gewogen. Durch dieses Gewicht entstehe eine gewaltige Wucht. „Jeder Mensch, den solch ein Tier anspringt, fällt um und ist rettungslos verloren“, verdeutlichte Widzelt ihr. Das gehe nicht so weiter, fuhr er verdrießlich fort. Die Wölfe hätten sich geradezu explosionsartig vermehrt. Das sei die Folge von milden Wintern und dem reich gedeckten Tisch in Wald und Flur.
„Ich weiß, in einem Wurf sind bis zu zwölf, in der Regel vier bis sechs Welpen. Und wie alt werden Wölfe? Weißt du das, Widzelt?“
„Nun ja, so genau weiß man das nicht. Man rechnet über den Daumen gepeilt 15 Jahre. Aber die meisten Tiere sterben ja schon früher.“
„Fünfzehn Jahre! Und dann alle Jahre wieder neue Welpen! Selbst, wenn die Hälfte stirbt, sind das bei uns ja jedes Jahr – ich schätze mal - mindestens 300 neue Wölfe. Und wenn man das hochrechnet, dann sind das in 15 Jahren Tausende! Ja, das geht wirklich nicht. - Du musst unbedingt mehr Jäger darauf ansetzen, Widzelt. Warum hast du das nicht schon lange getan?“ Das klang arg vorwurfsvoll.
„Ein toller Ratschlag! Wär ich gar nicht drauf gekommen“, entgegnete er ärgerlich und seufzte genervt: „Es ist nur... Wenn das so weiter geht... Der Schaden wird zu groß für uns. Die Schäfer können ihre Herden kaum noch verteidigen gegen die Wolfsrudel. Die Viecher sind schlau, gerissen und hinterhältig, sie beobachten die Schafe so lange, bis sie eine Gelegenheit für sich sehen. Gegen ein Rudel Wölfe ist ein Hütehund allein machtlos. Verbellen lassen sie sich nicht. Ich habe es selbst erlebt.“
„Und mehrere Hütehunde?“
„Kosten den Schäfer Geld und Nahrung.“
„Warum legt man keine Wolfsgruben an? Das wäre doch die richtige Lösung. Meinst du nicht auch?“
Man müsse ein lebendiges Tier in der Wolfsgrube anbinden, um Wölfe anzulocken, entgegnete Widzelt. Er habe seine Jäger angewiesen, ein Tier niemals unnötig leiden zu lassen und so was sei nachgerade nicht schmerzfrei für das Locktier.
„Du bist doch sonst nicht feinfühlend, Widzelt“, neckte sie ihn.
„Ich sag dir was, Foelke: Wenn ein Wolf seine Reißzähne in ein Tier schlägt, das ist ein blutige Angelegenheit, dann fliegen die Fetzen - Fleischfetzen, dann fließt das Blut in Strömen. Selten wird ein Tier sofort mit einem Biß in die Kehle getötet... Manche Tiere werden zuerst durch viele Bisse ins Hinterteil, die Flanken, Rücken und Nase zu Fall gebracht. Das ist ein schwerer Todeskampf, ehe Bisse in die Kehle den Tod herbeiführen. Das ist alles andere als spaßig.“
Oh ja, das wisse sie, denn der ausgestopfte Wolfskopf an der Wand habe nahezu 3 Zoll (1 Zoll = 2,54 cm) lange Fangzähne. – „Am besten ist es wohl, den Wolf direkt zu erlegen, meinst du nicht auch?“
„So viele Jäger habe ich nicht in Diensten und anderen Leuten ist es untersagt, Wild zu erlegen, dazu gehört auch der Wolf.“
„Oder... lasse Wolfsangeln schmieden und verteilen, Widzelt.“
„Was mich das alles kostet! All die gerissenen Tiere in Wald und Flur! Wir haben kaum noch Rotwild, ganz zu schweigen von Niederwild. Ich kann mir nur die Haare raufen. Wir haben ohnehin kein Geld übrig, um einen neuen Deich zu ziehen und dann auch noch das dazu. - Na ja, solange der alte Heerweg von Oldeborg nach Norden ganzjährig nutzbar ist, macht es nichts...“
Widzelts Untersassen mussten dafür Sorge tragen, dass der alte Heerweg gut in Schuss blieb. Wohl erforderte das große Anstrengungen, aber sie taten das mit Sorgfalt, denn es war – abgesehen von dem Wasserweg – die einzige Straße, um zu dem Flecken Norden zu gelangen.
Früher verlief der Weg über die Bauernsiedlungen Fehnhusen, Gent, Marienhafe und schließlich Osteel, wo schon fast das Norder Gebiet begann, weiter über Westeel zu dem Flecken Norden. Jetzt, seit die schlimme Flut von 1373 das Dorf Westeel hinweggefegt hatte, sah man bei Ebbe nur noch seine spärlichen Überreste davon im Watt schimmern. Itzo führte der Weg in gehörigem Abstand zur Leybucht zu dem Flecken Norden.
In den darauf folgenden Jahren 1374 und 1375 hatte das Meer sein zerstörerisches Werk fortgesetzt. Es schuf ein Tief bis nach Norden, wo anno 1374 die Wasser bis zum Dominikaner-Kloster vordrangen. Damals war die Gant, ein bis dahin unbedeutender, flacher Meeresarm, an welchem sich das Dorf Gent befand, umfangreich ausgespült worden. Es hatte sich dadurch ein schiffbares Tief gebildet, welches die kleine Bauernsiedlung Marienhafe zum Hafenort machte. Letzteres freilich nicht ohne kräftigen finanziellen Anteil des Landesherrn.
Hatte Widzelt sich jetzt durch vertragliche Vereinbarungen mit Herzog Albrecht von Bayern auch den Rücken freihalten können, so musste er doch anhaltend mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage seines Landes kämpfen.
Mit unsäglichem Kostenaufwand hatte Ritter Ocko seinerzeit die neue Burg in Aurichhove angelegt, was andererseits aber auch die Wirtschaft zum Erblühen gebracht, Menschen angelockt, Arbeit geschaffen und nicht zuletzt auch den Verbrauch angeschoben hatte. Diese Möglichkeit besaß Widzelt nicht mehr in dem erforderlichen Maße. Er ließ die Burganlage zwar noch weiter ausbauen und auch einige, von Ocko geschleifte, kleinere Burgen neu errichten, aber diese Maßnahmen hielten keinem Vergleich stand zu dem wirtschaftlichen Aufschwung, den Ritter Ocko hatte in Gang setzen können. Umso wichtiger war es dem Junker, den neuen Hafen zu Füssen des Doms von Sankt Marien besser auszubauen.
Der mit schräg eingerammten Bohlen abgestützte Hafen wurde nun weiter hinaus in die Fahrrinne befestigt. Um das Abbrechen der Uferränder zu verhindern, wurde eine Befestigung aus Schlengen erstellt. Zugleich ließ Widzelt auch die Kajung erweitern und vier neue Liegeplätze für Handelsschiffe schaffen. Für einen größeren Ausbau fehlten ihm aber gegenwärtig die finanziellen Mittel. Er benötigte möglichst rasch wirtschaftlichen Anschub. Die Ratsherren fanden Widzelts Maßnahmen „übereilt“ und fühlten sich hintenangesetzt. Aber er ließ nicht locker und bald wurde der neue Markt von Aurichhove ausgeläutet. An allen öffentlichen Plätzen hörte man die Handglocke der Ausrufer bimmeln, um das Volk für die amtliche Bekanntmachung zusammenzurufen. Wenn der Ansager meinte, es seien genügend Leute anwesend, betete er seine Litanei herunter:
„Kund sei allen, Zukünftigen wie Gegenwärtigen, dass ich, Widzelt, Häuptling in Brookmer-, Auricher- und Norderland, in meinem Ort Aurichhove einen Markt errichtet habe. Mit den zusammengerufenen angesehenen Kaufleuten habe ich die Vereinbarung beschworen, dass sie die Marktsiedlung ausbauen sollen.
Ich habe darob jedem Kaufmann in der Marktsiedlung eine Hausstätte zugewiesen, auf der er sein eigenes Haus errichten kann, und habe verfügt, dass mir und meinen Nachfolgern von jeder Hausstätte ein Schilling öffentlicher Münze jährlich am Martinstage zu zahlen sei.
Es sei daher jedermann kund, dass ich auf Bitten der Kaufleute folgende Rechte bewilligt habe, die in einer Niederschrift beurkundet sind, so dass sie im Gedächtnis bleiben, damit meine Kaufleute und deren Nachkommen mir und dem Hause tom Brook gegenüber dieses Privileg für alle Zeit nachweisen können.
Ich sichere in meinem Herrschaftsgebiet Frieden und sichere Reise zu all jenen, die meinen Markt aufsuchen. Wird einer von ihnen auf dieser Strecke beraubt, so werde ich, wenn er den Räuber namhaft macht, dafür Sorge tragen, dass die Beute zurückgegeben wird, oder ich selbst werde Schadenersatz leisten.
Wenn einer meiner Bürger stirbt, soll seine Frau mit den Kindern alles besitzen und frei von allen Ansprüchen behalten, was ihr Mann hinterlassen hat.
„Ha! Wer nichts weiß, muss alles glauben!“, lästerte ein Hausierer und flugs waren Büttel da, ihn zu packen. Insubordination duldete Widzelt nicht. Es entstand Aufruhr, aber der Ansager fuhr gelassen fort: „Ruhe bitte! Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Dazu komme ich noch, meine Herrschaften! – Also steht hier weiterhin geschrieben: Wenn jemand durch Mangel gezwungen ist, darf er seinen Besitz verkaufen, an wen er will. Der Käufer aber soll von der Hausstätte den festgesetzten Zins entrichten.
Unser Herr Häuptling gibt euch außerdem bekannt: Damit meine Bürger diesen Zusagen nicht etwa nur geringen Glauben schenken, habe ich durch Eid auf die Reliquien geschworen, dass ich und meine Nachfahren alle Verpflichtungen stets erfüllen werden. Amen."
Das war deutlich genug, um Ruhe zu bewirken. Rasch verstaute der Ausrufer den Erlass in seinem Mantelsack, schwang sich aufs Pferd und galoppierte zum nächsten Ort. Er war arg in Eile, hatte noch viel zu erledigen. Störende Aufenthalte konnte er sich erlauben.
Erfreulich war für Widzelt der große Zulauf, der von nun an nach Aurichhove einsetzte, denn alle diese neuen Bedingungen waren nicht nur für die Kaufleute, sondern auch für die Landbevölkerung verlockend. Zusätzlich wurde Marktfrieden gewährt und jede Untat innerhalb der Stadt oder auf dem Weg zu ihr sollte schwer geahndet werden. Aurichhove nahm erneut großen Aufschwung, erblühte zu einem großartigen Marktflecken.
Zur Fasenacht (Fastnacht), dem Tag vor Aschermittwoch, wurde in Aurichhove, genau wie anderswo auch, tüchtig gefeiert. Verkleidete Kinder und Handwerkslehrlinge zogen singend von Tür zu Tür und erbaten sich kleine Gaben, ebenso wie die Fuhrknechte mit Ochsenkarren und anderen Gefährten peitschenknallend durch die Gassen rumpelten. Meistens gab es Hedwigs, jene leckeren Heißwecken mit Rosinen, die, auf einem Teller mit heißer Milch übergossen, so unvergleichlich köstlich munden!
Die Kinder waren selig. Weniger begeistert waren sie davon, dass danach ja Aschermittwoch kam und damit die österliche Bußzeit zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern.
Foelke sorgte dafür, dass diese Zeit streng eingehalten wurde, rief ihr Gesinde zusammen und erklärte den Sinn der Fastenzeit und das in schöner Regelmäßigkeit alle Jahre wieder. Sie erinnerte eindringlich daran, dass Jesu vierzig Tage lang in der Wüste gefastet hatte, bevor er sein öffentliches Wirken begann. Auch sie mögen sich daran halten, nicht prassen, saufen und sonstwie sündigen. Die für Werktage gebotene Enthaltung von Fleischspeisen und – nicht zu vergessen – auch von Tanz und anderen Vergnüglichkeiten möge man geflissentlich einhalten, damit ihr Haus nicht in Verruf gerate. Bis zur Osternacht könne wohl jeder standhaft bleiben. Das täte auch der Gesundheit gut, sagte sie, und mancher dachte, dass es auch wohl seinem Geldbeutel gut tue.
„In der Fastenzeit seid ihr - wie alle Christen - an Verpflichtungen gebunden.“
Maulende Gesichter in der Runde. Die Leute traten ungeduldig von einem Fuß auf den anderen, auf dem Sprung, zu gehen, und Foelke sagte – nicht weniger ungeduldig: „Ich weiß, ihr kennt sie alle und trotzdem wiederhole ich es noch einmal: Verzicht auf Fleisch, Milch, Butter, Käse, Wein und Eier. Heilige Pflicht ist selbstverständlich die Mitfeier der Karwoche und des Osterfestes, Empfang des Bußsakramentes und des Altarsakraments. Ebenso möchte ich, dass ihr vermehrt gute Werke der Nächstenliebe verrichtet und großzügig Almosen gebt.“
Weil alle sehnsüchtig darauf warteten, endlich gehen zu können, entließ das Gesinde. Aber sie konnte es sich nicht verkneifen, ihnen noch rasch den Merkspruch für die sechs Sonntage der Fastenzeit hinterher zurufen: „Und denket dran! In rechter Ordnung lerne Jesu Passion:
Invocavit - Er ruft mich, darum will ich ihn erhören!
Reminiscere - Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit!
Oculi - Meine Augen sehen stets auf den Herrn.
Laetare - Freuet euch mit Jerusalem!
Judica - Gott, schaffe mir Recht!
Palmarum - Palmsonntag!”
Die Leute klapperten so laut mit ihren Holschen die Treppe hinunter, dass sie wohl kaum ein Wort verstehen konnten, aber das wollten sie ja auch gar nicht.
Foelke seufzte in Gedanken an ihre Schwester und dachte besorgt: Ach ja, Hebe wird wieder total vom Fleische fallen. Wie lange ihr Körper das wohl ertragen kann?
Wie in allen Klöstern, gab es auch es auch bei den Dominikanerinnen von Dykhusen eine zusätzliche Form des Fastens, die Xerophagia, für die Große Fastenzeit vor Ostern, und das tat ihrer Schwester gar nicht gut. Das bedeutete nämlich kompletten Nahrungsverzicht bis zur neunten Stunde (15 Uhr) und erlaubte danach nur Brot, Früchte und Wasser. Waren es auch magere Zeiten für die Klosterinsassen, so bedeutete die Fastenzeit doch andererseits eine dienliche Zeitspanne für die klösterliche Geldtruhe, denn vermittels der einträglichen Teichwirtschaft gelangte manch gutes Geldstück dort hinein.
Foelke litt hingegen kaum unter der Fastenzeit, denn ihr gewitzter Küchenmeister wich aus auf Biber und Fischotter, Schlange und Wasserschildkröte als Fastenspeise, häufig kam Kochfisch in vielen Geschmacksrichtungen auf die Tafel, Seefische und Krebse ebenso wie Teichfische, Karpfen, Forelle und Hecht. Angler und Fischer machten gute Geschäfte, aber auch jene Weidmänner und Vogelfänger, welche die zahlreichen Tierarten anboten, die in Feuchtwiesen und Sümpfen zu Hause waren.
Es schien allen Menschen durchaus einleuchtend und sinnvoll, auf Stallvieh zu verzichten, denn wegen des dürftigen Winterfutters waren die Tiere meistens ohnehin so abgemagert, dass es sich kaum auf den Beinen halten konnte. Die Fastenzeit gereichte insofern allen zum Nutzen. Wenn die Tiere in freier Natur genügend Futter fanden, erholten sie sich rasch und setzten schnell wieder Fett an. Man gönnte dem Vieh damit die nötige Zeitspanne, um wieder zu Kräften zu gelangen. Und letztlich war es auch für den Landesherrn ein Gewinn, wenn er die Pacht nicht ermäßigen mußte, weil das abgezehrte Vieh kein Geld einbrachte. Oh ja, das hatte Foelke auch schon erlebt, dass Pferde wegen Futtermangels so ausgemergelt waren, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Knechte zogen die Tiere dann mit besonderen Geschirren an starken Baumästen hoch, gerade so, dass die Hufe der Tiere noch Stand auf dem Boden fanden. In diesem Jahr jedoch würde das nicht nötig sein, weil Nerthus, die Frühlingsgöttin, die Erde bereits ergrünen ließ.
Im März kehrten dann auch wieder Störche und andere Zugvögel zurück, die gejagt werden konnten, denn auch Wildenten, Gänse und Hühnervögel waren heiß begehrt während der Fastenzeit, die genauso wie Igel, Schlangen, Frösche und Eidechsen im Kochtopf landeten. Füchse schmeckten stark nach Ammoniak und von Ratten nahm man auch gern Abstand, aber zur Not...
Foelke freute sich, denn bald scharrte das Federvieh mitsamt seiner Schar flaumiger Küken auf dem Misthaufen nach Larven und Käfern und demnächst schon würden auch die ersten Lämmer geboren werden. Welch herrliche Zeit! Zu Dutzenden prangten auf den Blütenkaskaden der Weißdornbüsche grün schillernde Rosenkäfer. Das aquamarinfarbige Blätterdach der Gehölze war noch nicht geschlossen und der Waldboden bedeckt von einem herrlich blühenden Teppich aus weißen und gelben Blüten. Jetzt war die Zeit, in der das Buschwindröschen gegen Gelenkschmerzen gesammelt wurde und auch das gelb blühende Scharbockskraut. Das tat dem Zahnfleisch gut, denn viele Menschen litten unter Zahnfleischbluten und Zahnausfall. Sogar Foelke hatte ihre Probleme damit.
Ibn, der alte Wundarzt und Apotheker meinte, das könne vom Fasten kommen und empfahl Foelke, viel rohes Obst und Gemüse zu essen, aber viel Auswahl gäbe es ja noch nicht und drum müsse sie halt das bittere Scharbockskraut kauen.
Ach ja, Ibn war grau geworden und er litt unter Heimweh nach “seinem“ Sizilien. Er würde barfuss dorthin wandern, sagte er, wenn er nur wüsste, ob von seinen Freunden und Verwandten noch jemand am Leben sei. Foelke meinte bedauernd, wenn er fortgehe, dann hätten sie ja keinen Arzt mehr, er möge doch bitte bei ihnen bleiben. Da lächelte Ibn sauer und strich sich seinen weißen Bart glatt. Der war schon fast eine Elle lang und er sah damit genauso aus, wie Foelke sich einen Druiden vorstellte. Bei diesem Anblick erinnerte sie sich: Er werde seinen Bart nicht eher kürzen, bis er wieder daheim sei, hatte Ibn einmal gesagt – mit Tränen in den Augen.
Am Sonnabend vor Cantate, dem 1. Mai, loderten die Maifeuer in ganz Ostfriesland und in jedem Dorf wurden die Mädchen von den versammelten Burschen als Mailehen ausgerufen und entweder bestimmten Burschen durch Ausrufer zugeteilt oder auch an den meistbietenden 'versteigert'.
Widzelt fand es lustig, die Preise in die Höhe zu treiben, indem er ebenfalls kräftig bot. Eine spannende und recht vergnügliche Prozedur. Die Mädchen umschwirrten ihn, waren hinter ihm her wie die Bienen hinterm Honig, denn er sah nicht nur beachtlich aus, sondern war der mächtigste Mann im Lande. Die von Widzelt ersteigerte Maibraut durfte den ganzen Sommer über mit Widzelt tanzen, so wollte es der Brauch. Das Mädchen strahlte glücklich, schmückte Widzelts Hut mit einem Strauß Frühlingsblumen und wünschte sich insgeheim, den Junker für sich erobern zu können, obgleich es doch wusste, dass es ihr kein Glück bringen würde, seine Geliebte zu werden, höchstens einen Stall voll Kinder ohne Ehemann.
Im Gegenzug setzte Widzelt einen Maien aus jungen Birken, geschmückt mit bunten Bändern, auf den Giebel ihres Vaterhauses. Es gelang ihm sogar, durchs Fenster einzusteigen und einen Strauß Maiengrün auf ihr Bett zu legen. Das stärkte ihre Hoffnung, vielleicht doch noch Herz und Hand des Junkers gewinnen zu können. Heiraten! Widzelt heiraten, gab es das überhaupt für sie? Immerhin, er hatte einem Rivalen gedroht, ihn in hauchdünne Scheiben zu schneiden, falls er ihr weiterhin nachstelle. Oh, er war schier unwiderstehlich in seinem Charme und schien ihr so hinreißend schön wie ein junger Gott.
Die Maid war recht niedlich mit ihren Grübchen und dem zauberhaften Lachen, aber Widzelts Interesse an ihr war weniger als gering. Sein Sinn stand nach seinem Kawenmädchen und weil er das momentan nicht haben konnte, streifte er mit einer Gruppe junger Leute umher, um einen Maibaum zu stehlen. Das war mit viel Spaß und noch mehr Bier verbunden. Wem es gelang, einen fremden Maibaum zu besteigen und den Wipfel abzuschneiden, der durfte den Maibaum stehlen. Die Bestohlenen durften dann vier Jahre lang keinen Maibaum mehr setzen. Aus diesem Grunde wurden alle Maibäume unerbittlich bewacht. Widzelt und seine Freunde versuchten mit vielen Tricks, die Maibaumwächter fortzulocken und auch mit Bier und Genever abzufüllen. Das aber sollte den jungen Männern diesmal nicht gelingen.
Trotzdem, es war eine herrliche Nacht, eine wirklich heilige Nacht. Von lauem Wind getragen, schwang in den frühen Morgenstunden weicher Glockenton übers Land, und als Widzelt heimkam, da wusste er, dass Foelke niedergekommen war.
Als er die Kramkammer betrat und Foelke einen wunderschönen Maienstrauß brachte, spielte bereits der Morgensonnenstrahl mit goldgleißenden Staubkörnchen und ein süßes Kinderstimmchen klang sacht aus der Wiege. Jedoch, die Überraschung war umwerfend: überglücklich und in großer Dankbarkeit präsentierte Foelke ihm ein Zwillingspärchen.
Foelke wollte das Mädchen auf den Namen Tetta taufen lassen, eine Koseform von Mechthild oder Mathilde, aber doch ein Name in der Ahnenfolge von Ockos Geschlecht, und sie dachte, dass Ocko dieses süße kleine Mädchen nun tatsächlich 'Hexlein' hätte nennen können, weil es am Walpurgistag zur Welt gekommen war. Den Knaben nannte sie Dietrich, nach Ockos Oheim Dodo Wilhelmi, dem Geistlichen, denn Dodo ist eine Koseform von Dietrich und auch Dirk oder Thirry (lat. Tirlingus), wie der Knabe später gerufen wurde.
Widzelt war gleich Feuer und Flamme dafür, dass der Knabe Geistlicher werden müsse, hatte man doch nun endlich einen Anwärter für das Norder Kirchenamt, welches der Familie seit undenklichen Zeiten zustand. Nun, da würde ja noch viel Wasser die Ems hinunter fließen, ehe das entschieden werden müsse, meinte Foelke lächelnd. Aber sie wusste auch, wie rasant der Fluss der Zeit dahinzog und wie geschwind er ihr die Kinder entziehen würde.
Im folgenden Jahr (1391) erschwerte nasses Wetter die dringend erforderlichen Deichreparaturen. Diese Notlage führte dazu, dass die Arbeiten bei Ockeweer abermals eingestellt werden mussten. Also knabberte man immer noch daran, das Siel von Ockeweer zu erneuern. Ob das gelingen würde? Die Auswaschungen am Dollart nahmen von Jahr zu Jahr zu. Immer schwieriger wurde es, Deiche zu errichten, weil das Gelände nach und nach versumpfte, unterspült und durch Sturmfluten regelrecht abgetragen wurde.
Besonders die Insel Bant in der Emsmündung litt gewaltig unter den anstürmenden Fluten. Sie wurde quasi über Nacht in mehrere Inseln zerrissen.
Das bedeutete, dass monatelange Anstrengungen in der Salzgewinnung für die Katz waren. Sämtliche Holzwannen waren mitsamt den darin gestapelten Moorplaggen waren fortgespült worden. Die Wannen dienten dazu, Moorplaggen fachgerecht anzuordnen. Letztere wurden dann laufend mit Meerwasser begossen, bis sich eine konzentrierte Salzlake gebildet hatte, die so stark war, dass ein rohes Ei darauf schwimmen konnte, ohne unterzugehen. Dann ließ man das Wasser verdunsten und zurück blieb das kostbare Meersalz. Auf diese Art und Weise brachte eine Tonne Moorplaggen 2 Pfund Salz. - Natürlich war jetzt auch die bereits gewonnene Salzlake ins Meer gespült worden. Die Salzgewinnung der Insel Bant war damit völlig zum Erliegen gekommen.
Das kam einem Gottesgericht gleich. Damit war schlagartig für viele Familien die einzige Einnahmequelle weggebrochen. Besonders bitter auch für jene armen Moorbauern, die üblicherweise die Moorplaggen anlieferten und andere Arbeiten verrichteten. Nebentätigkeiten wurden schlecht bezahlt, aber immerhin konnte man für die paar Pfennige das Nötigste erstehen.
Widzelt raufte sich die Haare. Natürlich fehlte es ihm urplötzlich an den sonst so üppig fließenden Einahmen aus dem Salzhandel.
Deutlich brach – fast nebenbei - auch der Handel mit gepökelten Lebensmitteln ein. Als böse Nebenerscheinung gab es infolge des Salzmangels und der damit einhergehenden Preiserhöhungen nun auch weniger Vorräte. Benötigt doch jeder Mensch Salz zur Würze und Konservierung von Fisch, Fleisch, Kohl und anderen Lebensmitteln. Darüber hinaus fehlte es aber auch an Viehfutter und Heizmaterial.
Bald suchte eine derart schreckliche Hungersnot die Bevölkerung heim, dass der Graf von Holland per Dekret befahl, unverzüglich Roggen und Bohnen zur Linderung der Not bereitzustellen.