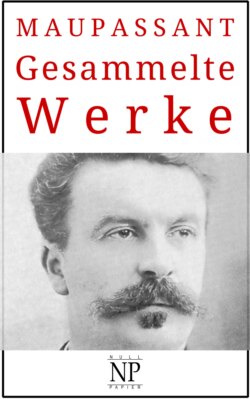Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 67
II.
ОглавлениеEin herrliches freies Leben hatte jetzt für Johanna begonnen. Sie las, träumte und trieb sich ganz allein in der Umgegend herum. Bald wandelte sie langsamen Schrittes traumverloren längs der Strasse, bald hüpfte sie wie ein junges Reh durch die zahlreichen kleinen wildromantischen Täler. Der starke würzige Duft, den die Blumen im Grase ausströmten, war ihr der liebste Parfum, und stundenlang lauschte sie, von denselben umgeben, dem einschläfernden Geräusch der in der Ferne rollenden Brandung.
Zuweilen, wenn sie bei der Biegung eines Tales plötzlich am Rande des grünen Rasenstreifens den bläulichen Schimmer des Meeres bemerkte, über welches sich ein leichter Dunstschleier lagerte, kam es über sie wie die Hoffnung auf das Nahen irgend eines geheimnisvollen Glückes.
Sie liebte die Einsamkeit in dieser süssen erquickenden Frische der Landluft mit ihrer majestätischen Ruhe. Oft sass sie so lange auf dem Gipfel eines Hügels, dass die Kaninchen ihre Furcht vergassen und sich lustig zu ihren Füssen tummelten.
Dann eilte sie wieder wie von einem leichtbeschwingten Lüftchen getragen an die Küste. Gleich den Fischen im Wasser und den Schwalben in der Luft genoss sie in vollen Zügen die Freude der freien Bewegung.
Überall brachte sie kleine Erinnerungszeichen an, jener Art von Erinnerungen, die bis zum Tode festwurzeln. Es war ihr, als versteckte sie ein Teilchen ihres eigenen Herzens an all’ den verborgenen Plätzchen dieser stillen Täler.
Mit Leidenschaft badete sie in der See; kräftig und mutig wie sie war, dachte sie an keine Furcht und tauchte häufig tief unter. Das klare blaue Wasser, welches sie schaukelnd auf seinem Rücken trug, tat ihr mit seiner erquickenden Frische unendlich wohl. War sie weit genug vom Ufer, so legte sie sich auf den Rücken, kreuzte die Arme über der Brust und starrte traumverloren zum azurfarbenen Himmel empor, an dem pfeilschnell die Schwalben oder weiße Möven vorüberschossen. Nur von Weitem hörte sie das Murmeln der Wellen am Strande und das unbestimmte Geräusch des vom Wasser gestreiften Kieses. Dann drehte sie sich oft rasch um und teilte jauchzend mit kräftigen Armen die Flut.
Hin und wieder, wenn sie sich allzu weit vorgewagt hatte, fuhr wohl ein Fischer mit seiner Barke heraus, sie zurückzuholen.
Bleich vor Hunger, aber erleichtert und gekräftigt, ein Lächeln auf den Lippen und mit einem Strahl des Glückes in den Augen kehrte sie dann ins Schloss zurück.
Der Baron seinerseits war mit großen landwirtschaftlichen Unternehmungen beschäftigt. Er wollte neue Versuche anstellen, Verbesserungen einführen, neue Maschinen anschaffen, seinen Viehbestand durch fremde Rassen vervollkommnen. Einen Teil des Tages brachte er in Gesprächen hierüber mit seinen Pächtern und Nachbarn zu, welche meistens ungläubig zu seinen Plänen mit den Achseln zuckten.
Zuweilen fuhr er auch mit den Fischern von Yport auf die See. Nachdem er die Grotten, Quellen und Hügel der Umgebung hinreichend kennen gelernt hatte, wollte er auch ’mal wie ein einfacher Fischer richtig fischen.
Wenn eine günstige Brise wehte, wenn die Barke mit geblähtem Segel über die Wogen dahin zog und auf jeder Seite über den Meeresgrunde die große Leine schleppte, der die Scharen von Makrelen folgen, dann hielt er mit aufgeregt zitternder Hand die kleine Schnur, deren Zucken sofort anzeigt, dass ein gefangener Fisch zappelt.
Im Mondschein fuhr er aus, um die Netze aufzunehmen, die man tags zuvor ausgeworfen hatte. Er ergötzte sich an dem Knarren des Mastes und erquickte sich an dem frischen kühlenden Hauche des Nachtwindes. Wenn er dann lange gekreuzt hatte, um die Bojen wieder aufzufinden, indem er sich nach einer Felsspitze, nach dem Dache eines Kirchturms und dem Leuchtturm von Fecamp einrichtete, machte es ihm ein Hauptvergnügen, das erste Aufleuchten der Sonne zu betrachten, deren Strahlen den schleimigen Rücken der Rochen und den fetten Bauch der Seezungen auf dem Boden der Barke vergoldeten.
Bei jeder Rückkehr erzählte er aufs Neue mit Begeisterung von seinen Ausfahrten. Mütterchen ihrerseits schilderte dann, wie vielmal sie die lange Pappel-Allee auf- und abgegangen sei. Sie hatte die zur Rechten nach dem Pachthof der Couillards zu gewählt, weil die andere links nicht sonnig genug war.
Weil man ihr empfohlen hatte, einen »richtigen Spaziergang« zu machen, war sie ganz erpicht darauf. Sobald die frische Morgenluft etwas nachgelassen hatte, stieg sie, auf Rosaliens Arm gestützt, die Treppe hinab, in einen Mantel und zwei Shawls gehüllt, auf dem Kopfe einen dichten Hut, über den sie noch ein rotes Tuch geschlagen hatte. Dann begann sie eine endlose Reise auf gerader Linie immer zwischen der Umzäunung des Schlosshofes und den ersten Sträuchern des Bosquets. Den linken Fuss, der etwas angeschwollener war, schleppte sie hierbei nach, und es hatten sich in Folge dessen auf der ganzen Strecke des Weges zwei Streifen gebildet, der eine vom Hin- und der andere vom Zurückgehen, auf denen das Gras völlig abgestorben war. An jedem Ende dieser Promenade hatte sie eine Bank anbringen lassen, und alle fünf Minuten machte sie Halt, indem sie zu ihrer guten geduldigen Begleiterin sagte: »Wir wollen uns setzen, liebes Kind, ich bin etwas müde.«
Und bei jedem Halt legte sie auf eine der Bänke bald das Kopftuch ab, bald einen Shawl, dann den anderen, ferner den Hut und schliesslich den Mantel, sodass Rosalie auf ihrem freigebliebenen Arm ein ganz ansehnliches Packet zu tragen hatte, bis man zum Frühstück ins Schloss zurückkehrte.
Nachmittags begann die Baronin ihren Spaziergang aufs Neue, nur etwas weniger hastig und mit grösseren Ruhepausen. Sie legte hin und wieder wohl auch ein Schlummerstündchen ein, welches sie auf einer Chaiselongue verbrachte, die man nach draussen gerollt hatte.
Sie nannte das »ihre Übung« machen, wie sie auch stets von »ihrer Hypertrophie« sprach.
Vor zehn Jahren hatte sie einen Arzt wegen ihrer Beklemmungen gefragt, und dieser hatte jenes Wort zum ersten Male gebraucht. Ohne den Ausdruck richtig zu verstehen, hatte sie seitdem sich das Wort »Hypertrophie« völlig zu eigen gemacht. Hartnäckig ließ sie den Baron, ihre Tochter und Rosalie nach ihrem Herzen fühlen, dessen Schlag niemand mehr entdecken konnte; so sehr war es durch die Fettbildung ihres Oberkörpers verdeckt. Dagegen lehnte sie es energisch ab, sich von einem zweiten Arzte untersuchen zu lassen, aus Furcht, dieser könnte irgend ein anderes Übel entdecken. So blieb sie dabei, jederzeit von »ihrer« Hypertrophie zu sprechen, sodass man glauben konnte, es sei dies ihre besondere Krankheit, ihre Spezialität sozusagen, auf die niemand anderes ein Anrecht hätte.
Der Baron sagte »die Hypertrophie meiner Frau« und Johanna sprach von »Mamas Hypertrophie«, wie wenn man von den Kleidern, Hüten oder dem Regenschirm der Baronin gesprochen hätte.
Sie war in ihrer Jugend sehr hübsch und schlanker wie ein Schilfrohr gewesen. Nachdem sie der Reihe nach mit allen Waffengattungen des Kaiserreiches getanzt hatte, las sie eines Tages »Corinne«, worüber sie zu Tränen gerührt wurde. Von da an stand sie ganz unter dem Einflusse dieses Romans.
In dem Masse wie ihre Taille an Umfang zunahm, wurde der Schwung ihrer Seele immer poetischer. Je mehr ihre Fettleibigkeit sie an das Polster fesselte, umso häufiger schwelgte ihre Fantasie in allerlei zärtlichen Abenteuern, deren Heldin sie war. Einige derselben wurden von ihr besonders bevorzugt und kehrten in ihren Träumereien öfters wieder, wie ein Musikstück, dessen Melodie einem unaufhörlich durch den Kopf summt. Alle die blumenreichen Romanzen, in denen von Gefangenen und Schwalben die Rede war, veranlassten sie unwillkürlich zu weicheren Regungen; selbst gewisse Lieder von Beranger liebte sie wegen des Schmerzes, der sich trotz aller Lustigkeit darin aussprach.
Stundenlang konnte sie so in ihren Träumereien verloren dasitzen; und der Aufenthalt in Peuples gefiel ihr deshalb ausserordentlich, weil er ihren romantischen Ideen, sowohl durch die Wälder der Umgegend, als auch durch die Heideflächen und namentlich durch die Nähe des Meeres, stets wieder die Werke Walter Scott’s ins Gedächtnis rief, mit denen sie sich seit einigen Monaten beschäftigte.
An Regentagen schloss sie sich in ihr Zimmer ein, um ihre sogenannten »Reliquien« durchzustöbern, nämlich die alten Briefe, die sie von ihren Eltern, von ihrem Manne als Bräutigam empfangen hatte, und ausserdem noch einige andere. Dieselben waren in einem Schreibtisch aus Mahagoni eingeschlossen, an dessen Ecken sich bronzene Sphynxfiguren befanden. Wenn Rosalie die Briefe holen sollte, so pflegte die Baronin mit eigentümlicher Betonung zu sagen: »Bring mir die Schieblade mit meinen Jugenderinnerungen, Kind!«
Die Zofe öffnete dann den Schreibtisch, nahm die Schieblade heraus und stellte sie auf einen Stuhl neben ihre Herrin, welche den Inhalt langsam Stück für Stück durchlas, wobei hin und wieder sich eine Träne aus ihrem Auge stahl.
Bei den Spaziergängen musste Johanna zuweilen Rosalie ersetzen und Mütterchen erzählte ihr dann von ihren Jugenderinnerungen. Das junge Mädchen fand sich selbst darin wieder; sie war erstaunt über die Ähnlichkeit ihrer Gedanken und die Gleichheit ihrer Wünsche. Bildet sich doch jedes Herz ein, allein vor allen anderen unter dem Eindruck jener Empfindungen geseufzt zu haben, unter dem schon die Herzen der ersten Menschen höher schlugen, und unter dem die Herzen der letzten Menschen und namentlich Frauen höher schlagen werden.
Ihr Spaziergang vollzog sich ebenso langsam wie die Erzählung, welche hin und wieder von Beklemmungen unterbrochen wurde. In solchen Pausen schweiften Johannas Gedanken der angefangenen Geschichte voraus; ihr Herz schwelgte in zukünftigen Freuden und Hoffnungen.
Eines Nachmittags, als sie auf der Bank am Eingang der Allee sassen, bemerkten sie plötzlich am Ende derselben die beleibte Gestalt eines Geistlichen, der auf sie zukam. Er grüsste schon von Weitem, nahm eine lächelnde Miene an, grüsste auf drei Schritt nochmals und rief ziemlich laut:
»Ah, die gnädige Frau Baronin! Wie geht es denn?« Es war der Dorfpfarrer.
Die Mama, die in der Zeit der Philosophen geboren und von einem ziemlich ungläubigen Vater während der Revolutionszeit erzogen war, besuchte die Kirche niemals, obschon sie die Geistlichkeit mit einer Art religiösem Instinkt der Frauen ganz gern hatte.
Sie hatte bis dahin ihren Pfarrer, den Abbé Picot, ganz vergessen und errötete jetzt unwillkürlich. Sie entschuldigte sich, dass sie seinem Besuche nicht zuvorgekommen sei, aber der gute Mann war durchaus nicht verletzt. Er sah Johanna an, grüsste sie mit freundlicher Miene, setzte sich, legte seinen Dreispitz auf die Knie und wischte sich die Stirn ab. Er war sehr stark, sehr rot und schwitzte sehr. Jeden Augenblick zog er ein mächtiges karriertes und schon ganz feuchtes Taschentuch hervor, mit dem er sich Gesicht und Nacken abwischte. Aber kaum hatte er es wieder in seine geräumige Tasche versenkt, als schon wieder neue Tropfen auf seiner Stirn standen und auf die hervorstehenden Teile seiner Soutane rannen, wo sie sich mit dem dort angesammelten Staube zu kleinen Flecken verbanden.
Er war heiter, gesprächig, nachsichtig; ein echter Landpriester. Er erzählte allerlei Geschichten, sprach von den Landleuten und ließ sich nicht im Geringsten merken, dass er seine beiden Pfarrkinder noch nicht in der Kirche gesehen hatte. Bei der Baronin schob er dies auf eine natürliche Folge ihrer verschwommenen religiösen Ideen; bei Johanna auf die ganz erklärliche Freude, dem Kloster entronnen zu sein, wo man sie in Andachtsübungen geradezu erstickt hatte.
Jetzt erschien auch der Baron, der als Pantheist sich den Dogmen gegenüber völlig indifferent verhielt. Er war sehr liebenswürdig gegen den Pfarrer, den er oberflächlich kannte, und lud ihn ein, zu Tisch zu bleiben.
Der Priester war einsichtig genug, in keiner Weise anzustossen. Er hatte durch seine langjährige Erfahrung als Seelenführer sich jene Zurückhaltung angeeignet, welche die anderen niemals unnötig fühlen lässt, dass man berufen ist, über sie einen besonderen Einfluss auszuüben.
Die Baronin verhätschelte ihn; vielleicht mochte sie sich unwillkürlich durch eine Art geistige Verwandtschaft zu ihm hingezogen fühlen. Das vollblütige Gesicht und der kurze Atem des Pfarrers erinnerte sie an ihr eigenes Leiden.
Beim Dessert hatte der liebenswürdige Mann alle Mühe, sich der Aufmerksamkeit zu erwehren, mit der die Baronin ihm immer wieder vorlegen ließ.
Plötzlich rief er wie jemand, dem eine glückliche Idee durch den Kopf schiesst:
»Denken Sie nur, ich habe ein neues Pfarrkind, das ich Ihnen notwendig vorstellen muss. Es ist der Herr Vicomte de Lamare.«
Die Baronin, welche den ganzen Adel der Provinz an den Fingern aufzählen konnte, fragte:
»Einer von den Lamare’s von Eure?«
»Zu dienen, Madame«; sagte der Priester, sich verbeugend, »der Sohn des letzthin verstorbenen Vicomte Johann de Lamare.«
Madame Adelaïde, die für den Adel überaus schwärmte, richtete nun eine Menge Fragen an ihn und erfuhr, dass der junge Mann, um die väterlichen Schulden zu bezahlen, sein Schloss verkauft und sich im Erdgeschoss eines der drei Pachthöfe, die er noch in der Gemeinde Etouvent besass, eingerichtet hatte. Seine Einkünfte betrugen alles in allem fünf bis sechs Tausend Francs. Aber der junge Mann war sehr vernünftig und sparsam. Er wollte zwei oder drei Jahre ganz einfach und bescheiden hier auf dem Lande wohnen und sich so viel zurücklegen, dass er dann, ohne Schulden zu machen oder seine Pachthöfe zu belasten, eine Rolle in der Welt spielen konnte. Das Endziel seiner Wünsche war natürlich eine vorteilhafte Heirat.
»Es ist ein vortrefflicher charaktervoller junger Mann«, setzte der Pfarrer hinzu, »so wohlerzogen, so gutmütig. Aber er langweilt sich natürlich etwas hier auf dem Lande.«
»Bringen Sie ihn zu uns, Herr Abbé!« sagte der Baron, »vielleicht können wir ihm etwas Zerstreuung bieten.«
Dann sprach man von anderen Dingen.
Als man im Salon den Kaffee eingenommen hatte, bat der Priester um die Erlaubnis, eine kleine Promenade im Garten machen zu dürfen; er habe die Gewohnheit, sich nach der Mahlzeit etwas Bewegung zu verschaffen. Der Baron begleitete ihn. Sie gingen langsam längs der weißen Facade des Schlosses, kehrten wieder um und begannen ihren Spaziergang aufs Neue.
Ihre Schatten, der eine mager, der andere rund und wie ein flacher Pilz, folgten ihnen bald, bald eilten sie ihnen voraus, je nachdem sie das Mondlicht im Rücken oder vor sich hatten. Der Pfarrer rauchte eine Art Zigarette, die er aus der Tasche gezogen hatte. Er setzte den Nutzen derselben dem Baron in der freien Art der Leute vom Lande auseinander: »Es befördert die Verdauung, da ich oft an starken Blähungen leide«, sagte er.
Dann stand er plötzlich still und sagte, den klaren Sternenhimmel betrachtend:
»Man wird doch niemals müde, das anzuschauen.« Hierauf kehrte er zurück, um sich von den Damen zu verabschieden.
*