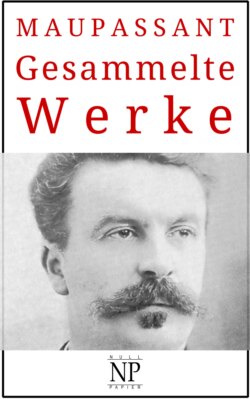Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 74
IX.
ОглавлениеAls Johanna sich von ihrer Niederkunft ganz erholt hatte, entschloss man sich, den Besuch der Fourvilles zu erwidern und auch dem Marquis de Coutelier einen Besuch zu machen.
Julius hatte auf einer Auktion einen neuen Wagen gekauft, ein Phaeton, zu dem man nur ein Pferd bedurfte; so konnten sie ein oder zweimal im Monat bequem ausfahren.
An einem schönen klaren Dezembertage wurde angespannt. Nachdem sie zwei Stunden durch Feld und Wiesen gefahren waren, begann der Weg in ein kleines Tal abzusteigen, dessen Ränder bewaldet waren und dessen Grund deutliche Spuren einer sorgfältigen Kultur zeigte.
Auf die besäeten Felder folgten Wiesen und auf die Wiesen ein großer Sumpf. Das Schilfrohr desselben war zu dieser Jahreszeit schon dürr und seine Blätter flatterten wie lange gelbe Bänder im Winde.
Plötzlich nach einer scharfen Biegung des Tales lag das Schloss la Vrilette vor ihnen. Es lehnte sich mit der einen Front an den bewaldeten Talhang an, während die Mauer der andren sich in einem Teich verlor, den auf der gegenüberliegenden Seite ein hohes Tannengehölz abschloss, das diesen Teil des Tales bedeckte.
Man musste über eine alte Zugbrücke, um dann durch ein hohes Portal im Stile Ludwig XIII. in den Schlosshof zu gelangen. Das Schloss war im gleichen Stile aus Backstein erbaut und von Türmchen mit Schieferdächern flankiert.
Julius erklärte Johanna alle Einzelnheiten des Baues, den er genau zu kennen schien. Er pries seine vollendete Schönheit, die er nicht genug bewundern konnte. »Sieh nur dies Portal an! Ist das nicht eine herrliche Wohnung, wie? Die ganze andere Façade liegt im Teiche, mit einer wundervollen Rampe, die bis zum Wasser herunter führt. Vier Kähne liegen an deren Stufen befestigt, zwei für den Grafen und zwei für die Gräfin. Dort unten rechts, wo Du die Pappelreihe siehst, ist das Ende des Teiches. Dort liegt der Fluss, der nach Fecamp führt. Die Gegend ist von Wasservögeln belebt. Der Graf schwärmt leidenschaftlich für die Jagd. Es ist ein richtiger Herrensitz, das.«
Die Eingangstür öffnete sich und die bleiche Gräfin erschien, den Besuchern mit einem Lächeln auf den Lippen entgegenkommend. Sie trug ein Schleppkleid wie eine Schlossherrin aus alter Zeit. Die schöne Dame vom See schien wie geboren für dieses Grafenschloss.
Der achtfenstrige Salon gewährte einen prachtvollen Ausblick auf das Wasser und das dunkle Fichtenholz, welches an seinem jenseitigen Rande emporstieg.
Das dunkle Laub im Hintergrunde ließ den Teich tief, finster und traurig erscheinen; und wenn der Wind blies, so klang das Flüstern der Bäume wie seufzende Stimmen aus dem Sumpfe.
Die Gräfin nahm beide Hände Johanna’s, als hätte sie eine Jugendfreundin vor sich, bat sie Platz zu nehmen und setzte sich neben sie auf einen niedrigen Stuhl, während Julius, der seit fünf Monaten ganz wieder der vornehme Weltmann von früher geworden war, in der gewandtesten Weise unter vertraulichem stillen Lächeln die Unterhaltung führte.
Die Gräfin und er sprachen von ihren Spazierritten. Sie lachte ein wenig über seine Reitkunst und nannte ihn den »Stolper-Ritter«, während er sie lachend »Die Amazonen-Königin« taufte. Der Knall eines Gewehres unter dem Fenster entlockte Johanna einen kleinen Schrei. Es war der Graf, der eine Krickente geschossen hatte.
Seine Frau rief ihn sofort herbei. Man hörte das Geräusch von Rudern, das Anstossen eines Kahns an der Steintreppe und alsbald erschien der Graf in hohen Wasserstiefeln, gefolgt von zwei triefenden Hunden, rötlich wie ihr Herr, die sich’s auf dem Teppich an der Tür bequem machten.
Der Graf schien zu Hause besserer Laune und über den nachbarlichen Besuch sehr erfreut zu sein. Er ließ frisches Holz in den Kamin legen, bestellte Madeira und Biskuits. »Aber Sie werden mit uns essen, nicht wahr; abgemacht?« rief er plötzlich, Johanna, deren Gedanken stets bei ihrem Kinde weilten, wollte Einwendungen machen; aber er ließ sie nicht gelten. Als sie noch immer zögerte, machte Julius eine heftige Bewegung der Ungeduld. Da befürchtete sie seine schlechte Laune wieder zu erwecken und willigte ein, obschon ihr der Gedanke furchtbar war, Paul vor dem nächsten Tage nicht wiederzusehen.
Es war ein sehr vergnügter Nachmittag. Man fuhr zunächst zu den Quellen des Teiches, die am Fusse eines moosbewachsenen Felsens sich in ein klares Bassin ergossen, dessen Wasser stets wie kochend aufwirbelte. Dann bewegte sich der Kahn auf richtigen Wasserwegen, die in dem Walde von trockenem Schilf eingeschnitten waren. Der Graf, der zwischen seinen zwei Hunden sass, die witternd die Nase in die Luft streckten, führte die Ruder. Jeder seiner Ruderschläge brachte den Kahn ein gutes Stück vorwärts. Johanna steckte zuweilen die Hand in das frische Wasser und freute sich seiner eisigen Kühle, die ihr bis zum Herzen drang. Ganz im Hintergrunde sassen, in Shawles eingehüllt, die Gräfin und Julius. Sie lächelten wie zwei glückliche Menschen, die für ihr Glück aber keine Worte haben.
Der Abend brach mit langgezogenen kühlen Schauern herein; der Nordwind strich durch das welke Schilfrohr. Die Sonne war hinter den Tannen zur Ruhe gegangen. Der rötliche Himmel, mit scharlachfarbenen und grotesken Wölkchen bedeckt, ließ einen erfrieren, wenn man ihn nur anschaute.
Man kehrte in den Salon zurück, wo ein mächtiges Kaminfeuer brannte. Schon beim Eintritt wurde man warm und heiter gestimmt. Der Graf nahm in ausgelassener Laune seine Frau wie ein Kind auf seine athletischen Arme, hob sie bis zum Munde empor und drückte ihr zwei herzhafte glückliche Küsse auf beide Wangen.
Johanna betrachtete lächelnd diesen gutmütigen Riesen, den man lediglich um seines großen Schnurrbartes willen einen Währwolf nannte. »Wie man sich doch stets über die Leute täuschen kann!« dachte sie bei sich. Als sie dann fast unwillkürlich den Blick auf Julius richtete, der furchtbar bleich, das Auge starr auf den Grafen geheftet, in der Tür stand, näherte sie sich ihm voll Besorgnis. »Bist Du krank? Was fehlt Dir nur?« fragte sie ihn leise. »Nichts«, antwortete er zornig, »lass mich zufrieden. Ich friere.«
Als man sich in den Speisesaal begab, bat der Graf um die Erlaubnis, seine Hunde mitnehmen zu dürfen. Sie kamen alsbald herbei und pflanzten sich rechts und links von seinem Stuhle auf. Jeden Augenblick gab er ihnen einen Bissen von seinem Teller und streichelte ihren langen seidenweichen Behang. Die prächtigen Tiere zeigten sich sehr empfänglich für seine Liebkosungen, sie wedelten mit dem Schweif und zitterten vor freudiger Erregung.
Johanna und Julius machten nach dem Diner Miene, fortzufahren; allein der Graf hielt sie zurück, um ihnen einen Fischfang bei Fackelschein zu zeigen.
Sie mussten sich mit der Gräfin auf der Rampe aufstellen, die zum Teiche führte, während er, von einem Diener mit brennender Fackel und Wurfnetz begleitet, in seinen Kahn stieg. Die Nacht war klar und scharf; der Himmel mit Milliarden von Sternen besäet.
Die Fackel warf seltsame lebendige Feuerstrahlen auf das Wasser; ihr Licht erzitterte im Schilfrohr und brach sich an dem Rande des dichten Tannengehölzes. Plötzlich bei einer Wendung des Kahnes hob sich ein riesiger gespenstiger Schatten, der Schatten eines Menschen, an diesem hellerleuchteten Waldrande ab. Sein Haupt ragte über die Bäume hinaus und verlor sich im Äther, während die Füsse im Wasser zu stehen schienen. Dann erhob dieses unermessliche Wesen seine Arme, als wollte es die Sterne vom Himmel holen. Sie schnellten plötzlich empor, diese Arme, und sanken ebenso schnell wieder herab. Gleichzeitig hörte man ein leichtes Geräusch, wie wenn das Wasser gepeitscht würde.
Während die Barke langsam dahinglitt, schien die wunderbare Gestalt längs dem erleuchteten Holze hinzulaufen. Dann verschwand sie in dem unsichtbaren Horizont, um plötzlich wieder aufzutauchen. Sie war weniger groß aber genauer in ihren Umrissen; ihre Bewegungen wurden immer deutlicher, als sie sich jetzt auf der Façade des Schlosses abspiegelte.
»Ich habe acht gefangen, Gilberte«, rief die gewaltige Stimme des Grafen.
Die Ruder knirschten auf dem Grunde. Der riesige Schatten stand jetzt unbeweglich an der Mauer und wurde immer kleiner und schmaler. Sein Haupt schien herabzusinken, sein Körper abzumagern; und als Herr de Fourville die Stufen der Rampe heraufschritt, stets von dem Diener mit der Fackel gefolgt, war seine Figur wieder auf ihren gewöhnlichen Umfang zusammengeschmolzen, während das Licht alle seine Bewegungen auf dem Mauerwerk wiedergab.
In seinem Netz trug er acht große zappelnde Fische.
»Welch ein guter Mann, dieser Riese!« sagte Johanna unterwegs, als sie beide in warme Mäntel und Decken gehüllt, die man ihnen geliehen hatte, nach Peuples zurückfuhren. »Allerdings«, entgegnete Julius, der die Zügel führte, »nur schade, dass er sich in Gesellschaft zuweilen so gehen lässt.«
Acht Tage später fuhren sie zu den Couteliers, welche dem ersten Adel des Landes angehörten. Ihr Wohnsitz Reminil stiess an den Flecken Cany. Das neue Schloss, unter Ludwig XIV. erbaut, lag ganz versteckt in einem herrlichen, von Mauern umgebenen Parke. Auf einer Anhöhe sah man die Ruinen des alten Schlosses. Reich galonierte Diener geleiteten den Besuch in einen imposanten Saal. In der Mitte desselben stand auf einer Art Säule eine ungeheure Vase aus Sèvres; und in dem Sockel war unter einer Kristallplatte ein eigenhändiger Brief des Königs verwahrt, mittels welchen derselbe dem Marquis Leopold, Hervé, Joseph, Germer de Varneville de Rollebosc de Coutelier dieses wahrhaft königliche Geschenk übersandte.
Johanna und Julius waren noch in der Betrachtung dieses Prachtstückes versunken, als der Marquis und die Marquise eintraten. Die Dame war stark gepudert, liebenswürdig aus Gewohnheit und geziert in dem Bestreben herablassend zu sein. Der Herr, stark von Figur mit blonden geradeauf stehenden Haaren, legte in alle seine Bewegungen, in seine Sprache und in seine ganze Haltung etwas Gemessenes, um die Erhabenheit seiner Person darzutun.
Sie gehörten zu jener Art von steifen Leuten, deren Geist, deren Gemüt und Redensarten stets auf Stelzen zu gehen scheinen.
Sie führten allein das Wort, ohne lange auf Antworten zu warten, mit einem indifferenten Lächeln; es war, als betrachteten sie es als eine ihnen durch Geburt auferlegte Pflicht, die kleinen Edelleute der Umgegend höflich bei sich aufzunehmen.
Johanna und Julius waren wie erstarrt, bemühten sich aber höflich zu sein. Es war ihnen unbequem, lange zu bleiben und doch konnten sie den geeigneten Augenblick zum Aufbruch nicht finden. Schliesslich machte die Marquise ihrerseits dem Besuch ein Ende indem sie mit ungezwungener natürlicher Haltung das Gespräch beschloss, wie eine Königin die in höflicher Form eine Audienz aufhebt.
»Wenn es Dir recht ist,« meinte Julius auf dem Heimwege, »so machen wir dort keinen Besuch wieder; mir für meine Person genügen die Fourvilles.« Johanna stimmte ihm völlig bei.
Der Dezember, dieser finstere Monat, dieses dunkle Loch am Ende des Jahres, ging langsam zur Neige. Das einsame Leben begann wieder wie im vorigen Jahre. Johanna langweilte sich indessen keineswegs; sie war unausgesetzt mit Paul beschäftigt, den Julius von der Seite mit unruhiger missvergnügter Miene betrachtete.
Zuweilen, wenn die Mutter ihn auf den Armen hielt und ihn mit jenen zärtlichen Schmeicheleien liebkosete, die jede Mutter für ihr Kind hat, zeigte sie ihn auch dem Vater und sagte: »So küsse ihn doch mal; man sollte wirklich denken, Du möchtest ihn nicht.« Dann berührte er ganz von Weitem mit seinen Lippen die glatte Stirn des Babys; aber er schnitt ein widerwilliges Gesicht dazu und beugte sich weit vor um nur nicht die kleinen lebhaft greifenden Händchen anzurühren. Hierauf ging er sofort heraus; man hätte denken können, dass ein Ekel ihn forttriebe.
Hin und wieder kamen der Maire, der Pfarrer und der Doktor zum Essen. Zuweilen stellten sich auch die Fourvilles ein, mit denen man sich immer mehr anfreundete.
Der Graf schien eine innige Zuneigung zu Paul gefasst zu haben. Er hatte ihn fortwährend auf dem Schosse, selbst wenn der Besuch den ganzen Nachmittag dauerte. Er schaukelte ihn vorsichtig auf seinen großen Riesenfäusten, kitzelte ihm die Nasenspitze mit seinen langen Schnurrbartenden und küsste ihn unzählige Male mit einer Leidenschaftlichkeit, wie eine Mutter sie nicht grösser haben konnte. Er litt unaussprechlich darunter, dass seine eigene Ehe kinderlos blieb.
Im März begann das Wetter, klar, trocken und beinahe milde zu werden. Gräfin Gilberte begann aufs neue von den Spazierritten zu sprechen, die sie zu Vieren unternehmen wollten. Johanna, die der langen Abende und Nächte und der ebenso monotonen Tage doch etwas müde war, gab ganz vergnügt diesem Plane ihre Zustimmung. Eine ganze Woche lang beschäftigte sie sich mit der Zurichtung ihres Reitkleides.
Dann begannen die Spazierritte. Sie ritten immer zu zweien, die Gräfin mit Julius voraus, Johanna und der Graf hundert Schritte dahinter. Letztere plauderten harmlos wie Freunde; denn sie waren Freunde geworden durch die Berührung ihres redlichen Gemütes, ihrer einfachen Seelen. Jene dagegen sprachen leise miteinander, lachten zuweilen laut auf, und sahen sich plötzlich an, als ob ihre Augen sich etwas erzählen wollten, was der Mund nicht aussprechen konnte. Dann sprengten sie wieder im Galopp davon, als wollten sie weit, recht weit fliehen.
Hin und wieder schien Gilberte sehr reizbar zu sein. Der Wind trug ihre laute Stimme bis zu den Ohren der langsam hinterdrein Reitenden. »Sie ist nicht immer gut gelaunt, meine Frau«, sagte der Graf alsdann lächelnd zu Johanna.
Eines Abends auf dem Heimwege, haranguierte die Gräfin ihre Stute besonders; bald stach sie ihr den Sporn in die Flanke, bald riss sie heftig am Zügel. Man konnte deutlich hören, wie Julius ihr mehrmals sagte: »Geben Sie Acht, geben Sie Acht, sie wird Ihnen durchgehen.«
»Einerlei; das geht Sie nichts an«, antwortete sie so herb und scharf, dass die Worte deutlich über’s Feld hallten als seien sie in der Luft aufgehängt.
Das mutige Tier bäumte sich schliesslich hoch auf und biss schäumend auf die Stange. »Gib doch Acht, Gilberte«, rief der Graf aus voller Lunge. Da hieb sie wie in einem Anfall von Raserei, die nichts zurückhält, zornig mit ihrer Gerte das Tier gerade zwischen beide Ohren. Die Stute stieg kerzengerade in die Höhe, schlug einen Augenblick die Luft mit den Vorderfüssen, fasste dann wieder Boden, machte einen furchtbaren Satz, und rannte mit Aufbietung aller Kräfte wie toll davon.
Zuerst ging es über eine Wiese, dann über einen Sturzacker, wobei eine Wolke von Staub und Schmutz sie einhüllte. Sie rannte so flüchtig, dass man Ross und Reiterin kaum noch voneinander unterscheiden konnte.
»Madame, Madame!« rief Julius, der ganz verzweifelt und verwirrt halten blieb.
Der Graf ließ ein leises Brummen vernehmen, beugte sich über den Hals seines Pferdes, nachdem er es mit seinem ganzen Körpergewicht vorgedrückt hatte und sprengte davon. Er hob es mit solcher Kraft, trieb es mit Peitsche Spore und Zuruf so energisch vorwärts, dass es aussah, als trüge der riesige Reiter das Tier zwischen seinen Schenkeln davon. So ging es mit unglaublicher Schnelligkeit hinter einander her. Johanna sah, wie ganz weit hinten die Schatten der beiden Eheleute dahinflogen, wie sie immer kleiner wurden, bald verschwanden, bald wieder auftauchten gleich zwei Vögeln, die sich verfolgen, um endlich sich ganz im Äther zu verlieren.
Julius näherte sich ihr, immer noch im Schritt und sagte mit ganz verstörter Miene: »Ich glaube, sie ist von Sinnen heute.«
Sie ritten nun hinter ihren Freunden her, die durch eine Erdwelle verdeckt waren.
Nach Verlauf einer Viertelstunde sahen sie dieselben zurückkommen; und bald traf man wieder zusammen.
Der Graf, noch röter wie sonst, in Schweiß gebadet, aber lachend, mit zufriedener triumphierender Miene führte mit seiner kräftigen Faust, das Pferd seiner Gattin am Zügel. Ihr schmerzlich verzerrtes Antlitz war bleich wie der Kalk an der Wand und sie hatte sich mit der einen Hand um den Nacken ihres Mannes gehängt, als fühlte sie ihre Kräfte schwinden.
Johanna begriff an diesem Tag, dass der Graf seine Gattin unaussprechlich liebte.
Während der nächsten Zeit zeigte sich die Gräfin so vergnügt, wie sie noch nie zuvor gewesen war. Sie kam noch öfter wie sonst nach Peuples, lachte unaufhörlich und küsste Johanna unter wahren Stürmen von Zärtlichkeit. Man hätte sagen können, dass eine geheimnisvolle Verzückung über sie gekommen wäre. Ihr Mann, selbst überglücklich, wandte kein Auge von ihr, und suchte mit verdoppelter Zärtlichkeit jeden Augenblick ihre Hand oder wenigstens eine Falte ihres Kleides zu erhaschen.
»Wir sind jetzt wirklich glücklich«, sagte er eines Abends zu Johanna. »Gilberte war noch nie so liebenswürdig wie jetzt. Sie kennt keinen Zorn und keine schlechte Laune mehr. Ich fühle, dass sie mich liebt. Bis dahin war ich dessen noch nicht gewiss.«
Auch Julius schien verändert, vergnügter, ohne Zeichen von Ungeduld; als wenn die Freundschaft zwischen den beiden Familien einer jeden von ihnen Frieden und Freude zurückgebracht hätte.
Der Frühling war ausserordentlich schön und warm. Von den lieblichen Morgenstunden bis zum milden lauen Abend sandte die Sonne ihre wärmenden alles belebenden Strahlen auf die Erde herab. Es war ein plötzliches und mächtiges Erwachen der ganzen Erde zu gleicher Zeit, jenes unwiderstehliche Treiben des Saftes, jener Drang zum Neuerstehen, den die Natur zuweilen in ganz besonders bevorzugten Jahren zeigt, wo man an eine Verjüngung der Welt glauben möchte.
Johanna fühlte sich durch dieses gärende Leben seltsam bewegt und verwirrt. Beim Anblick einer kleinen Blume im Grase konnte sie plötzlich zu Tränen gerührt werden, sie hatte Stunden voll seltsamer Melancholie, voll weicher Empfindungen.
Dann überfielen sie die zärtlichen Erinnerungen der ersten Zeit ihrer Liebe. Nicht als ob ihre Zuneigung zu Julius sich erneuert hätte; nein! das war aus, für immer aus! Aber der laue Frühlingswind, der linde Frühlingsduft umschmeichelten ihre Haut und drangen ihr bis zum Herzen, wo sie ein unbewusstes Erwachen, wie auf irgend einem geheimnisvollen Ruf hin, hervorzauberten.
Es machte ihr Freude, allein zu sein, sich bei der warmen Sonne an irgend ein stilles Plätzchen zurückzuziehen; diese unbestimmten, wonnigen und heiteren Empfindungen wollte sie mit Niemandem teilen.
Eines Morgens, als sie so vor sich hinträumte, beschäftigte sie plötzlich ein Bild aus vergangener Zeit, das Bild jener kleinen, sonnigen Lichtung, inmitten des dunklen Laubes in dem kleinen Holze bei Etretat. Dort hatte sie zum ersten Male empfunden, wie ihr Körper neben dem jungen Manne zitterte, den sie damals liebte. Dort hatte er zum ersten Mal, wenn auch nur stammelnd, dem Verlangen seines Herzens Ausdruck verliehen. Dort hatte sie ja plötzlich geglaubt, die köstliche Verwirklichung ihrer Hoffnungen vor sich zu sehen.
Und sie wollte dieses Gehölz wiedersehen; sie wollte dorthin eine Pilgerfahrt machen, von der sie mit abergläubischer Sentimentalität irgend eine Änderung ihres bisherigen Lebensweges erwarten zu müssen vermeinte.
Julius war seit Tagesanbruch fortgeritten; sie wusste nicht wohin. Sie ließ also den kleinen Schimmel der Martins satteln, den sie jetzt zuweilen bestieg, und ritt fort.
Es war ein Tag so ruhig, dass sich nichts, kein Grashalm, kein Blatt, zu regen schien. Alles schien für immer erstarrt, als ob der Wind erstorben wäre. Selbst die Insekten schienen verschwunden zu sein.
Eine heisse majestätische Ruhe ging von der Sonne aus, die unempfindlich gegen alles, in Gold getaucht schien. Johanna ritt im Schritt ihres Weges, heiter, fast glücklich. Von Zeit zu Zeit hob sie den Blick, um ein kleines weißes Wölkchen zu betrachten, das nicht grösser war wie ein Watte-Flöckchen, oder wie ein leichter Dampfhauch, der vergessen, ganz allein dort oben mitten am blauen Himmelszelt haften geblieben war.
Sie ritt in das Tal hinab, welches sich durch einen der großen Felsenbogen, die man die Tore von Etretat nennt, zum Meere erstreckt. Langsam näherte sie sich dem Gehölz. Zwischen dem noch mageren Laube ergoss sich ein Strom von Licht. Sie suchte die Lichtung, ohne sie finden zu können und irrte planlos auf den schmalen Wegen herum.
Plötzlich, als sie eine lange Allee passierte, bemerkte sie zwei Reitpferde, die an einen Baum gebunden waren. Sie erkannte sie sofort, es waren Gilberte und Julius ihre. Da die Einsamkeit angefangen hatte, ihr drückend zu werden, so war sie über dies unerwartete Zusammentreffen sehr vergnügt, und setzte ihr Pferd in Trab.
Als sie bei den beiden Pferden angekommen war, die ruhig wie aus langer Gewohnheit dastanden, begann sie zu rufen. Aber sie erhielt keine Antwort.
Ein Damenhandschuh und zwei Reitpeitschen lagen in dem bunten Grase. Sie hatten also dort gesessen, und waren dann fortgegangen, ihre Pferde zurücklassend.
Sie wartete eine Viertelstunde, zwanzig Minuten, sehr erstaunt, ohne zu begreifen, was sie wohl machen könnten. Während sie abgestiegen war und nun so dastand, mit dem Rücken an einen Baum gelehnt, fingen zwei Finken, im Laub versteckt, ganz dicht über ihr zu schlagen an. Sie hüpften um einander, mit gespreizten zitternden Flügelchen, drehten die Köpfchen und zwitscherten. Dann paarten sie sich plötzlich.
Johanna war überrascht, als wenn sie so etwas noch nie gesehen hätte. »Ach ja«; sagte sie dann bei sich »es ist Frühling.« Hierauf kam ihr ein anderer Gedanke, ein Verdacht. Sie betrachtete von Neuem den Handschuh, die Reitpeitschen, die verlassenen Pferde. Plötzlich schwang sie sich in den Sattel, von einem heftigen Verlangen getrieben zu fliehen.
Sie galoppierte jetzt nach Peuples zurück. Ihr Gehirn arbeitete heftig, sie überlegte, reihte die Tatsachen aneinander, erwog die Umstände. Wie konnte sie erst so spät alles erraten? War sie bis dahin blind gewesen? Hatte sie Julius’ häufige Abwesenheit, seine wiederkehrende Eleganz, seine neuerwachte gute Laune nicht beachtet? Jetzt erinnerte sie sich auch Gilberte’s plötzlicher nervöser Anfälle, ihrer übertriebenen Zärtlichkeiten gegen sie, und dieser Art Seligkeit der letzten Zeit, über die der Graf so glücklich war.
Sie parierte ihr Pferd zum Schritt, denn sie fühlte das Bedürfnis, ernster nachzudenken und das schnelle Tempo verwirrte ihre Sinne.
Nachdem die erste Bewegung vorüber war, wurde ihr Herz wieder ruhiger; sie empfand weder Eifersucht noch Hass, sondern nur Verachtung. Sie dachte nicht an Julius, von dem sie nichts mehr in Erstaunen setzen konnte; aber der zweifache Verrat der Gräfin an ihr als Gattin und Freundin, das war es, was sie erregte. Die ganze Welt also war hinterlistig, falsch und lügnerisch. Tränen kamen ihr in die Augen. Man beweint zuweilen seine Illusionen mit ebenso viel Schmerz wie seine Toten.
Dennoch entschloss sie sich, zu tuen, als ob sie nichts wüsste, ihr Herz vor vorübergehenden Regungen zu behüten, und ihre Liebe nur noch Paul und ihren Eltern zuzuwenden. Die Gegenwart der übrigen wollte sie mit ruhiger Miene ertragen.
Sobald sie zu Hause angekommen war, warf sie sich über ihren Sohn, trug ihn in ihr Zimmer herüber und küsste ihn eine Stunde lang unter stürmischen Tränen.
Julius kam zum Diner nach Hause, fröhlich und guter Dinge, voll liebenswürdiger Absichten. »Kommen Papa und Mama denn nicht dieses Jahr?« fragte er.
Sie wusste ihm so viel Dank für diese Aufmerksamkeit, dass sie ihm fast ihre Entdeckung im Holze verzieh. Sie wurde plötzlich von einem so lebhaften Verlangen ergriffen, diejenigen wiederzusehen, welche sie nächst Paul am meisten liebte, dass sie den ganzen Abend am Schreibtische zubrachte, um ihre Herüberkunft zu beschleunigen.
Die Eltern stellten ihre Rückkehr für den 20. Mai in Aussicht. Man schrieb damals den 7. d. M.
Mit täglich wachsender Ungeduld erwartete sie deren Ankunft, als wenn sie ausser der Liebe zu ihrem Kinde noch ein anderes Bedürfnis fühlte, wieder einmal ihr Herz an einem redlichen Herzen schlagen zu lassen. Sie musste wieder einmal offen mit Leuten reden, die, treu und bieder, jeder Infamie abhold waren; die in ihrem Leben, in all ihren Worten und Werken, in ihren Gedanken und Wünschen stets ehrlich und gewissenhaft waren.
Was sie jetzt am meisten empfand, das war die Vereinsamung ihres Gewissens inmitten all dieser gewissenlosen Menschen. Obschon sie mit einem Male gelernt hatte zu heucheln, die Gräfin mit offenen Armen und lächelndem Munde zu empfangen, so fühlte sie doch dies Gefühl der Leere, diese gewisse Menschenverachtung, stetig wachsen und sie sah sich ganz von ihm beherrscht. Täglich erhöhten die kleinen Neuigkeiten aus der Umgebung den Widerwillen ihres Herzens, ihren Abscheu gegen alle anderen Wesen.
Die Tochter der Couillards hatte ein Kind bekommen und die Hochzeit sollte jetzt erst stattfinden. Die Magd bei den Martins, eine Waise, war in andren Umständen; ein fünfzehnjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft ebenso. Eine Wittwe, eine arme knöcherige ekelhafte Frau, die man ihres schrecklichen Schmutzes wegen den »Pferdeapfel« nannte, fühlte sich gleichfalls Mutter.
Jeden Augenblick hörte man von einer neuen Schwangerschaft, oder dem Fehltritt irgend eines Mädchens, einer Frau und Mutter mehrerer Kinder, selbst sogar einer reichen angesehenen Pächtersfrau.
Dieser fruchtbare Frühling schien bei den Menschen den Saft nicht weniger wie bei den Pflanzen in Wallung zu bringen.
Johanna deren erloschene Sinne nicht mehr erregt wurden, deren zerrissenes Herz und deren weiches Gemüt allein von diesem lauen fruchtbaren Frühlingsodem unberührt blieben und die schwärmerisch ohne Verlangen und leidenschaftlich ohne Triebe lediglich ihren einsamen Träumen sich hingab, war erstaunt entsetzt, ja schliesslich hasserfüllt über diese tierische Schmutzerei.
Die Vereinigung zweier Wesen stiess sie jetzt ab, wie etwas widernatürliches. Und wenn sie sich über Gilberte ärgerte, so war es nicht, weil sie ihr den Gatten abspenstig gemacht hatte, sondern lediglich der Umstand, dass sie ebenfalls in diese allgemeine Schmutzgrube gesunken war.
Sie war doch von einer anderen Rasse, als die Landleute, bei denen die tierischen Instinkte vorwiegen. Wie hatte sie sich nur ebenso vergessen können, wie diese Bestien?
An dem Tage sogar, wo ihre Eltern eintreffen mussten, rief Julius abermals diesen Abscheu in ihr wach. Er erzählte ihr sehr vergnügt als neueste und scherzhafteste Geschichte, dass der Bäcker tags vorher, als gerade nicht gebacken wurde, ein eigentümliches Geräusch in der Backkammer vernommen hätte. In der Meinung, irgend eine herumstreichende Katze dort zu erwischen sei er hereingestürzt, und habe seine Frau betroffen, wie sie allerdings »gerade nicht beim Brotbacken war.«
»Der Bäcker« fügte er hinzu, »hatte die Tür verschlossen, sodass sie beinahe ersticken mussten. Der kleine Bäckerjunge hat es den Nachbarn erzählt; er hatte seine Mutter mit dem Schmied hereingehen sehen.«
»Sie geben uns Liebesbrot zu essen, diese Spaßvögel«; schloss Julius lachend. »Es ist wirklich wie eine Geschichte von La Fontaine.«
Johanna vermochte keinen Bissen Brot mehr anzurühren.
Als der Postwagen vor der Tür hielt und sich hinter den Fensterscheiben das vergnügte Gesicht des Barons zeigte, fühlte die junge Frau in ihrem Herzen eine tiefe Bewegung, eine so stürmische Zärtlichkeit, wie sie nie vorher empfunden zu haben glaubte.
Aber sie blieb überrascht, beinahe einer Ohnmacht nahe, stehen, als sie ihre Mutter aussteigen sah. Die Baronin war in diesen sechs Wintermonaten um wenigstens zehn Jahre gealtert. Ihre großen schlaffen Hängebacken waren purpurfarben geworden und strotzten von Blutandrang. Ihr Auge schien erloschen, und sie konnte sich nur noch bewegen, wenn man sie unter beiden Armen stützte. Ihr an sich schwerer Atem war keuchend geworden und wogte so heftig, dass man in ihrer Nähe unwillkürlich ein Gefühl schmerzhafter Verlegenheit empfand.
Der Baron, gewohnt sie täglich zu sehen, hatte von diesen Veränderungen wenig bemerkt. Wenn sie sich bei ihm über ihre stete Atemnot, über ihre wachsenden Beklemmungen beklagte, so antwortete er: »Aber im Gegenteil, liebes Kind; ich habe Dich nie anders gekannt.«
»Deine Mutter ist in schlechten Heften,« sagte Julius am Abende zu seiner Frau: »Ich fürchte es steht nicht gut mit ihr.«
Johanna brach in Schluchzen aus. »Nur ruhig! sagte Julius. »Ich behaupte ja nicht, dass sie verloren ist. Du musst immer gleich alles übertreiben. Sie hat sich sehr verändert, das ist alles. Es kommt von ihrem Alter.«
Nach acht Tagen hatte sie sich schon so an das neue Aussehen ihrer Mutter gewöhnt, dass sie nicht mehr daran dachte. Auch mochte sie wohl absichtlich ihre Befürchtungen zurückdrängen, wie man gewöhnlich aus Egoismus, aus einer Art unbewussten Dranges nach Ruhe düstere Vorahnungen und drohende Sorgen von sich abzuschütteln sucht.
Die Baronin, der das Gehen die grösste Schwierigkeit verursachte, begab sich jeden Tag höchstens noch eine halbe Stunde ins Freie. Wenn sie ein einziges Mal den Weg in »ihrer« Allee zurückgelegt hatte, konnte sie sich nicht mehr weiter bewegen und verlangte, sich auf »ihre« Bank zu setzen. Wenn sie sich unfähig fühlte, ihren Spaziergang zu Ende zu führen, sagte sie: »Wir wollen aufhören; meine Hypertrophie steckt mir heute in allen Gliedern.«
Sie lachte jetzt gar nicht mehr; sie lächelte höchstens noch über Dinge, bei denen sie sich das Jahr vorher noch vor Lachen geschüttelt hätte. Aber da ihre Augen noch sehr gut waren, so verbrachte sie ihre Tage mit der Lesung von »Corinne« oder Lamartine’s »Meditation«. Dann verlangte sie, dass man ihr die Schieblade mit ihren »Reliquien« bringe. Sie breitete die alten, ihrem Herzen so teuren Briefe auf ihrem Schoss aus, stellte die Schieblade auf einen Stuhl neben sich und legte ihre »Reliquien« eine nach der anderen wieder hinein, nachdem sie dieselben langsam durchgelesen hatte. Und wenn sie ganz für sich allein war, dann pflegte sie wohl den einen oder andren Brief zu küssen, wie man die Haare geliebter Toten küsst.
Einige Male fand Johanna, wenn sie plötzlich eintrat, die Baronin bitterlich weinend. »Was hast du, Mütterchen?« rief sie. »Das kommt von meinen Reliquien,« antwortete jene nach einem langen Seufzer. »Man denkt wieder an Sachen, die so herrlich waren, und die nun zu Ende sind! Und dann fallen einem da plötzlich Personen ein, an die man schon ewig nicht mehr gedacht hat. Man glaubt sie zu sehen und zu hören; das macht einen furchtbaren Eindruck. Du wirst das später auch noch kennen lernen.«
Als der Baron einmal bei einer solchen melancholischen Szene hinzukam, murmelte er: »Johanna, mein Kind; wenn Du mir folgen willst, so verbrenne Deine Briefe, alle Briefe, von Deiner Mutter, von mir, alle. Es gibt nichts Schrecklicheres, als die Nase wieder in die Jugendzeit zu stecken, wenn man alt geworden ist.« Aber Johanna bewahrte ebenfalls ihre Korrespondenz, richtete sich ihren »Reliquienschrein« ein, indem sie trotz aller sonstigen Verschiedenheit von ihrer Mutter, einem gewissen erblichen Triebe träumerischer Sentimentalität gehorchte.
Einige Tage später musste der Baron in Geschäften nach auswärts und reiste ab.
Die Jahreszeit war herrlich. Linde sternenklare Nächte folgten den ruhigen Abenden, heitere Abende den strahlenden Tagen und diese wieder brachen mit einer schimmernden Morgenröte an. Mütterchen befand sich bald besser und Johanna, der Liebeleien ihres Gatten und Gilberte’s Untreue vergessend, fühlte sich beinahe von Herzen glücklich. Die ganze Flur prangte im Blumenschmuck und strömte süssen Duft aus. Das weite Meer erglänzte friedlich von Morgen bis zum Abend unter der lachenden Sonne.
Eines Nachmittags nahm Johanna Paul auf den Arm und ging ins Feld. Sie betrachtete bald ihren Sohn, bald das blumenbesäete Gras längs des Weges, und fühlte sich seltsam glücklich bewegt. Alle Augenblicke küsste sie das Kind und drückte es leidenschaftlich an sich. Der starke Blumenduft stieg ihr zu Kopfe; eine angenehme wohltuende Mattigkeit schwächte ihre Sinne. Sie dachte über die Zukunft ihres Kindes nach. Was würde aus ihm werden? Bald wünschte sie es als großen berühmten mächtigen Mann vor sich zu sehen. Bald wiederum hätte sie gewünscht, es möchte in bescheidenen Verhältnissen bei ihr bleiben, nur voll Zärtlichkeit und Liebe stets sie umfangen. Mit der eigennützigen Liebe eines Mutterherzens wünschte sie nur, dass es ihr Sohn bliebe, nur ihr Sohn und weiter nichts. Aber ihre Vernunft sagte ihr wieder, dass er irgend einen großen Platz in der Welt ausfüllen müsse.
Sie setzte sich an einem Grabenrand nieder und betrachtete ihn lange. Es schien ihr als hätte sie ihn noch nie richtig angesehen. Und plötzlich verwunderte sie sich bei dem Gedanken, dass dieses kleine Wesen einmal groß sein, dass es mit festem Schritte einhergehen, einen Bart haben und mit männlicher Stimme reden würde.
Von weitem rief sie jemand an; sie blickte auf. Marius kam angelaufen. Sie dachte, dass irgend ein Besuch ihrer wartete und erhob sich, missvergnügt über diese Störung. Der Bursche lief aus Leibeskräften, und als er nahe genug war schrie er: »Frau Baronin ist sehr schlecht geworden, Madame!«
Es war ihr, als wenn ein Tropfen kaltes Wasser den Rücken herabliefe; und mit gesenktem Haupte rannte sie eiligst nach Hause.
Schon von weitem sah sie eine Menge Leute unter der Platane stehen. Sie stürzte vor und bemerkte, als die Gruppe sich öffnete, ihre Mutter auf der Erde liegend, den Kopf von zwei Kissen unterstützt. Ihr Gesicht war ganz schwarz, ihre Augen geschlossen; und ihre sonst so wogende Brust rührte sich nicht. Die Amme nahm das Kind auf den Arm und brachte es fort.
»Was ist geschehen?« fragte Johanna heftig. Wie kam sie zu Falle? Man muss gleich zum Arzt schicken!« Sich umwendend bemerkte sie den Pfarrer, der durch irgend einen Zufall schon benachrichtigt war, und nun kam, seine Dienste anzubieten. Er schob auch sofort die Ärmel seiner Soutane zurück, aber alle seine Einreibungen mit Essig und Kölnisch-Wasser blieben wirkungslos. »Man sollte sie auskleiden und sofort zu Bett bringen,« meinte der Priester.
Der Pächter Joseph Couillard war zur Stelle, ebenso Papa Simon und Ludivine. Unterstützt vom Abbé Picot wollten sie die Baronin forttragen; aber als sie sie aufhoben, sank der Kopf hintenüber, und das Kleid zerriss ihnen unter den Händen. So schwer und unbeholfen war der mächtige Körper. Johanna schrie vor Schreck’ laut auf.
Man holte einen Sessel aus dem Salon, und konnte sie so endlich, nachdem man sie darauf gesetzt, forttragen. Schritt für Schritt ging es die Rampe herauf, dann über die Treppe ins Schlafzimmer, wo man sie aufs Bett legte.
Als die Köchin mit dem Auskleiden nicht fertig werden konnte, fand sich gerade zur rechten Zeit die Witwe Dentu ein. Sie war ebenso unerwartet gekommen wie der Priester. »Als ob sie den Tod gerochen hätten,« sagten die Dienstboten.
Joseph Couillard eilte schleunigst zum Arzte. Als der Pfarrer sich anschickte, das heilige Öl hervorzuholen, flüsterte die Krankenwärterin ihm zu: Bemühen Sie sich nicht, Herr Abbé, es ist schon vorbei: ich kenne mich aus.«
Johanna weinte bitterlich; sie wusste nicht, was sie machen sollte. Vergeblich sann sie auf ein Mittel, das man hätte anwenden können; der Priester erteilte auf alle Fälle die General-Absolution.
So harrte man zwei Stunden bei dem blauangelaufenen leblosen Körper. Johanna war jetzt in die Knie gesunken und schluchzte von Angst und Schmerz zerrissen.
Als die Tür sich öffnete und der Arzt erschien, glaubte sie wieder Heilung, Trost und Hoffnung mit ihm eintreten zu sehen. Sie stürzte auf ihn zu und berichtete ihm in abgerissenen Sätzen alles, was sie von der Sache wusste: »Sie ging spazieren, wie alle Tage … es ging ihr gut … sehr gut sogar … sie hat zum Frühstück eine Bouillon mit zwei Eiern genommen … sie ist plötzlich umgesunken … sie ist ganz schwarz geworden, wie Sie sehen … und hat sich nicht mehr gerührt … Wir haben alles versucht, um sie wieder zu sich zu bringen … alles.« Sie schwieg, überrascht durch eine heimliche Handbewegung der Wärterin, die dem Arzt bedeuten wollte, dass alles aus sei, völlig aus. Johanna sträubte sich, die Wahrheit zu begreifen; ängstlich wiederholte sie die Frage: »Ist es schlimm, Herr Doktor? Glauben Sie, dass es schlimm ist?«
»Ich glaube allerdings« … sagte er endlich »ich fürchte beinahe … dass … es zu Ende ist. Seien Sie stark, Madame, fassen Sie Mut.«
Johanna warf sich mit ausgebreiteten Armen auf ihre Mutter.
Als Julius zurückkam, blieb er fassungslos, sichtlich bestürzt stehen. Kein Ruf des Schmerzes oder der Verzweiflung drang von seinen Lippen; die Überraschung war zu groß, als dass sie sich äusserlich in seinen Mienen kundgegeben hätte. »Ich sah es kommen; ich wusste dass es zu Ende ging«, murmelte er vor sich hin. Dann zog er sein Taschentuch, wischte sich die Augen, kniete nieder, bekreuzigte sich und sprach ein stilles Gebet. Als er dann wieder aufstand, wollte er auch seine Frau mit emporrichten. Aber sie hielt den Leichnam mit beiden Armen unter steten Küssen umfangen; sie lag fast auf ihm. Man musste sie mit Gewalt fortbringen; sie schien den Verstand verloren zu haben.
Nach einer Stunde gestattete man ihr zurückzukehren. Jede Hoffnung war dahin. Das Schlafgemach war jetzt als Leichenzimmer eingerichtet. Julius und der Geistliche sprachen leise in einer Fensterecke. Die Witwe Dentu sass auf einen Sessel in ziemlich bequemer Haltung, wie eine Frau die an Nachtwachen gewöhnt ist und sich in einem Hause heimisch fühlt, sobald der Tod dort seinen Einzug gehalten hat; sie schien bereits eingenickt zu sein.
Die Nacht brach herein. Der Pfarrer trat auf Johanna zu, fasste sie bei der Hand, sprach ihr Mut ein und suchte durch geistige Tröstung einen heilsamen Balsam auf die Wunden ihres zerrissenen Herzens zu träufeln. Er sprach von der Dahingeschiedenen, er feierte sie in beredten Worten, und indem er einen Schmerz zur Schau trug, der seiner priesterlichen Auffassung vom Leben nach dem Tode nicht ganz entsprach, bot er sich an, die Nacht betend bei der Leiche zuzubringen.
Aber Johanna lehnte zwischen ihren strömenden Tränen dieses Anerbieten ab. Sie wollte allein sein, ganz allein in dieser schmerzlichen Abschiedsnacht. »Aber das geht doch nicht; wir wollen alle beide bleiben«, mischte sich Julius ein. Sie verneinte durch ein Kopfschütteln, unfähig ein Wort zu sprechen. »Es ist meine Mutter, meine einzige Mutter. Ich will allein mit ihr sein« sagte sie endlich. »Lassen Sie ihr den Willen;« mahnte der Doktor »die Wärterin kann im Nebenzimmer bleiben.«
Der Pfarrer und Julius fügten sich; beide waren müde. Nun kniete sich der Abbé Picot seinerseits nieder, betete, erhob sich und verabschiedete sich mit den Worten: »Es war eine Heilige« ungefähr als wenn er sein »Dominus vobiscum« sprach.
»Willst Du nicht etwas nehmen?« fragte Julius, der seine gewöhnliche Stimme wiedererlangt hatte. Johanna antwortete nicht; sie hatte gar nicht bemerkt, dass er sich zu ihr gewandt hatte. »Du würdest gut tun, etwas zu Deiner Stärkung zu nehmen« begann er wieder. »Schick nur schnell nach Papa« antwortete sie halb unwillig. Und er ging hinaus, um einen berittenen Boten nach Rouen zu schicken.
Sie blieb in einer Art regungslosen Schmerz versunken zurück, als hätte sie darauf gewartet, sich ganz der wogenden Verzweiflung in dieser Stunde des letzten Zusammenseins überlassen zu können.
Die Schatten der Nacht hatten sich auf das Gemach herabgesenkt und hüllten die Tote in Finsternis. Die Witwe Dentu trippelte auf den Fussspitzen umher und suchte nach allen möglichen Dingen, die sie mit der geräuschlosen Art einer Krankenwärterin hier und dort zurechtlegte. Dann zündete sie zwei Kerzen an und stellte sie leise auf den Nachttisch am Kopfende des Bettes, den sie mit einem weißen Tuche bedeckt hatte.
Johanna schien nichts zu sehen und nichts zu hören. Sie wartete darauf, allein zu sein. Julius kam zurück, nachdem er gegessen hatte. »Willst Du wirklich nichts zu Dir nehmen?« fragte er nochmals. Sie verneinte abermals durch ein Kopfschütteln.
Er setzte sich mehr resigniert wie traurig nieder, und wartete, ohne weiter zu sprechen.
So blieben sie alle drei, jedes für sich, auf ihren Plätzen.
Hin und wieder schnarchte die eingeschlafene Wärterin; dann erwachte sie plötzlich.
Julius erhob sich endlich und näherte sich Johanna. »Willst Du jetzt allein bleiben?« Sie ergriff mit einer unwillkürlichen Hast seine Hand und sagte: »Ach ja! lass mich allein.«
»Ich werde von Zeit zu Zeit nach Dir sehen«, murmelte er, sie auf die Stirn küssend. Und er ging mit der Witwe Dentu heraus, die ihren Sessel ins Nebenzimmer rollte.
Johanna schloss die Tür; dann öffnete sie weit die beiden Fenster. Mit vollen Zügen sog sie den Duft der draussen lagernden Heuernte ein. Es war gerade zurzeit, wo man den reichen Bestand der Wiesen abgemäht hatte, der nun unter dem vollen Mondlicht seinen würzigen Duft ausströmte.
Dieses süsse Empfinden machte ihr übel; es verletzte sie wie eine bittere Ironie.
Sie näherte sich wieder dem Bette, ergriff die eine leblose kalte Hand und betrachtete ihre Mutter.
Sie war nicht mehr so angeschwollen, wie im Augenblick des Unfalls und schien zu schlafen; viel friedlicher sogar, als es sonst bei ihr der Fall war. Die vom Luftzuge hin und herbewegten Kerzenflammen veränderten jeden Augenblick die Schatten auf ihrem Gesicht, sodass man hätte denken sollen, sie lebe und habe sich bewegt.
Johanna starrte sie unablässig an, während aus ihrer frühesten Jugendzeit eine Fülle von Erinnerungen auf sie einstürmte.
Sie rief sich Mütterchens Besuche im Sprechzimmer des Klosters vor Augen, die Art und Weise wie sie ihr die Düte voll Kuchen gab; eine Menge Einzelheiten, kleiner Ereignisse, Zärtlichkeitsbeweise, Worte, Redensarten, ständiger Gebärden, die Falten um ihre Augen beim Lachen, der tiefe erstickte Seufzer, mit dem sie sich niedersetzte, das alles kam ihr in Erinnerung.
Und so stand sie da im Anschauen versunken immer wieder die Worte »Sie ist tot« wie halb von Sinnen vor sich hermurmelnd. Erst allmähllich verstand sie den ganzen Umfang derselben.
Dieser Körper, der da ruhte – Mama – ihr Mütterchen – Madame Adelaide, war also tot. Sie würde sich nie mehr regen, nie mehr sprechen, nie mehr lachen, niemals mehr Papa gegenüber bei Tische sitzen. Sie würde nie mehr »Guten Morgen Jeannette« sagen. Sie war eben tot!
Man würde sie in einen Sarg legen und sie begraben, und dann war alles zu Ende. Man würde sie nicht mehr sehen. War das möglich? Hatte sie denn wirklich kein Mütterchen mehr? Dieses teure, traute Antlitz, in das sie geschaut von dem Augenblick an, wo sie die Augen geöffnet hatte, das sie geliebt von der Minute an, wo sie die Ärmchen ausbreiten konnte; dieser Gegenstand ihrer ganzen Zärtlichkeit, dieses einzige Wesen, die Mutter, dem Herzen teurer als alle andren Wesen, existierte nicht mehr. Sie konnte es nur noch einige Stunden betrachten dieses regungslose starre Antlitz. Und dann nichts, nichts mehr! nur noch eine Erinnerung.
Sie warf in einem furchtbaren Anfall von Verzweiflung sich auf die Knie und krallte die Hände krampfhaft in die Falten des Leinentuches. »Ach Mutter, meine arme Mutter, meine Mutter!« rief sie mit herzzerreissender Stimme, halberstickt in den Decken und Kissen, während sie den Mund auf das Bettzeug presste.
Als sie sich dann wieder ganz von Sinnen fühlte, so von Sinnen wie damals in jener Nacht ihrer Flucht durch den Schnee, sprang sie auf und rannte ans Fenster, um sich zu erfrischen und die Luft einzuatmen, von der die Tote da auf ihrem letzten Ruhelager nichts mehr spürte.
Der abgemähte Rasen, die Bäume, die Heide, das Meer da drüben lagen in friedlichem Schweigen, entschlummert unter dem milden Lichte des Mondes. Auch in Johannas Herz drang etwas von dieser beruhigenden Milde und sie begann langsam zu weinen.
Dann kehrte sie wieder an das Bett zurück und setzte sich nieder, die eine Hand in die ihrige nehmend, als wachte sie bei einer Kranken.
Ein großer Nachtschmetterling, war angezogen von dem Lichtschimmer, hereingeflogen. Er schlug an die Wände wie ein Ball, und flog von einem Ende des Zimmers zum anderen. Johanna, von seinem schnurrenden Fluge aufmerksam geworden, hob die Augen um nach ihm auszuschauen. Aber sie bemerkte nichts, als seinen Schatten, der an der weißen Zimmerdecke umherirrte.
Dann hörte sie nichts mehr. Doch nun vernahm sie das »Tik-Tak« der Stutzuhr und ein anderes leichtes Geräusch, oder vielmehr ein fast kaum bemerkbares Sausen. Es war Mütterchens Taschenuhr die, vergessen in ihrem Kleide auf einem Stuhle, noch immer weiter ging. Und plötzlich brach der etwas verhaltene bittre Schmerz in ihrem Herzen aufs neue hervor, wie sie das kleine weitergehende Uhrwerk an die leblose Tote da auf dem Bette erinnerte.
Sie sah nach der Zeit. Es war halb elf. Eine furchtbare Angst, diese ganze Nacht da zuzubringen, ergriff sie.
Andere Erinnerungen tauchten vor ihren Augen auf: Aus ihrem eigenen Leben – Rosalie, Gilberte – die bitteren Enttäuschungen ihres Herzens. Alles war doch nur Elend, Trübsal, Unglück und Tod. Alles täuschte, alles log, brachte Leid und Tränen. Wo fand sich denn noch ein freundliches Ruheplätzchen? Im anderen Leben jedenfalls. Wenn die Seele vom Erdenstaub befreit war. Die Seele! Sie begann über dieses unerforschliche Geheimniss nachzugrübeln in dem sie sich plötzlich jenen poesievollen Träumereien hingab, wo eine Vorstellung der anderen folgt, ohne ein Bild zu schaffen. Wo weilte wohl jetzt die Seele ihrer Mutter? Die Seele, die zu diesem regungslosen eiskalten Körper gehört hatte? Wohl weit von hier. Irgendwo im unermesslichen Himmelsraume. Aber wo? Verflüchtet wie der Duft einer abgestorbenen Blume? Oder planlos umherschweifend wie ein unsichtbarer Vogel, der dem Käfig entschlüpft ist?
War sie zu Gott zurückgekehrt? Oder beliebig unter neuen Schöpfungen verstreut, mit Keimen vermischt, die zur Frucht heranreiften?
Ganz in ihrer Nähe vielleicht? Weilte sie etwa noch in diesem Zimmer, umkreiste sie den starren Körper, den sie verlassen? Johanna glaubte einen Hauch zu verspüren, wie die Berührung eines Geistes. Sie hatte Furcht, gewaltige Furcht, so heftig, dass sie sich kaum zu regen wagte; ihr Atem stockte, sie vermochte nicht sich umzuwenden, um hinter sich zu schauen. Ihr Herz pochte laut vor Entsetzen.
Plötzlich nahm der Schmetterling seinen unsichtbaren Flug wieder auf und begann rings an die Wände zu klatschen. Ein Schauer durchrieselte sie von oben bis unten; aber dann erkannte sie das Brummen des geflügelten Wesens wieder und beruhigte sich. Sie erhob sich und wandte sich um. Ihr Blick fiel auf den Schreibtisch mit den Sphinx-Köpfen, den Aufbewahrungsort der »Reliquien.«
Eine sonderbare zartfühlende Idee durchzuckte ihr Hirn. Sie wollte lesen, lesen in diesen der Toten so teuren Briefen, heute in der Stunde der letzten Nachtwache, wie sie ein frommes Buch gelesen haben würde. Es kam ihr vor, als erfülle sie eine süsse heilige Pflicht, einen Akt kindlicher Pietät, der der Toten drüben in der andren Welt Freude bereiten würde.
Es waren die alten Briefe ihrer Großeltern, die sie nicht gekannt hatte. Sie wollte ihnen über dem Körper der Tochter die Hand reichen, sich mit ihnen in dieser düstren Nacht vereinen, als hätten sie Teil an diesem Leid; sie wollte eine Art geheimnisvolle Zärtlichkeitskette bilden zwischen den Toten von damals, der stillen Leiche dort und ihr selbst, die noch auf Erden verblieben war.
Sie öffnete die Schreibtischplatte und entnahm der unteren Schieblade ein Dutzend der kleinen gelblichen Papierbündel, welche in musterhafter Ordnung nebeneinander lagen.
Mit einer Art wohlbedachter Sentimentalität breitete sie dieselben auf dem Bett zwischen den Armen der Toten aus und schickte sich an zu lesen.
Es waren jene ehrwürdigen Briefschaften, wie man sie in alten Familienschreibtischen findet; jene Briefschaften, die die Luft eines andren Jahrhunderts atmen.
»Meine Teure!« begann der erste Brief; auf einem zweiten stand »Mein liebes Töchterchen!« dann kam: »Mein Herzchen!« – »Mein angebetetes Töchterchen!« – Liebes Kind!« – »Liebe Adelaïde« – »Liebe Tochter«, je nachdem sie sich an das Kind, an die Tochter und später an die junge Frau richteten.
Und das alles atmete so viel leidenschaftliche Zärtlichkeit, so viel Liebe zum Kinde; es erzählte so viel große und kleine Geheimnisse, und dazwischen wieder allerhand Dinge, die dem Fernerstehenden gleichgültig waren: »Papa hat die Grippe; die Zofe Hortense hat sich den Finger verbrannt; die Katze ›Croquerat‹ ist tot; die Tanne rechts vom Tore ist gefällt worden; Mutter hat ihr Gebetbuch auf dem Rückweg von der Kirche verloren, sie glaubt dass es gestohlen ist.«
Auch von Leuten war darin die Rede, die Johanna zwar persönlich nicht gekannt hatte, deren Namen sie sich aber noch dunkel aus ihrer ersten Jugendzeit erinnerte.
Mit wahrer Zärtlichkeit vertiefte sie sich in diese Einzelheiten, welche ihr wie eine Art Totenerweckung vorkamen. Es war ihr, als trete sie plötzlich in die Vergangenheit ein, als sehe sie alle Geheimnisse, das eigentliche Herzensleben ihrer Mutter vor sich. Sie betrachtete wieder den Leichnam, und plötzlich begann sie ganz laut zu lesen; sie las für die Tote, als wolle sie ihr Zerstreuung und Tracht bringen.
Es kam ihr vor, als ob der Gesichtsausdruck der Verstorbenen ein glücklicher wäre.
Einen nach dem andren legte sie die Briefe zu Füssen des Bettes; sie meinte, man müsse sie statt der Blumen ihr in den Sarg mitgeben.
Sie öffnete ein neues Packet. Es war eine andere Schrift. »Ich kann Deine Zärtlichkeit nicht entbehren. Ich liebe Dich zum Rasendwerden« las sie halblaut.
Weiter nichts; keine Unterschrift.
Verständnislos drehte sie das Papier um. »Madame la baronne Le Perthuis des Vauds« lautete deutlich die Adresse.
Dann öffnete sie das folgende Billet: »Komm’ heute Abend, sobald er fort ist. Wir werden eine Stunde für uns haben. Ich bete Dich an.«
»Ich habe eine Nacht in rasendem Verlangen nach Dir durchträumt. Ich hielt Dich in meinen Armen, Deinen Mund unter meinen Lippen, Deine Augen unter meinen Augen. Und dann hätte ich mich vor Wut aus dem Fenster stürzen können, wenn ich daran dachte, dass Du zu dieser Zeit neben ihm ruhtest, ihm ganz zu eigen wärst …«
Johanna hielt verständnislos inne. Was war das? An wen, für wen, von wem waren diese Liebesbeteuerungen?
Wieder fortfahrend fand sie stets wieder diese wahnwitzigen Liebesschwüre, diese Stelldicheins mit Mahnungen zur Vorsicht, und stets zum Schluss die fünf Worte: »Verbrenne vor allem diese Zeilen!«
Endlich öffnete sie ein nichtssagendes Billet, eine einfache Zusage zu einem Diner, aber mit derselben Handschrift und »Paul d’Ennemare« unterzeichnet. Es war derselbe, den der Baron immer »mein guter alter Paul« nannte, wenn er von ihm sprach, und dessen Gattin die intimste Freundin der Baronin gewesen war.
Johanna’s Zweifel wurden jetzt plötzlich zur vollen Gewissheit. Ihre Mutter hatte einen Liebhaber gehabt?
Und mit einem heftigen Ruck schleuderte sie diese schändlichen Papiere von sich wie ein giftiges Reptil, das sich an ihr emporgewunden hatte. Sie lief an’s Fenster und weinte bitterlich, wobei ein heftiges Schluchzen ihr die Kehle zuschnürte. Dann brach sie ganz vernichtet am Fuss der Fensterbrüstung nieder und verbarg ihr Gesicht in den Vorhängen, damit man ihre Seufzer nicht hörte. So weinte sie in tiefster Verzweiflung bitterlich vor sich hin.
Sie würde vielleicht die ganze Nacht so zugebracht haben, wenn nicht das Geräusch von Schritten im Zimmer nebenan sie mit einem Satze aufspringen lassen. War das etwa ihr Vater? Und alle diese Briefe lagen auf dem Bett und auf dem Fussboden zerstreut! Er brauchte nur einen derselben zu öffnen, um alles zu wissen! Er!
Sie stürzte vorwärts und raffte hastig alle diese gelben Papiere zusammen, die Briefe der Großeltern wie des Liebhabers, die, welche sie schon gelesen hatte und jene, die noch unberührt in der Schieblade lagen, um sie in den Kamin zu werfen. Dann nahm sie eine der brennenden Kerzen vom Tisch und entzündete den Papierstoss. Eine helle Flamme züngelte empor, und beleuchtete das Zimmer, das Bett und den Leichnam mit lebhaften auf- und abtanzendem Lichte, das mit schwarzen Umrissen auf dem weißen Vorhange hinter dem Bette das zitternde Profil des starren Antlitzes und die Linien des mächtigen Körpers unter den Betttüchern abzeichnete.
Als nur noch ein Häuflein Asche auf dem Boden des Kamins lag, kehrte sie zurück und setzte sich an’s offene Fenster, als wenn sie nicht mehr wagte in der Nähe der Toten zu sein. Das Gesicht in den Händen begann sie aufs Neue zu weinen.
»O, meine arme Mama, meine arme Mama!« seufzte sie unaufhörlich mit verzweiflungsvollem Klagelaut.
In dieser unglücklichen Stunde wurde ein gutes Teil der Kindesliebe in ihrem Herzen ausgelöscht. Die Kenntnis von dem Geheimnis ihrer Mutter wirkte wie ein kalter Wasserstrahl auf ihr Gemüt.
Als Julius später nochmals erschien, und sie aufforderte, doch etwas zu schlafen, sträubte sie sich nicht. Mit einem letzten Kuss auf die bleiche kalte Stirn der Toten verliess sie das Zimmer.
Der Baron kam am Abend des nächsten Tages; seine Tränen flossen unaufhaltsam.
Die Teilnahme am Begräbnisse war eine aussergewöhnliche und mit hoher Befriedigung sah Julius, dass von dem ganzen Adel der Umgegend kein einziger fehlte. Die Marquise de Coutelier hatte sogar Johanna wiederholt umarmt und geküsst.
Tante Lison, die gleichfalls gekommen war, blieb mit Gilbert während der Feierlichkeit bei Johanna. »Mein armes, teures Herz« sagte die Gräfin immer wieder unter Küssen und Tränen zu der völlig gebrochenen Tochter.
Als der Graf vom Begräbnisse zurückkehrte, weinte er, als habe er seine eigene Mutter zur Ruhe gebettet.
*