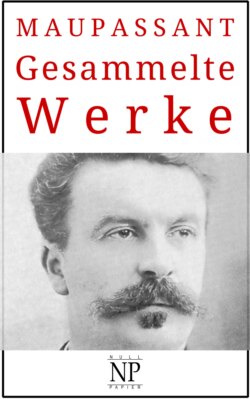Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 72
VII.
ОглавлениеDas Kartenspiel fing jetzt an, im Leben des jungen Paares eine Rolle zu spielen. Jeden Tag nach dem zweiten Frühstück spielte Julius mehrere Partien Besigue mit seiner Frau, wobei er fortwährend seine Pfeife rauchte und sich die Kehle mit Cognak ausspülte, von dem er sechs bis sieben Gläschen trank. Hierauf ging Johanna in ihr Zimmer, setzte sich ans Fenster und stickte lässig an dem Saum eines Rockes, während der Regen an die Fenster schlug und der Wind an den Läden rüttelte. Hin und wieder hob sie ermattet den Blick und betrachtete in der Ferne das tobende Meer. Dann, nachdem sie eine Weile so ins Leere gestarrt hatte, nahm sie unmutig ihre Arbeit wieder auf.
Im Übrigen gab es für sie wirklich nichts anderes zu tun; denn Julius hatte die Leitung des ganzen Haushaltes an sich gerissen, um dem Bedürfnisse seiner Herrschsucht und seinem Hang zur Sparsamkeit zu genügen. Er war von einem geradezu lächerlichen Geize beseelt, gab niemals ein Trinkgeld und beschränkte die Kost der Leute aufs Äusserste. Selbst Johanna musste darunter leiden. Früher hatte sie sich, solange sie in Peuples war, jeden Morgen durch den Bäcker einen kleinen normannischen Wecken bringen lassen. Julius erklärte dies für Luxus und sie musste sich mit gerösteten Brotschnittchen begnügen.
Sie wagte keine Einwendungen, um den endlosen Auseinandersetzungen, Debatten und Klagen zu entgehen; aber jeder neue Beweis von dem Geize ihres Mannes wirkte auf sie wie ein Nadelstich. Ihr, die in einer Atmosphäre groß geworden war, wo das Geld keine Rolle spielte, schien das niedrig und verabscheuenswert. »Das Geld ist doch da, dass man es ausgibt«, hatte sie ihre Mutter so oft sagen hören; jetzt hiess es bei Julius: »Kannst Du Dir denn gar nicht abgewöhnen, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen?« Und jedes Mal, wenn er von einer Lohnzahlung oder einer Rechnung einige Sous abgezwackt hatte, ließ er schmunzelnd das Geld in die Tasche gleiten, indem er sagte: »Aus kleinen Bächen fliessen die großen Ströme zusammen.«
Zuweilen indessen verfiel sie wieder in ihre geliebte alte Träumerei. Sie hörte langsam auf zu arbeiten, ihre Hände glitten in den Schos, und den Blick versunken, gab sie sich den selbstgesponnenen Romanen ihrer Mädchenzeit hin, in denen sie allerhand niedliche Abenteuer im Geiste erlebte. Aber plötzlich weckte sie dann die Stimme ihres Mannes, der dem alten Papa Simon irgend einen Befehl gab, aus diesen süssen Träumen. »Es ist zu Ende«, sagte sie dann, ihre Arbeit wieder aufnehmend, während eine Träne auf ihre Finger fiel, die die Nadel führten.
Auch Rosalie, die ehemals so vergnügt war und den ganzen Tag über sang, hatte sich vollständig verändert. Ihre einst so blühenden vollen Wangen hatten die frische rote Farbe verloren; sie schienen jetzt eingefallen und zeigten zuweilen eine aschgraue Färbung.
»Bist Du krank, liebes Kind?« fragte Johanna sie öfters.
»Nein, Madame«, antwortete das Mädchen stets, wobei ihr das Blut ins Gesicht stieg. Und dann entfernte sie sich rasch.
Statt wie sonst leichten Schrittes dahinzufliegen, schleppte sie sich jetzt mühsam herum. Sie hatte ihre einstige Schelmerei vollständig verloren und machte keine Einkäufe mehr bei den Hausierern, die ihr umsonst ihre seidenen Tücher, ihre Korsets und ihre Parfümerien anboten.
Das Haus mit seiner regen geschwärzten Fassade machte einen finsteren traurigen Eindruck, und die Schritte der Menschen widerhallten in demselben wie in einer Gruft.
Gegen Ende Januar war starker Schneefall. Man sah von Weitem die großen schweren Wolken aus Norden her über das schwarze Meer dahinjagen, und dann begann der Flockentanz. In einer Nacht war die ganze Gegend in Schnee gehüllt und am anderen Morgen trugen Bäume und Sträucher die bekannte weiße Verzierung.
Julius, in hohen Stiefeln, das Gesicht in Falten, verbrachte seine Zeit damit, dass er, im Hintergrunde des Bosquets in einem Graben kauernd, der nach der Heide zu mündete, auf Zugvögel schoss. Von Zeit zu Zeit hallte ein Flintenknall durch das eisige Schweigen der Flur; Scharen von aufgescheuchten Krähen erhoben sich in die Luft, um sich dann wieder auf den umstehenden Bäumen niederzulassen.
Johanna, von Langeweile gequält, trat hin und wieder auf die Schlossrampe heraus. Nur von Weitem widerhallte lebendiges Treiben durch die schläfrige Ruhe, die über dem öden traurigen Schneetuche lag.
Sonst hörte sie nichts als das entfernte Grollen des Meeres und das unbestimmte fortgesetzte Geräusch des fallenden Schnees.
Dichter und dichter hüllte sich die Erde in diesen weißen flockigen Mantel ein.
An einem dieser öden Wintermorgen sass Johanna am Kamin und wärmte sich die Füsse, während Rosalie, stets mehr und mehr verändert, langsam das Bett machte. Plötzlich hörte die junge Frau hinter sich einen tiefen Seufzer.
»Was hast Du nur?« fragte sie ohne sich umzusehen.
»Nichts, Madame«, antwortete das Mädchen wie immer. Aber ihre Stimme schien zitternd und kläglich.
Johanna dachte schon wieder an etwas anderes, als ihr plötzlich auffiel, dass sie kein Geräusch mehr von dem jungen Mädchen hörte. »Rosalie!« rief sie; aber nichts rührte sich. »Rosalie!« rief sie lauter, weil sie glaubte, das Mädchen sei herausgegangen. Schon streckte sie die Hand nach dem Glockenzuge neben ihr aus, als ein tiefer Seufzer ganz dicht hinter ihr sie veranlasste, sich erschreckt umzuwenden.
Die Kammerzofe sass bleich mit verstörtem Blick auf dem Boden, den Rücken an das Bett gelehnt.
»Was hast Du; was fehlt Dir?« rief Johanna vortretend.
Jene sprach kein Wort, machte keine Bewegung. Sie heftete den verwirrten Blick auf ihre Herrin und stöhnte, wie von furchtbaren Schmerzen gepeinigt. Dann plötzlich krümmte sich ihr ganzer Körper, sie glitt auf den Rücken und stiess zwischen den zusammengebissenen Zähnen einen entsetzlichen Schrei hervor.
Dann regte sich etwas unter ihren Röcken zwischen den auseinander gesperrten Schenkeln. Ein seltsamer Ton, ein Kollern, ein ersticktes Gurgeln drang hervor. Plötzlich klang es wie das langverhaltene Miauen einer Katze, wie ein leises klägliches Gewimmer; der erste Schmerzensschrei eines neugeborenen Kindes.
Johanna begriff plötzlich alles; sie verlor völlig den Kopf, und »Julius! Julius!« rufend, stürzte sie an die Treppe.
»Was gibt’s denn?« antwortete Jener von unten her.
»Ach … komm nur ’mal … Rosalie hat …« konnte sie kaum hervorbringen.
Zwei Stufen auf einmal nehmend stürmte Julius herauf, trat eiligst ins Zimmer, lüftete mit einem Ruck die Kleider des Mädchens und entdeckte ein schauderhaft elendes, runzliges, wimmerndes, verschrumpftes und schmutziges Wurm, das zwischen den entblössten Beinen lag.
Er wandte sich zornig um, schob seine entsetzte Frau zur Tür hinaus und sagte:
»Das ist nichts für Dich. Geh hinunter und schick mir Ludivine und Papa Simon.«
Johanna stieg zitternd in die Küche herunter. Sie wagte nicht wieder heraufzugehen und trat in den Salon, der seit der Abreise ihrer Eltern nicht mehr geheizt worden war. Dort wartete sie ängstlich auf weitere Nachrichten.
Bald sah sie den alten Diener eiligst über den Hof laufen und kurze Zeit darauf mit der Witwe Dentu, der Hebamme des Ortes, zurückkehren. Dann gab es ein großes Geräusch auf der Treppe, als ob man einen Verwundeten hinuntertrüge. Julius kam herein und sagte ihr, sie könnte wieder heraufgehen.
Sie zitterte, als hätte sie Zeugin eines furchtbaren Ereignisses sein müssen. »Wie geht es ihr?« fragte sie, sich wieder ans Feuer setzend.
Julius ging zerstreut und aufgeregt im Zimmer auf und ab; er schien sogar zornig zu sein. Zuerst antwortete er gar nichts und setzte seinen Spaziergang durchs Zimmer fort.
»Was denkst Du mit dem Mädchen anzufangen?« fragte er dann nach einiger Zeit.
Sie sah ihn verständnislos an.
»Wie? Was wolltest Du sagen? Ich kenne mich nicht aus.«
»Wir können doch keinen Bastard in unserem Hause behalten,« schrie er plötzlich zornig auf.
Johanna war anfangs ganz verwirrt.
»Aber, mein Lieber, vielleicht könnte man das Kind in Pflege geben,« sagte sie dann nach längerem Schweigen.
»Und wer soll das bezahlen?« unterbrach er sie. »Du wohl jedenfalls, nicht wahr?«
Sie dachte lange über eine Lösung nach.
»Aber das wird doch der Vater des Kindes tun,« sagte sie dann. »Und wenn er Rosalie heiratet, dann sind ja weiter keine Schwierigkeiten.«
»Der Vater? … der Vater? …« rief Julius wie am Ende seiner Geduld ganz ausser sich. »Kennst Du ihn denn, … den Vater? … Nein … natürlich nicht … Nun also, was? …«
»Aber er kann doch das Mädchen nicht so im Stich lassen,« sagte sie entrüstet. »Das wäre eine Feigheit. Wir wollen nach seinem Namen fragen, ihn aufsuchen und er muss sich erklären.«
Julius hatte sich beruhigt und begann wieder auf und ab zu gehen.
»Aber meine Liebe, sie will ihn nicht nennen, den Namen dieses Mannes; sie wird Dir auch nicht mehr bekennen, wie mir … und wenn er nichts von ihr wissen will, der Vater …? Wir können doch unmöglich eine Mutter mit ihrem Bankert unter unserem Dache behalten. Begreifst Du das?«
»Dann ist es ein Elender, dieser Mensch,« sagte Johanna entrüstet. »Aber wir müssen ihn herauszubekommen suchen, und dann soll er Rede und Antwort stehen.«
»Aber … angenommen …« erhitzte sich Julius, aufs neue sehr rot werdend.
»Was schlägst Du denn vor?« unterbrach sie ihn, nicht wissend, wofür sie sich entscheiden sollte.
»Nun, was mich betrifft,« sagte er schnell, »so ist die Sache sehr einfach. Ich würde ihr einiges Geld geben und sie mit ihrem Balg zum Kuckuck jagen.«
Aber die junge Frau widersetzte sich ganz empört.
»Das geschieht niemals,« sagte sie. »Dieses Mädchen ist meine Milchschwester; wir sind zusammen aufgewachsen. Sie hat einen Fehltritt getan, allerdings; aber ich werde sie deshalb nicht vor die Türe setzen. Und wenn es nötig ist, so werde ich das Kind aufziehen.«
»Und wir werden in ein schönes Gerede kommen«, brach Julius los, »wir anderen, mit unserem Namen und unseren Beziehungen! Überall wird es heissen, dass wir das Laster beschützen, dass wir das Gesindel warm halten. Anständige Leute werden den Fuss nicht mehr in unser Haus setzen. Woran denkst Du nur eigentlich? Du musst von Sinnen sein?«
»Ich werde Rosalie niemals hinauswerfen lassen«, sagte sie ruhig bleibend. »Wenn Du sie nicht hier behalten willst, so wird meine Mutter sie zu sich nehmen. Wir werden schliesslich doch den Namen des Vaters herausbekommen müssen.«
Da ging er wütend hinaus, schlug krachend die Tür zu und rief:
»Die Weiber sind verrückt mit ihren Ideen!«
Nachmittags ging Johanna zu der Wöchnerin herunter. Die Zofe, von Frau Dentu gepflegt, lag regungslos im Bett, während die Wärterin das neugeborene Kind auf den Armen wiegte.
Sobald sie ihre Herrin bemerkte, fing Rosalie an zu schluchzen und bedeckte von Scham gepeinigt das Gesicht mit dem Betttuch. Johanna wollte sie küssen, aber sie wehrte sich und ließ das Tuch nicht fahren. Da legte sich die Wärterin ins Mittel und zog das Tuch fort. Schliesslich ließ sie sich’s gefallen und weinte nur noch still vor sich hin.
Ein schwaches Feuer brannte im Kamin; es war kalt und das Kleine begann zu weinen. Johanna wagte nicht von ihm zu sprechen, aus Furcht, bei der Mutter abermals eine Erschütterung hervorzurufen. Sie hatte die Hand derselben ergriffen und sagte immer nur:
»Es hat nichts zu bedeuten, wirklich nicht.«
Das arme Mädchen blickte verstohlen auf die Wärterin und zuckte bei jedem Schrei des kleinen Würmchens zusammen. Von Zeit zu Zeit brach sie von Schmerz und Scham gepeinigt in krampfhaftes Schluchzen aus, während die zurückgehaltenen Tränen ein rasselndes Geräusch in ihrer Kehle hervorriefen.
Johanna küsste sie abermals und flüsterte ihr leise ins Ohr:
»Wir werden schon gut für das Kind sorgen.« Dann entfernte sie sich schnell, als ein neuer Tränenstrom im Anzug war.
Täglich ging sie zur Wöchnerin herunter, und jedes Mal brach Rosalie beim Anblick ihrer Herrin in Tränen aus.
Das Kind wurde bei einer Nachbarin in Pflege gegeben.
Julius sprach kaum noch ein Wort mit seiner Frau; es war, als hegte er einen großen Zorn gegen sie, dass sie die Zofe nicht entlassen wollte. Eines Tages kam er wieder auf dieses Thema zurück; aber sie zog einen Brief der Baronin aus der Tasche, worin dieselbe verlangte, dass man ihr sofort das Mädchen sende, falls es nicht in Peuples bleiben könnte.
»Deine Mutter ist ebenso verrückt wie Du«, schrie er erbost. Aber er bestand nicht weiter auf seinem Verlangen.
Drei Wochen später konnte die Wöchnerin sich wieder erheben und ihren früheren Dienst versehen.
Eines Morgens hiess Johanna sie Platz nehmen, ergriff ihre Hände und sagte, ihr forschend ins Auge schauend:
»Nun, Kind, sage mir alles.«
»Was denn, Madame?« stammelte Rosalie zitternd.
»Wem gehört es, das Kind?«
Da wurde das arme Mädchen von Verzweiflung ergriffen; ängstlich suchte es die Hände frei zu bekommen, um ihr Antlitz damit zu bedecken.
Aber Johanna küsste sie wider ihren Willen und sagte tröstend:
»Es ist ein Unglück; was soll man machen, Kind? Du bist schwach gewesen, aber das passiert anderen auch. Wenn der Vater Dich heiratet, wird sich niemand mehr darum kümmern. Und wir werden ihn mit Dir in unseren Dienst nehmen.«
Rosalie seufzte wie unter furchtbaren Qualen und machte von Zeit zu Zeit den Versuch loszukommen und davonzulaufen.
»Ich begreife Dein Schamgefühl völlig«, begann Johanna wieder, »aber Du siehst, dass ich Dir nicht böse bin, dass ich Dir im Guten zurede. Ich frage Dich nach dem Namen des Mannes nur zu Deinem Besten, weil ich mit Dir den Schmerz empfinde, dass er Dich im Stich lässt. Das möchte ich verhindern. Julius wird ihn schon finden, weißt Du; und wir werden ihn zwingen, Dich zu heiraten. Und da wir Euch dann beide unter den Augen haben, so werden wir auch dafür sorgen, dass er Dich glücklich macht.«
Diesmal machte Rosalie eine so krampfhafte Anstrengung, dass es ihr gelang, die Hände frei zu bekommen, worauf sie wie besessen zum Zimmer hinaus rannte.
»Ich wollte Rosalie bestimmen, mir den Namen ihres Verführers zu nennen«, sagte Johanna abends beim Diner zu ihrem Gatten, »aber ich habe keinen Erfolg gehabt. Versuche Du es doch noch einmal, damit wir den Elenden zwingen, sie zu heiraten.«
»Du weißt doch«, sagte Julius, sofort sehr hitzig werdend, »dass ich für meine Person von dieser Geschichte nichts mehr hören mag. Du hast das Mädchen behalten wollen; nun schön, behalte Sie. Aber verschone mich gefälligst mit dieser Angelegenheit.«
Seit der Niederkunft Rosaliens schien er ausserordentlich reizbarer Stimmung geworden zu sein. Er hatte sich angewöhnt nur noch in schreiendem Tone mit seiner Frau zu sprechen, als wenn er immerfort in Wut wäre. Sie dagegen dämpfte die Stimme und betrug sich sehr sanft, um jeden Zwist zu vermeiden. Zuweilen aber weinte sie nachts in ihrem Bette recht bitterlich.
Trotz seiner fortwährenden Reizbarkeit hatte Julius wieder angefangen, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen, die er seit ihrer Rückkehr so sehr vernachlässigt hatte. Selten vergingen einige Tage, wo er nicht das eheliche Schlafgemach mit ihr geteilt hätte.
Rosalie war bald vollständig genesen und wurde weniger traurig, obschon sie stets noch etwas gedrückter Stimmung war, wie wenn sie von irgend einer unerklärlichen Furcht beseelt wäre.
Zweimal noch machte Johanna den Versuch, sie wegen des Vaters zu befragen, aber jedes Mal wusste sich das Mädchen ihr zu entziehen.
Auch Julius schien in der letzten Zeit liebenswürdiger geworden zu sein. Die junge Frau gab sich schon wieder neuen Hoffnungen hin und ihre alte Heiterkeit kehrte zurück. Hin und wieder spürte sie allerdings eine eigentümliche Unbehaglichkeit, von der sie jedoch nicht sprach. Der Frost draussen hielt immer noch an, und seit nun bald fünf Wochen breitete sich ein kristallheller blauer Himmel, der nachts mit Milliarden funkelnder Sterne besäet war, über die dichte festgefrorene glänzende Schneefläche aus.
Die Pächterhäuser, einsam in ihren viereckigen Höfen, hinter einem Vorhang von großen dichtbereiften Bäumen, schienen wie in einem weißen Hemde eingeschlafen zu sein. Man sah dort weder Menschen noch Tiere herauskommen; nur die Ziegelschornsteine zeigten durch den dünnen Rauch, der sich aus ihnen emporringelte und kerzengrade in die kalte Luft aufstieg, dass noch Leben in dieser Einsamkeit war.
Die Ebene, die Hügel, die Ulmen am Saume des Parks, alles schien erstorben, hingemordet durch die Kälte. Zuweilen hörte man in den Bäumen ein Krachen, als wenn ihre hölzernen Glieder unter der Rinde geborsten wären; und mitunter löste sich ein großer Zweig ab und fiel zur Erde, nachdem der eisige Frost seinen Saft erstickt und seine Fasern zerrissen hatte.
Johanna wartete sehnsüchtig auf die Wiederkehr milderer Witterung, indem sie die unbestimmten Schmerzen, an denen sie litt, auf die Einwirkung der schrecklichen Kälte schob.
Bald konnte sie nichts essen und hatte einen Abscheu vor jeder Nahrung, bald schlug ihr Puls heftig, bald verursachte ihr die kleinste Mahlzeit die stärksten Indigestionen. Ihre Nerven waren seltsam erregt und sie lebte in einem beständigen und unerträglichen Wechsel der Gefühle.
Eines Abends stand das Thermometer noch niedriger wie gewöhnlich. Julius sass vor Frost zitternd bei Tische, denn im Speisezimmer wurde, um Holz zu sparen, niemals geheizt. »Heute Abend wollen wir behaglich zu zweien schlafen, nicht wahr, mein Schatz?« sagte er, sich die Hände reibend.
Er lachte mit seinem alten gutmütigen Lächeln und Johanna flog ihm an den Hals. Aber sie fühlte sich gerade an diesem Abend so unwohl, so voll Schmerzen, so seltsam nervös, dass sie ihn leise unter zärtlichen Küssen bat, sie heute allein zu lassen. Sie setzte ihm mit wenigen Worten ihr Unwohlsein auseinander. »Ich bitte Dich, Liebster, ich versichere Dich, dass ich nicht wohl bin. Morgen wird mir jedenfalls besser sein.«
»Wie Du willst, Liebling,« sagte er nachgebend. »Sorg’ nur gut für Dich, wenn Du nicht wohl bist.«
Man sprach dann von anderen Dingen.
Johanna ging bei Zeiten schlafen. Julius ließ ausnahmsweise in seinem Wohnzimmer nochmals einheizen. Als ihm gemeldet wurde, dass es »ordentlich brenne,« küsste er seine Frau auf die Stirn und ging fort.
Das ganze Haus schien vor Kälte zu starren. Die Wände, vollständig durchfroren, liessen ein Geräusch, wie leichtes Schaudern vernehmen; und Johanna zitterte in ihrem Bette.
Zweimal stand sie auf, um Holz auf den Herd zu werfen, und Kleider, Röcke und allerlei altes Zeug auf ihr Bett zu legen. Nichts konnte sie warm machen. Ihre Füsse blieben eiskalt, ihr Leib dagegen und ihre Brust wurden von seltsamen Zuckungen gequält, sodass sie sich fortwährend von einer Seite auf die andere legte, ohne Ruhe zu finden. Ihre nervöse Erregtheit nahm mit jeder Minute zu.
Bald klapperte sie mit den Zähnen; ihre Hände zitterten, ihre Brust dehnte sich. Ihr Herz schlug manchmal heftig und schien dann plötzlich wieder auszusetzen. In ihrer Kehle rasselte es, als könne sie nicht genügend Luft bekommen.
Eine furchtbare Angst hielt sie befangen, während die schreckliche Kälte ihr unwiderstehlich bis zum Gehirn drang. Sie hatte so etwas noch nie empfunden, hatte sich noch nie im Leben so schwach, so wie zum Sterben gefühlt.
»Es geht zu Ende mit mir; ich sterbe …« dachte sie. Und von Furcht ergriffen sprang sie aus dem Bett, schellte Rosalie, wartete, schellte abermals, und wartete wieder, während sie fast vor Frost erstarrte.
Die Zofe kam nicht. Ohne Zweifel lag sie im ersten festen Schlafe, aus dem man nicht leicht erwacht. Johanna, der die Sinne fast vergingen, stürzte barfuss an die Treppe.
Geräuschlos tappte sie hinauf, fand die Tür, öffnete sie und rief: »Rosalie!« sie schritt immer weiter vor, tastete sich nach dem Bett, fuhr mit der Hand darüber und fand es leer. Es war unberührt und kalt; niemand konnte darin geschlafen haben.
»Merkwürdig, dass sie bei solchem Wetter noch irgendwo herumläuft«, sagte sie bei sich.
Da aber ihre Herzaffektion immer heftiger wurde, stieg sie mit zitternden Knien wieder herunter, um Julius zu wecken.
Hastig trat sie bei ihm ein, von dem Gefühl gepeinigt, dass sie sterben müsse und von dem Verlangen beseelt, ihn noch einmal zu sehen, ehe sie das Bewusstsein verlor.
Beim Schimmer des halberloschenen Feuers bemerkte sie auf dem Kopfkissen neben ihrem Manne das Gesicht Rosaliens.
Bei dem Schrei, den sie ausstiess, richteten sich beide empor. Einen Augenblick stand sie regungslos vor Schreck über diese Entdeckung. Dann rannte sie davon, in ihr Zimmer zurück. Julius hatte ihren Namen gerufen, und sie hatte eine entsetzliche Furcht, ihn sehen zu müssen, seine Stimme zu hören; sie hätte es nicht ertragen können, jetzt seine Auseinandersetzungen, seine Lügen zu vernehmen, ihm Auge in Auge gegenüber zu stehen. Und abermals stürzte sie an die Treppe, um herunter zu eilen.
Als sie unten war, setzte sie sich auf eine Treppenstufe, immer nur noch im Hemd und blosfüssig; halb von Sinnen sass sie da.
Julius war aus dem Bett gesprungen und zog sich schnell an. Sie hörte, wie er hastig herbeikam. Sie wandte sich um, um abermals zu fliehen. Schon kam er die Treppe herunter und rief: »Johanna, höre doch!«
Nein; sie wollte nicht hören, noch sich auch nur mit einer Fingerspitze berühren lassen. Sie stürzte in den Speisesaal; sie floh vor ihm wie vor einem Mörder. Sie suchte einen Ausgang, ein Versteck, irgend einen dunklen Winkel, um ihm auszuweichen. Sie kroch schliesslich unter den Tisch. Aber schon öffnete er, ein Licht in der Hand, die Türe, immer wieder »Johanna« rufend. Sie floh von Neuem wie ein aufgescheuchter Hase, stürzte in die Küche, rannte zweimal darin rings umher wie ein gehetztes Wild; und als er ihr dorthin nachkam, öffnete sie hastig die Tür zum Garten und flüchtete ins Freie.
Die eisige Berührung des Schnees, in dem sie mit ihren nackten Füssen oft bis an die Knie versank, flösste ihr plötzlich eine verzweiflungsvolle Energie ein. Trotz ihrer Blösse spürte sie keine Kälte; sie empfand nichts mehr ausser der beklemmenden Seelenangst. Weiß wie der Boden selbst rannte sie weiter. Sie verfolgte die gerade Allee, flüchtete durch das Bosquet, sprang über den Graben und rannte auf die Heide.
Der Mond war noch nicht zu sehen; die Sterne glänzten am dunklen Himmel wie Milliarden kleiner Lichter. Die Ebene aber lag hell und klar vor ihr, schmutzig weiß, starr und regungslos in ewigem Schweigen.
Atemlos rannte Johanna weiter, ohne zu überlegen, ohne zu wissen, was sie tat. Und plötzlich fand sie sich am Rand der Küste. Instinktiv blieb sie halten und kauerte sich nieder; sie war nicht mehr Herrin ihres Willens und ihrer Gedanken.
In dem finsteren Dunkel vor ihr strömte das unsichtbare schweigsame Meer seinen salzigen und mit dem Sumpfgeruch des Seegrases vermischten Duft aus.
Lange kauerte sie dort, geistig und körperlich wie gelähmt. Dann plötzlich begann sie zu zittern, aber es war ein eigentümliches Zittern, wie bei einem vom Winde hin und her gezerrten Segel. Ihre Arme, ihre Hände, ihre Füsse wurden wie von einer unsichtbaren Macht geschüttelt; sie wurden in heftigen Stössen hin und her geschwenkt. Plötzlich kehrte ihr Bewusstsein klar und deutlich zurück.
Bilder aus der Vergangenheit spiegelten sich vor ihrem Geiste wieder. Diese Fahrt mit ihm im Boote des Papa Lastique, ihre Plauderei, die beginnende Liebe, die Taufe der Bark. Sie griff dann weiter zurück bis auf den seltsamen Traum der ersten Nacht in Peuples. Und jetzt! ja jetzt? Ach! ihr Leben war vernichtet, jede Freude zu Ende, jede Hoffnung aussichtslos; vor ihr lag nur die furchtbare Zukunft mit all ihren Qualen, mit ihrer Enttäuschung und Verzweiflung. Lieber jetzt sterben! Dann war alles zu Ende.
»Hier, hier sind ihre Fussspuren; schnell, schnell hierher!« hörte sie plötzlich eine Stimme rufen. Es war Julius, der sie suchte.
Ach! sie wollte ihn nicht wiedersehen. In dem Dunkel vor sich hörte sie jetzt ein leichtes Geräusch, das unbestimmte Rauschen des Meeres am Fusse der Felsen.
Sie erhob sich, fest entschlossen sich herabzustürzen. Schon nahm sie Abschied vom Leben und seufzte verzweifelt das eine Wort aller Sterbenden, das eine Wort »Mutter«, mit dem der junge Soldat in der Schlacht sein Leben aushaucht.
Plötzlich trat ihr der Gedanke an ihr Mütterchen vor die Seele. Sie sah sie schluchzen, sah den Vater verzweifelt vor ihrer Leiche knien, sie erlitt einen Augenblick mit ihnen zusammen all ihr Leid und ihren Jammer.
Da sank sie langsam rückwärts in den Schnee. Sie rannte nicht mehr fort, als Julius und Papa Simon mit Marius, der eine Laterne trug, herbeikamen und sie bei den Armen greifend rückwärts zogen; denn so nahe war sie schon am Rand des Gestades.
Jene konnten mit ihr machen was sie wollten; denn sie rührte sich nicht mehr. Sie fühlte, wie man sie aufhob, dann wie man sie auf ein Bett legte und mit warmen Tüchern rieb. Schliesslich schwand ihr jede Erinnerung, jedes Bewusstsein.
Dann quälte sie ein Alpdruck. War es wirklich ein solcher? Sie lag in ihrem Zimmer. Es war lichter Tag, aber sie konnte nicht aufstehen. Warum nicht? Sie begriff es nicht. Sie hörte ein Geräusch auf dem Fussboden, ein Kratzen, ein Rascheln und plötzlich huschte eine Maus, eine kleine graue Maus, eiligst über ihre Decke. Bald folgte eine zweite, eine dritte, die sich mit ihrem kurzen schnellen Trippeln auf ihre Brust zu bewegten. Johanna hatte keine Furcht; sie wollte vielmehr das Tierchen ergreifen und streckte die Hand aus. Aber es gelang ihr nicht.
Dann kamen noch mehr Mäuse; zehn, zwanzig, hundert, tausend schienen aus dem Boden hervorzukommen. Sie kletterten haufenweise an den Tapeten empor; sie bedeckten ihr ganzes Bett. Bald drangen sie unter die Decke. Johanna fühlte, wie sie über ihre Haut krochen, über ihre Füsse huschten und an ihrem Körper emporkletterten. Sie sah sie vom Fussende des Bettes nach ihrer Kehle zu vordringen; sie wehrte sich verzweifelt, ballte die Hände, um eine zu ergreifen, aber ihre Hände blieben stets leer.
Entsetzt wollte sie fliehen, sie schrie, und es schien ihr, als ob man sie festhielt, als ob kräftige Arme sie umschlossen hätten; aber sie sah Niemanden.
Sie hatte keine Ahnung von der Zeit. Es musste lange, sehr lange gedauert haben.
Dann endlich hatte sie ein Erwachen, ein langsames Erwachen, wie aus einem totenähnlichen Schlafe; aber immerhin ein süsses Erwachen. Sie öffnete die Augen und war durchaus nicht erstaunt, ihr Mütterchen im Zimmer mit einem dicken Herrn sitzen zu sehen, den sie nicht kannte.
Wie alt war sie eigentlich? Sie wusste es nicht und hielt sich noch für ein ganz kleines Mädchen. Sie hatte jede Erinnerung verloren.
»Sehen Sie, das Bewusstsein kehrt zurück!« hörte sie den dicken Herrn sagen. Und Mütterchen begann zu weinen.
»Nur ruhig, Madame!« begann der dicke Herr wieder. »Ich stehe jetzt für alles ein. Aber sagen Sie nichts; sprechen Sie von nichts. Wenn sie nur schliefe!«
Und es schien Johanna, als ob sie noch lange so regungslos dagelegen hätte, von einem tiefen Schlummer befangen. Sie suchte sich auch gar nicht die Vergangenheit ins Gedächtnis zurückzurufen, wie in einer unbestimmten Furcht, die Wirklichkeit vor sich auftauchen zu sehen.
Da, einmal, als sie erwachte, bemerkte sie Julius ganz allein bei ihr; und plötzlich kam ihr alles ins Gedächtnis zurück, als wenn ein Schleier gelüftet worden sei, der bis dahin die Vergangenheit bedeckt hatte.
Ein schrecklicher Schmerz durchzuckte sie und sie wollte fliehen. Sie streifte die Decke ab und sprang zum Bett hinaus. Aber ihre Füsse trugen sie nicht und sie fiel hin, Julius sprang hinzu und sie begann zu heulen, dass er sie nicht anrühren solle. Sie wehrte sich und wälzte sich auf dem Boden hin und her. Da öffnete sich die Tür und Tante Lison stürzte mit der Witwe Dentu herein, gefolgt von dem Baron und endlich auch von der Mama, die ganz bestürzt und atemlos herbeikeuchte.
Man brachte sie wieder ins Bett und sie schloss sofort krampfhaft die Augen, um nicht sprechen zu müssen und ungestört nachdenken zu können.
Mutter und Tante umarmten und küssten sie.
»Kennst Du uns jetzt wieder, Johanna, süsse liebe Johanna?« fragten beide wie aus einem Munde.
Sie antwortete nichts und stellte sich geistesabwesend. Dabei wusste sie ganz genau, dass der Tag bald zur Neige gehen würde. Die Nacht brach herein. Die Wärterin machte sich’s in ihrer Nähe bequem und ließ sie von Zeit zu Zeit trinken.
Sie nahm was man ihr reichte, ohne ein Wort zu sprechen; aber sie schlief nicht. Sie bemühte sich ängstlich nachzudenken und suchte in ihrer Erinnerung nach Dingen, die ihr entgangen waren. Es war, als ob ihr Gedächtnis durchlöchert sei, als ob es große leere Stellen enthalte, auf denen die Ereignisse keinen Eindruck hinterlassen hätten.
Erst ganz allmählich mit ungeheurer Anstrengung fand sie den Faden wieder.
Und nun verfolgte sie ihn mit zäher Hartnäckigkeit.
Mütterchen, Tante Lison und der Baron waren herübergekommen; sie musste also sehr krank gewesen sein. Und Julius? Was mochte er wohl gesagt haben? Wussten ihre Eltern alles? Und Rosalie? Wo war sie? Was sollte nun werden … ja was sollte werden? Da durchblitzte sie ein Gedanke – mit Papa und Mama nach Rouen heimkehren und zu leben wie früher. Sie würde Witwe sein; das wäre alles.
Dann gab sie genau auf alles Acht, was um sie herum vorging und was gesprochen wurde; sie verstand jetzt alles, ohne es sich merken zu lassen. Ruhig und mit einer gewissen List freute sie sich des wiederkehrenden Bewusstseins.
Eines Abends endlich fand sie sich allein mit der Baronin. »Mama!« rief sie leise. Sie war erstaunt beim Klange ihrer Stimme, die ihr ganz verändert vorkam.
»Mein Kind, meine liebe Johanna!« sagte die Baronin, ihre Hände ergreifend. »Kennst Du mich denn wieder, mein Töchterchen?«
»Ja, Mama, aber Du darfst nicht weinen. Wir haben viel zu besprechen. Hat Dir Julius gesagt, warum ich damals in den Schnee herausgelaufen bin?«
»Ja, mein Kind; Du hattest ein sehr gefährliches heftiges Fieber.«
»Das ist etwas anderes, Mama; das Fieber habe ich erst nachher bekommen. Ich meine, ob er Dir gesagt hat, warum ich dieses Fieber bekam und weshalb ich in den Schnee herauslief?«
»Nein, Herzchen.«
»Weil ich Rosalie in seinem Bette fand.«
Die Baronin glaubte, Johanna fantasiere wieder.
»Schlafe lieber, Kindchen«, sagte sie schmeichelnd. »Beruhige Dich und versuche zu schlafen.«
»Aber ich bin jetzt ganz bei klarem Verstande«, wehrte Johanna ab, »ich rede keinen Unsinn, Mütterchen, wie vielleicht in der letzten Zeit. Ich fühlte mich eines Abends sehr unwohl und ging herunter, um Julius zu rufen. Rosalie lag bei ihm im Bette. Ich verlor vor Schreck und Kummer den Verstand und bin in den Schnee hinaus gelaufen, um mich von der Küste ins Meer zu stürzen.«
»Ja, Herzchen, Du bist krank gewesen, sehr krank sogar«, sagte die Baronin abermals besänftigend.
»Darum handelt es sich nicht, Mama. Ich fand Rosalie bei Julius im Bett und will nicht länger bei ihm bleiben. Wir wollen zusammen nach Rouen zurückkehren und dort leben wie früher.«
»Nun ja, wie Du willst, mein Kind«, sagte die Baronin, der der Arzt ans Herz gelegt hatte, Johanna nicht zu widersprechen.
Aber die Kranke wurde ungeduldig.
»Ich merke ganz gut, dass Du mir nicht glaubst. Ruf mir, bitte, mal den Papa herein. Er wird mich schliesslich schon verstehen.«
Mamachen erhob sich schwerfällig, nahm ihre beiden Krückstöcke und ging schleppenden Schrittes hinaus. Nach einigen Minuten kehrte sie mit dem Baron zurück, der sie stützte.
Sie setzten sich beide ans Bett und alsbald begann Johanna ihre Geschichte. Sie schilderte alles, langsam, mit schwacher Stimme, aber mit voller Klarheit: den eigentümlichen Charakter ihres Mannes, seine Härten, seinen Geiz und schliesslich seine Untreue.
Als sie zu Ende war, sagte sich der Baron, dass es sich hier um keine Fantasien handle. Aber er wusste nicht, was er dazu denken und sagen sollte; geschweige denn, dass er zu irgend einem Entschluss gekommen wäre.
Er nahm sie bei der Hand mit jener zärtlichen Art, mit der er sie früher einzuschläfern wusste, wenn er ihr eine Geschichte erzählte.
»Höre mich, Kind; man muss mit Klugheit handeln. Man darf nichts überstürzen. Such mit Deinem Manne auszukommen, bis wir einen Entschluss gefasst haben … Willst Du mir das versprechen?«
»Ich verspreche es Dir«, murmelte sie, »aber wenn ich gesund bin, bleibe ich nicht länger hier. Wo ist Rosalie jetzt?« fügte sie dann leiser hinzu.
»Du wirst sie nicht wiedersehen«, antwortete der Baron. Aber sie gab nicht nach.
»Wo ist sie; ich will es wissen?«
Da teilte er ihr mit, dass sie zwar das Haus noch nicht verlassen habe, dass dies aber in allernächster Zeit geschehen würde.
Nachdem der Baron das Zimmer verlassen hatte, suchte er, noch glühend vor Zorn und in seinem Vaterherzen aufs tiefste gekränkt, sofort Julius auf.
»Ich komme, mein Herr«, sagte er schroff, »um Rechenschaft wegen Ihres Verhaltens gegenüber meiner Tochter zu verlangen. Sie haben sie mit ihrer Kammerzofe hintergangen. Das ist doppelt unwürdig.«
Aber Julius spielte den Gekränkten. Er leugnete alles heftig ab, beteuerte seine Unschuld und rief Gott zum Zeugen an. Was hatte man denn für Beweise? War Johanna wirklich ganz bei Sinnen? Hatte sie nicht soeben eine Gehirn-Entzündung hinter sich? War sie nicht beim Beginn ihrer Krankheit damals nachts in einem Fieberanfall in den Schnee herausgelaufen? Und war es nicht in diesem Anfall gerade, als sie halbnackt durchs Haus lief und dabei ihre Zofe im Bette ihres Gatten gesehen haben wollte?
Er wurde immer heftiger und drohte mit einer Klage. Er redete sich vollständig in den Zorn hinein. Und der Baron wurde ganz verwirrt; er fing an sich zu entschuldigen, bat um Verzeihung und bot schliesslich Julius die Hand zur Versöhnung, die Jener aber ausschlug.
Als Johanna die Antwort ihres Gatten erfuhr, regte sie sich keineswegs auf.
»Er lügt, Papa«, sagte sie einfach, »aber wir werden ihn schliesslich doch überführen.«
Zwei Tage lang war sie schweigsam und dachte meistens still vor sich hin.
Dann am dritten Tage verlangte sie Rosalie zu sehen. Der Baron wollte das Mädchen nicht heraufholen lassen; sie sei abgereist, behauptete er. Aber Johanna gab nicht nach:
»Man soll sie von zu Hause holen«, verlangte sie stets aufs Neue.
Und als der Doktor eintrat, war sie bereits sehr aufgeregt. Man sagte ihm, worum es sich handle. Johanna, an der Grenze ihrer Fassungskraft angelangt, fing plötzlich heftig zu weinen an und rief immer wieder: »Rosalie soll kommen; ich will Rosalie sehen.«
Da nahm der Arzt sie bei der Hand und sagte leise:
»Beruhigen Sie sich, Madame; jede Gemütsbewegung könnte von ernstlichen Folgen sein. Sie tragen ein Kind unterm Herzen.«
Sie war sprachlos, wie vom Schlage getroffen; es schien ihr, als spüre sie, dass sich etwas unter ihrem Herzen rege. So blieb sie schweigsam, in Gedanken versunken, ohne darauf zu hören was die anderen sagten. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen, fortwährend von der neuen Vorstellung wach gehalten, dass unter ihrem Herzen ein Kind lebe. Es berührte sie peinlich, dass es ein Kind von Julius sei; sie war beunruhigt bei dem Gedanken, dass es ihm gleichen möchte. Am nächsten Tage ließ sie den Baron rufen.
»Papachen, mein Entschluss ist gefasst; ich will alles wissen, jetzt gerade erst recht. Ich will, hörst Du? Du weißt, dass man mir in meinem jetzigen Zustande nicht widersprechen darf. Höre also. Du musst zum Pfarrer gehen. Ich brauche ihn, damit er Rosalie vom Lügen abhält. Dann, sobald er hier ist, lässt Du sie heraufkommen und bleibst mit Mama zugegen. Sorge nur vor allem, dass Julius keinen Verdacht schöpft.«
Eine Stunde später trat der Priester ein; er war noch stärker wie früher geworden und keuchte ebenso wie die Baronin. Sein Leib hing noch tiefer herunter.
»Nun, Frau Baronin,« begann er scherzend, während er sich gewohnheitsmässig mit dem buntkarrierten Taschentuche wischte, »ich glaube, wir sind beide nicht magerer geworden. Wir würden ein hübsches Paar abgeben.« Dann wandte er sich dem Krankenbette zu. »Nun, was höre ich, meine junge Dame? Wir werden bald wieder taufen? Ha, ha, ha! aber diesmal keine Barke. Es wird ein Vaterlandsverteidiger werden,« fügte er ernster hinzu, »wenn es nicht eine gute Hausfrau wird, wie Sie, Madame« sagte er mit einer Verbeugung gegen die Baronin.
In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen und Rosalie erschien auf der Schwelle. Sie war ganz ausser sich, schluchzte, weigerte sich einzutreten und klammerte sich krampfhaft an die Klinke fest. Der Baron verlor die Geduld und stiess sie mit einem kräftigen Ruck ins Zimmer. Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen und blieb heulend stehen.
Sobald Johanna sie bemerkte, richtete sie sich auf und sass da, bleicher als die Kissen, in denen sie ruhte. Ihr Herz klopfte so heftig, dass die Spitzen ihres Hemdes auf- und abwogten. Sie konnte kaum atmen und rang krampfhaft nach Luft. Endlich sprach sie mit halberstickter Stimme: »Ich … ich … hätte nicht … nötig … Dich zu fragen. Es … war für mich … genug …, Deine … Deine Schmach … mit eigenen Augen … zu sehen.«
Nach einer Pause, in der sie wieder Atem schöpfte, begann sie abermals: »Aber ich will alles wissen … Alles … ganz genau, Ich habe den Herrn Pfarrer gebeten; es soll eine Art Beichte sein, verstehst Du.«
Rosalie stand regungslos da und stiess nur hin und wieder eine Art Schrei zwischen den krampfhaft geschlossenen Händen hervor.
Der Baron, von Zorn übermannt, fasste sie bei den Armen, riss ihr die Hände vom Gesicht und zwängte sie vor dem Bett auf die Knie.
»Sprich jetzt …« schrie er, »antworte!« Sie blieb am Boden mit der Haltung einer Magdalene, ihre Mütze war ganz schief gerückt, die Schürze bedeckte den Boden. Mit den Händen verbarg sie abermals das Gesicht.
»Nun, meine Tochter,« begann jetzt der Priester, »höre, was man Dir sagt und gib Antwort. Wir wollen Dir nichts Übles zufügen, aber wir wollen wissen, was sich zugetragen hat.«
Johanna hatte sich über den Bettrand gebeugt und sah sie lange an.
»Es ist also wahr, dass Du Dich im Bette meines Mannes befandest, als ich Euch überraschte.«
»Ja, Madame,« seufzte Rosalie zwischen den Fingern hindurch.
Da brach die Baronin plötzlich in lautes Weinen aus, dem kleine Erstickungsanfälle folgten. Ihr krampfhaftes Schluchzen vermischte sich mit dem Rosaliens.
»Seit wie lange hat das schon so gewährt?« fragte Johanna, den Blick fest auf die Zofe geheftet.
»Seitdem er herkam,« stammelte Rosalie.
Johanna verstand nicht gleich.
»Seitdem er herkam? … Also … seit … seit dem Frühjahr?«
»Ja, Madame.«
»Seitdem er ins Haus kam?«
»Ja, Madame.«
Tausend Fragen schwebten Johanna jetzt auf der Zunge.
»Aber wie ist das möglich?« begann sie hastig. »Wie hat er Dir’s denn nahe gelegt? Wie wurdest Du die seine? Was sagte er Dir? Wann und wie hast Du denn nachgegeben? Wie konntest Du Dich denn ihm überlassen?«
Jetzt streckte Rosalie abwehrend die Hände aus; auch ihr schwebten tausend Antworten auf der Zunge.
»Ich weiß es nur zu gut. Als er zum ersten Mal hier ass, suchte er mich in meinem Zimmer auf. Er hatte sich auf dem Boden versteckt. Ich wagte nicht zu schreien, um keinen Skandal zu machen. Er legte sich zu mir. Was sollte ich da machen? Ich war in seiner Hand. Ich wollte auch nichts sagen; er war so nett und gut …«
Johanna stiess einen Schrei aus.
»Aber … Dein Kind … Dein Kind … ist es von ihm? …«
»Ja, Madame,« schluchzte Rosalie.
Eine Zeit lang schwiegen beide. Man hörte nur das Schluchzen Rosaliens und der Baronin.
Auch Johanna fühlte, wie ihre Augen feucht wurden; sie lehnte sich in die Kissen zurück und leise rannen ihr die Tränen über die Wangen.
Das Kind ihrer Zofe hatte denselben Vater wie das ihrige! Ihr Zorn war dahin. Jetzt fühlte sie nur, wie eine seltsame tiefe und endlose Verzweiflung sich langsam ihres Herzens bemächtigte.
Sie begann ihre Fragen aufs neue, aber dieses Mal klang ihre Stimme verändert, weicher.
»Als wir zurückkamen von … da unten … von der Reise …, wann hat er da wieder angefangen?«
»Da … gleich den ersten Abend,« stöhnte die Zofe, die jetzt beinahe ganz am Boden lag.
Jedes ihrer Worte durchschnitt Johannas Herz. Also am ersten Abend, am Abend ihrer Rückkehr nach Peuples, ließ er sie allein um dieses Mädchens willen! Deshalb schlief er in seinem Zimmer!
Sie wusste jetzt genug, sie mochte nichts mehr davon hören.
»Geh’ hinaus, geh’ fort!« rief sie. Und als Rosalie, ganz fassungslos, sich nicht von der Stelle rührte, rief sie den Vater herbei: »Führe sie fort, jag’ sie hinaus.«
Aber der Pfarrer, der bis dahin schweigend zugehört hatte, hielt jetzt den Augenblick für eine kleine Strafpredigt gekommen:
»Das ist schändlich, was Du getan hast, meine Tochter,« begann er, »sehr schändlich; der Himmel wird Dir sobald nicht verzeihen. Denke an die Hölle, die Dich erwartet, wenn Du nicht sofort eine andere Lebensweise beginnst. Jetzt, wo Du ein Kind hast, müssen wir sehen, dass es mit Dir in Ordnung kommt. Frau Baronin wird ohne Zweifel etwas für Dich tun und wir müssen trachten, einen Mann für Dich zu finden …«
Er hätte jedenfalls noch lange gesprochen, aber der Baron hatte Rosalie abermals bei den Schultern gefasst, riss sie in die Höhe, schleppte sie bis an die Türe und warf sie wie einen Ball auf den Gang hinaus.
Als er, bleicher fast wie seine Tochter, zurückkam, ergriff der Pfarrer abermals das Wort: »Was soll man machen? Sie sind alle so hier zu Lande. Es ist zum jammern, aber man kann es nicht ändern und muss etwas Nachsicht mit der Schwäche der Natur haben. Sie heiraten niemals, Madame, ohne nicht schon guter Hoffnung zu sein. Man könnte das so als eine Landessitte bezeichnen,« fügte er lächelnd hinzu. »Selbst bei den Kindern fängt es schon an,« sagte er, dann ernster werdend. »Fand ich doch neulich auf dem Kirchhof ein Pärchen, das noch die Schule besucht! Ich teilte es den Eltern mit. Wissen Sie, was ich zur Antwort erhielt? »Was soll man machen, Herr Pfarrer? Wir haben ihnen diese Schmutzerei nicht beigebracht; wir können nichts dafür.« Sehen Sie, Herr Baron, Ihr Mädchen hat es gemacht, wie die anderen auch …«
»Ach die?« unterbrach ihn der Baron, noch wutzitternd, »die ist mir ganz gleichgültig. Es ist Julius, der mich so wütend macht. Es ist schändlich, was er da gemacht hat und ich will meine Tochter mit mir nehmen.«
Sich immer mehr in die Hitze redend, ging er auf und ab. »Es ist infam, meine Tochter so zu hintergehen, infam! Er ist ein Lump, dieser Mensch, eine Canaille, ein Elender; aber ich werde es ihm sagen, ich werde ihn züchtigen, ihn mit meinem Degen umbringen!«
Der Pfarrer nahm, neben der trostlosen Baronin stehend, bedächtig eine Priese und suchte seines Amtes als Friedensspender zu walten. »Sehen Sie, Herr Baron, er hat es, unter uns gesagt, gemacht wie alle Welt. Kennen Sie viele Ehemänner, die treu sind?« Und mit etwas boshafter Harmlosigkeit fügte er hinzu: »Sicher, ich wette, dass Sie selbst auch so Ihre kleinen Scherze gehabt haben. Schauen Sie, Hand aufs Herz, ob ich nicht recht habe.«
Der Baron war überrascht stehen geblieben und schaute dem Priester ins Gesicht, der ruhig fortfuhr:
»Nun ja, Sie haben es gemacht wie alle anderen. Wer weiß, ob Sie nicht auch mal so eine leckere Frucht gekostet haben, wie diese da. Ich sage Ihnen, alle Welt treibt es so. Ihre Frau ist darum nicht weniger glücklich und weniger geliebt gewesen, nicht wahr?«
Der Baron wusste wirklich nicht, was er antworten sollte.
Wahrhaftig, in der Tat, er hatte es ebenso gemacht und recht oft sogar, so hinge er gekonnt hatte. Auch er hatte sein eigenes Haus nicht rein gehalten. Wenn die Zofen seiner Frau halbwegs hübsch waren, so hatte er sich nicht lange bedacht. War er deshalb ein schlechter Mensch? Warum beurteilte er Julius’ Aufführung so streng, während er für die seinige doch stets eine Entschuldigung gefunden hatte?
Der Baronin schwebte mitten zwischen ihrem krampfhaften Schluchzen doch ein Lächeln auf den Lippen, wenn sie an die kleinen Vergesslichkeiten ihres Gatten dachte. Sie war eine von jenen sentimentalen, schnell erregbaren und zugleich nachsichtigen Naturen, für welche Liebes-Abenteuer das halbe Leben ausmachen.
Johanna lag indessen mit offenen Augen, die Arme unter dem Kopf gekreuzt, auf ihrem Kissen und starrte, in schmerzliches Nachdenken versunken, vor sich hin. Ein Wort Rosaliens kam ihr immer wieder in den Sinn, das sie tief verletzt hatte und ihr einen Stich ins Herz gab: »Ich wollte nichts sagen, er war so nett und gut.«
Auch sie hatte ihn nett und gut gefunden und nur deshalb hatte sie sich ihm ergeben, sich ihm fürs ganze Leben verbunden, auf jede andere Hoffnung, auf alle ihre Jugendträume, auf alle unbekannten Erwartungen verzichtet. Sie hatte sich in diese Ehe gestürzt, in dieses grundlose Loch, um in dieses Elend zu geraten, in diese trostlose, verzweifelnde Lage, weil sie, wie Rosalie, ihn so nett und gut gefunden hatte.
Die Türe flog mit einem heftigen Stosse auf und Julius trat ein, das Antlitz vor Wut entstellt. Er hatte Rosalie jammernd auf der Treppe gefunden und wollte sich nun selbst überzeugen. Er ahnte, dass irgendetwas vorgefallen war, dass das Mädchen ohne Zweifel geplaudert hatte. Der Anblick des Priesters bannte ihn auf seinen Platz.
»Was ist los? Was gibts?« fragte er mit zitternder Stimme, aber im Übrigen ruhig. Der Baron, vorhin noch so heftig, wagte nichts zu sagen; es war ihm bei den Worten des Pfarrers und dem Hinweis auf sein eigenes Beispiel nicht recht wohl zu Mute geworden. Die Mama weinte wieder stärker. Johanna hatte sich auf die Hände gestützt und betrachtete schwer atmend den, der ihr so grausames Weh verursacht hatte.
»Was es gibt?« stammelte sie. »Nun, dass wir alles wissen, dass wir Ihre ganze Schändlichkeit kennen seit … seit dem Tage, wo Sie dieses Haus betreten haben … dass das Kind dieser Zofe Ihnen gehört … wie … das meinige, … dass es Geschwister sein werden.« Und vom Übermasse des Schmerzes bewältigt, barg sie das Gesicht in die Kissen und weinte bitterlich.
Er blieb verblüfft stehen und wusste nicht, was er tun und sagen sollte.
»Nun ja, meine junge Dame«, mischte sich der Pfarrer ein, »grämen wir uns nicht so sehr; seien Sie vernünftig.« Er stand auf, näherte sich dem Bette und legte sanft seine Hand auf die Stirn der Verzweifelten. Diese milde Berührung stimmte sie seltsam weich; sie fühlte sich alsbald sprachlos, als ob diese einfache starke Hand, gewohnt Verzeihung zu spenden, Trost zu bringen, ihre Seele mit einem geheimnisvollen Frieden erfüllt habe.
»Madame«, begann der wackere Mann, bei ihr stehen bleibend, aufs Neue, »man muss stets Verzeihung üben. Sehen Sie, ein großes Unglück hat Sie betroffen; aber Gott hat in seiner Barmherzigkeit ihm ein großes Glück zur Seite gestellt, indem Sie sich Mutter fühlen. Das Kind wird Ihr Trost sein. In seinem Namen flehe ich Sie an; ich beschwöre Sie, Herrn Julius zu verzeihen. Es wird ein neues Band zwischen Ihnen bilden, ein Unterpfand seiner zukünftigen Treue. Können Sie sich von dem Herzen dessen lossagen, dessen Liebespfand Sie unter dem Herzen tragen?«
Sie antwortete nicht; sie war geknickt, von Schmerz zerrissen und zu erschöpft jetzt. Sie hatte selbst für Zorn und Abscheu keine Kraft mehr. Ihre Nerven waren abgespannt, wie langsam zerschnitten; sie fühlte kaum noch, dass sie lebte.
»Ja, sieh nur mal, Johanna!« sagte die Baronin, der jeder Groll zuwider war, und deren Seele einer andauernden Erregung unfähig blieb.
Da nahm der Pfarrer die Hand des jungen Mannes, zog ihn nahe an das Bett heran, und legte sie in die Hand seiner Frau. Er drückte beide Hände mit der seinigen, als wollte er sie endgültig vereinen, und seinen gewöhnlichen salbungsvollen Ton bei Seite lassend, sagte er mit zufriedener Miene:
»So, das wäre in Ordnung; glauben Sie nur, es wird alles gut gehen.«
Die beiden Hände, eben erst miteinander vereint, lösten sich sofort wieder. Julius wagte es noch nicht, seine Frau zu umarmen und küsste nur seine Schwiegermutter auf die Stirn. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und nahm den Arm des Barons, der es sich gern gefallen ließ, froh im Grunde genommen, dass die Geschichte so abgelaufen war. Beide gingen fort, um draussen eine Zigarre zu rauchen.
Die Kranke schlummerte vor Erschöpfung ein, während der Priester mit der Mama noch eine leise Unterhaltung hatte.
Der Abbé führte das Wort und entwickelte seine Ideen, während die Baronin zuweilen durch ein leichtes Kopfnicken ihren stummen Beifall zu erkennen gab.
»Das wäre also abgemacht«, sagte er zum Schlusse. »Sie geben dem Mädchen den Pachthof Barville, und ich nehme es auf mich, ihm einen Mann, einen braven ordentlichen Burschen zu verschaffen. Ach, bei einem Vermögen von zwanzigtausend Francs wird es an Liebhabern nicht fehlen. Die Wahl wird uns noch schwer genug werden.«
Die Baronin lächelte glücklich, während noch zwei Tränen auf ihrer Wange hafteten, deren feuchte Spur jedoch bereits eingetrocknet war.
»Das ist sicher«, bestätigte sie; »Barville ist zum Mindesten seine zwanzigtausend Francs wert. Aber wir wollen den Hof auf den Namen des Kindes schreiben lassen. Die Eltern sollen die lebenslängliche Nutzniessung haben.«
Der Pfarrer erhob sich und drückte der Baronin die Hand:
»Bemühen Sie sich nicht, Frau Baronin, bitte, bemühen Sie sich nicht. Dieser Gang war schon der Mühe wert.«
Beim Herausgehen begegnete er Tante Lison, die nach der Kranken sehen wollte. Sie hatte von allem keine Ahnung; niemand sagte ihr etwas und sie wusste, wie immer, nichts.
*