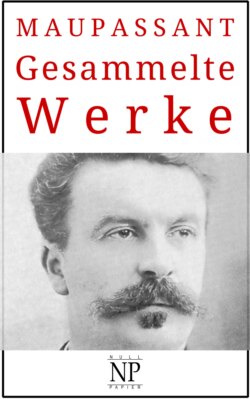Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 79
Eine Landpartie
ОглавлениеSchon seit fünf Monaten hatte man sich mit dem Plane herumgetragen, am Namenstage der Madame Dufour, die Petronella hiess, in der Umgebung von Paris das Dejeuner einzunehmen. So hatte sich denn bei der Ungeduld, mit der man dieser Partie entgegensah, an diesem Morgen alles bei Zeiten erhoben.
Madame Dufour, welche zu diesem Zwecke ihren Milchwagen hergegeben hatte, kutschierte selbst. Das zweiräderige Gefährt war sehr reinlich gehalten; es besass ein Dach, von vier Eisenstäben getragen, an denen Vorhänge befestigt waren, die man heute zurückgeschoben hatte, um die Gegend besser geniessen zu können. Nur der Vorhang an der Rückseite flatterte wie eine Fahne im Winde. Die Hausfrau strahlte neben ihrem Manne in einer auffallenden kirschroten Seiden-Toilette. Hinter ihnen sassen auf zwei Stühlen die alte Großmutter und ein junges Mädchen. Ausserdem bemerkte man noch das Flachshaar eines jungen Burschen, welcher sich in Ermangelung eines Sitzes der Länge nach auf dem Boden ausgestreckt hatte, sodass nur noch sein Kopf zum Vorschein kam.
Nachdem man die Avenue des Champs-Elysees herunter gefahren war und die Festungswerke bei der Porte Maillot hinter sich hatte, begann man, sich mit Musse in die Betrachtung der Gegend zu vertiefen.
»Endlich sind wir im Freien« sagte Herr Dufour als man bei der Brücke von Neuilly ankam; und auf diesen Ruf hin begann Madame Dufour mit ihrer Natur-Schwärmerei.
Am Rondel von Courbevoie erregte der weite Ausblick, der sich da eröffnete, ihre ganze Bewunderung. Da unten rechts lag Argenteuil mit seinem Glockenturm; darüber hinaus sah man die Schiessstände von Sannois und die Mühle von Orgemont. Links zeigte sich am hellen Morgenhimmel der Aquaedukt von Marly und ausserdem konnte man in der Ferne noch die Terrasse von Saint-Germain bemerken, während vorn am Ende einer Hügelkette große Erdaufwürfe auf das neue Fort Cormeilles hindeuteten. Ganz hinten in einer mächtigen Entfernung über Wiesen und Dörfer hinaus, unterschied man noch den grünlichen Schimmer der Wälder.
Die Sonne brannte den Ausflüglern heiss aufs Gesicht, der Staub drang ihnen unaufhörlich in die Augen und zu beiden Seiten der Strasse dehnten sich endlose kahle schmutzige und stinkende Felder aus. Man hätte denken sollen, dass ein Aussatz sie verwüstet und bis auf die Häuser ausgesogen habe, denn die halbverfallenen und unbenutzten Gerippe der Häuser, oder besser gesagt die kleinen halbvollendeten Bauten, deren Eigentümer wegen Geldmangel aufgehört hatten, streckten ihre vier nackten dachlosen Mauern gen Himmel.
Hier und da stiegen aus der kahlen Fläche mächtige Fabrikschornsteine empor, die einzigen Wahrzeigen menschlichen Lebens in dieser starren Gegend, wo die Frühlingswinde einen Duft von Teer und Petroleum nebst einem anderen noch unangenehmeren, mit sich führten.
Endlich kam man zum zweiten Mal über die Seine; und auf der Brücke nun gab es ein allgemeines Staunen. Der Strom erglänzte im Sonnenlichte eine Dunstwolke zog sich von ihm aus zum Tagesgestirn empor, und mit stillem Behagen sog man hier in der wohltuenden Ruhe die frische reine Luft ein, die nun endlich von dem Schwarzen Rauch der Fabrikschlote und dem Dunst der Werkstätten frei war.
Bei einem Vorübergehenden hatte man den Namen des Ortes hier erfahren: Es war Bezons.
Der Wagen hielt und Herr Dufour las die einladende Aufschrift einer Garküche: »Restaurant Poulien, Ragouts und Braten; Gesellschaftszimmer, Garten mit Schaukel. Nun, Madame Dufour, gefällt Dir das? Wirst Du Dich entschliessen?«
Madame las nun auch: »Restaurant Poulin, Ragouts und Braten; Gesellschaftszimmer, Garten mit Schaukel.« Dann schaute sie das Haus lange an.
Es war ein reinliches ländliches Gasthaus am Rande der Strasse. Durch die offene Tür sah man die blanken Zinnschüsseln des Schenktisches, vor welchem zwei Arbeiter im Sonntagsgewande standen. Endlich hatte Madame sich entschieden:
»Ja, es ist gut hier, und ausserdem hat man Aussicht.« sagte sie.
Der Wagen bog in einen geräumigen mit großen Bäumen bepflanzten Hof ein, der sich bis hinter das Gasthaus ausdehnte und von der Seine nur durch den Leinpfad getrennt war.
Man stieg ab. Der Mann sprang zuerst herunter und öffnete die Arme um seine Frau aufzufangen. Der von zwei Eisenstangen gehaltene Fusstritt war ziemlich nahe über dem Boden, sodass sie den unteren Teil eines Beines sehen ließ, dessen ursprüngliche Feinheit jetzt unter einem ziemlichen Fettansatz verschwand, der ihre Schenkel bedeckte. Herr Dufour, den die Landluft aus seiner gewohnten Schläfrigkeit geweckt hatte, kniff sie in die Wade, dann fasste er sie unter die Arme und ließ sie langsam wie ein großes Packet zur Erde gleiten.
Sie klopfte mit den Händen auf ihr Seidenkleid um den Staub zu entfernen und sah sich dann ihre Umgebung näher an.
Madame Dufour war eine Frau von ungefähr sechsunddreissig Jahren, wohlgenährt, üppig und von munteren Sinnen. Sie atmete etwas schwer, indem das zu eng geschnürte Corset sie bedrückte, und die hochaufgeschnürte starke Brust stieg wie eine wogende Masse fast bis zu ihrem Doppelkinn empor. Hierauf schwang sich das junge Mädchen, indem es seine eine Hand auf die Schulter des Papa stützte, ohne weitere Hilfe aus dem Wagen. Der Bursche mit dem Flachskopf hatte einen Fuss auf das Rad gesetzt und dieses als Trittbrett benutzt. Jetzt half er Herrn Dufour, die Großmutter auszuladen.
Hierauf wurde das Pferd abgespannt und an den nächsten Baum gebunden; der Wagen fiel vornüber und fand seine Stütze in der Schere. Die beiden Männer zogen ihre Röcke aus, wuschen sich die Hände in einem nahe stehenden Tränkeimer und begaben sich nach Vervollständigung ihrer Toilette wieder zu den Damen, die bereits auf den Schaukeln Platz genommen hatten.
Fräulein Dufour versuchte sich stehend ohne Hilfe zu schaukeln; indess wollte ihr der rechte Schwung nicht gelingen. Sie war ein hübsches Mädchen von achtzehn bis zwanzig Jahren, eines jener Wesen, deren Anblick auf der Strasse einen plötzlich reizt und nicht selten eine unruhige, aufgeregte Nacht verursacht. Groß, von schlanker Taille und breiten Hüften, hatte sie einen sehr bräunlichen Teint, sehr große Augen und tiefschwarze Haare. Ihr Kleid ließ die Fülle ihrer Körperformen deutlich hervortreten, namentlich bei den charakteristischen Bewegungen der Hüften, mit denen sie sich jetzt in Schwung zu bringen versuchte. Mit den ausgestreckten Armen hatte sie die Seile in Höhe ihres Kopfes erfasst und ihre Brust hob sich unwillkürlich bei jedem Stoss, den sie sich gab. Ihr Hut, den ein Windstoss fortgeschleudert hatte, lag hinter ihr, und wie nun die Schaukel endlich doch anfing sich höher zu heben, zeigten sich bei jedem Schwunge derselben ihre niedlichen Beine bis zum Knie. Die beiden Männer schauten lachend diesem Schauspiel zu und liessen sich das Gesicht durch den Windhauch fächeln, den ihre flatternden Kleider hervorriefen. Dieser Luftzug schien ihrer Nase ein angenehmeres Gefühl zu bereiten, als der Duft von Alkohol.
Madame Dufour sass auf der andren Schaukel, und stöhnte fortgesetzt in einförmigem Tone:
»Cyprian, komm und schaukle mich; komm doch und schaukle mich, Cyprian!« Schliesslich ging er hin, nachdem er die Ärmel wie zu einem schwierigen Stück Arbeit aufgestülpt hatte und setzte seine Frau mit unendlicher Mühe in Bewegung.
Die Stricke umklammernd, streckte sie die Füsse geradeaus, um nicht den Boden zu streifen, und ergötzte sich an der einschläfernden Hin- und Herbewegung der Schaukel. Ihre Formen zitterten bei dieser Beschäftigung fortwährend wie Gellee auf einer Schlüssel. Aber als die Schwingungen stärker wurden bekam sie heftige Furcht. Jedes Mal, wenn es nach unten ging, stiess sie einen gellenden Schrei aus, wodurch alle Dorfjungen herbeigelockt wurden; und sie bemerkte hinter der Gartenhecke eine Anzahl Burschenköpfe, welche sich vor Lachen fast ausschütten wollten.
Als nun eine Aufwärterin kam, befahl man das Dejeuner.
»Einen Seine-Backfisch, einen Kaninchenbraten, eine Schüssel Salat und Dessert« bestellte Madame Dufour mit wichtiger Miene.
»Bringen Sie zwei Liter und eine Flasche Bordeaux«, rief ihr Mann.
»Wir wollen im Grase speisen,« fügte das junge Mädchen hinzu.
Die Großmutter, von Zärtlichkeit beim Anblick der Hauskatze ergriffen, verfolgte dieselbe seit zehn Minuten vergeblich mit den süssesten Kosenamen. Das Tier fühlte sich zweifelsohne innerlich über diese Aufmerksamkeit sehr geschmeichelt und hielt sich immer ganz nahe bei der guten Alten auf, ohne sich jedoch erwischen zu lassen; es machte ruhig seinen Rundgang um jeden einzelnen Baum, rieb den gekrümmten Rücken daran und streckte behaglich schnurrend den Schwanz kerzengerade in die Höhe.
»Holla!« schrie plötzlich der junge Flachskopf, der das Terrain sondierte, »da gibt es ja auch Rennboote!«
Man ging hin, um sich zu überzeugen. In der Tat waren an einer kleinen Holzbrücke zwei prächtige, sehr sorgsam und luxuriös gebaute Ruderboote befestigt. Sie lagen nebeneinander wie zwei große schlanke Mädchen, so lang und glänzend, und lockten unwillkürlich zu einer Spazierfahrt bei den schönen lauen Abenden oder hellen Morgenstunden der Sommerzeit. Wie prächtig musste es sein, an den blumigen Ufern entlang zu gleiten, wo die Bäume ihre Zweige in das Wasser tauchen, das Schilfrohr fortwährend im Säuseln des Windes erschauert, und der schnelle Eisvogel wie ein blauer Blitz aus demselben hervorschwirrt.
Die ganze Familie betrachtete sie mit Ehrfurcht. »Ach ja, das sind Rennboote,« wiederholte gewichtig Herr Dufour und begann sie mit dem Tone eines Kenners zu beschreiben. Er hatte, wie er sagte, selbst in seiner Jugend gerudert, und mit solchen Dingern in der Hand – hierbei machte er die Bewegung des Ruderns – würde er jeden in die Schranken fordern. Er verstand sich darauf trotz dem besten Engländer und hatte mehrmals sogar in Joinville mitgestartet. Er scherzte über das Wort »Damen« womit man die Rudergabeln bezeichnet und machte das geistreiche Wortspiel, dass tüchtige Bootsmänner nie einen Ausflug ohne ihre »Damen« machten. Während er sprach, geriet er von selbst in eine gewisse Erregung hinein und verstieg sich schliesslich zu der Wette, mit einem Boote, wie diese da, in der Stunde seine sechs Meilen zu machen, ohne sich besonders anzustrengen.
»Es ist angerichtet« meldete jetzt die Aufwärterin, welche am Eingang des Gartens erschien. Man folgte eiligst ihrem Rufe, aber auf dem schönsten Platze, den sich Madame Dufour schon im Geiste ausgesucht hatte, frühstückten bereits zwei junge Leute. Es waren dies ohne Zweifel die Eigentümer der Boote, denn sie trugen Rudersport-Kostüme.
Sie sassen oder lagen vielmehr auf zwei Stühlen. Ihr Gesicht war von der Sonne gebräunt und ihren Oberkörper bedeckte nur ein einfaches weißes Baumwollhemd, aus welchem die blossen Arme hervorschauten, dieselben waren kräftig, wie wenn sie Schmieden gehörten. Es waren zwei muntere kraftstrotzende Burschen, aus deren ganzen Bewegungen aber jene gefällige Elastizität der Glieder sprach, die man nur durch stete Übung erhält, und die so ganz verschieden von jener einseitigen Kraftausbildung ist, welche übermässige Anstrengung bei dem Arbeiter hervorruft.
Beim Anblick der Mutter huschte ein flüchtiges Lächeln über ihre Lippen, während sie beim Erscheinen der Tochter einen bedeutsamen Blick austauschten.
»Treten wir ihnen unseren Platz ab;« sagte der eine »dabei können wir dann ihre Bekanntschaft machen.«
Der andere erhob sich sofort und indem er seine halbrot-halbschwarze Mütze zog, bot er mit ritterlicher Höflichkeit den einzigen schattigen Platz im Garten den Damen an. Unter allerlei Ausflüchten und Entschuldigungen nahm man schliesslich das liebenswürdige Anerbieten an; und, damit das Ganze einen recht ländlichen Anstrich bekäme, ließ man sich ohne Tisch und Stühle direkt auf dem Rasen nieder.
Die beiden jungen Leute trugen ihr Gedeck einige Schritte weiter und begannen wieder zu essen. Der stete Anblick ihrer blossen Arme setzte das junge Mädchen etwas in Verlegenheit. Sie tat sogar als ob sie den Kopf wende und gar keine Notiz mehr von ihnen nähme; Madame Dufour dagegen war schon etwas weniger prüde und wurde von leicht zu begreifender weiblicher Neugier und auch ein wenig von Lüsternheit geplagt. Sie schaute jeden Augenblick hin, und stellte im Geheimen zweifelsohne Vergleiche zwischen ihnen und den bedauerlichen Mängeln ihres Gatten an.
Sie hatte sich ins Gras gepflanzt, die Beine nach Schneiderart gekreuzt, und schüttelte sich alle Augenblicke, weil ihr angeblich eine Ameise irgendwohin gekrochen sei. Herr Dufour, dem die Nachbarschaft der liebenswürdigen Fremden durchaus nicht sehr willkommen war, suchte nach irgend einer behaglichen Lage, die er übrigens nicht fand; und der junge Mensch mit den flachsgelben Haaren frass schweigend wie ein Währwolf.
»Ein hübscher Tag heute, mein Herr!« sagte die dicke Dame zu einem der Ruderer; sie wollte sich wegen der Abtretung des Platzes liebenswürdig erzeigen.
»Ja, Madame;« entgegnete dieser. »Kommen Sie oft aufs Land heraus?«
»Oh, höchstens ein oder zweimal im Jahre, um etwas frische Luft zu schöpfen; und Sie mein Herr?«
»Ich fahre alle Abende zum Schlafen heraus.«
»Ach das muss hübsch sein?«
»Gewiss, Madame.«
Und er erzählte so poetisch von seinem täglichen Leben, dass in dem Herzen dieser Bürgersleute, die des grünenden Rasens für gewöhnlich entbehren mussten und für die eine Landpartie das grösste Fest des Landes bildete, wieder völlig jene sinnlose Naturschwärmerei erwachte, der sie sich das ganze Jahr über hinter ihrem Ladentisch hinzugeben pflegten.
Das junge Mädchen hob jetzt sichtlich ergriffen den Kopf und betrachtete sich die beiden Ruderer. »Ja, ja, das ist ein Leben« sagte Herr Dufour, der jetzt zum ersten Male das Wort ergriff. »Noch etwas Kaninchen gefällig, meine Liebe?« fügte er hinzu. »Nein, danke Dir, lieber Freund!«
»Frieren Sie niemals so?« wandte sie sich jetzt wieder den jungen Leuten zu und zeigte auch deren entblösste Arme.
Diese fingen beide herzlich zu lachen an, und machten nun die Familie Dufour durch die Geschichte gruselig, welche sie von ihren Schwitzbädern und ihren Touren im Dunkel der Nacht erzählten. Dabei klopften sie sich mehrfach auf die Brust um den kräftigen Wiederhall derselben zu zeigen.
»Ach ja, Sie haben ein kräftiges Äussere,« sagte Herr Dufour, der nicht mehr auf die Zeit zurückkam, wo er die Engländer geschlagen hatte.
Das junge Mädchen sah sie sich abermals von der Seite an; der Flachskopf, dem beim Trinken etwas in die falsche Kehle gekommen war, hustete heftig und bespritzte bei dieser Gelegenheit die kirschrote Robe der Hausfrau, die zornig nach Wasser rief um die Flecken zu entfernen.
Unterdessen war die Luft entsetzlich schwül geworden und der Alkohol benebelte dazu auch noch die Sinne.
Herr Dufour, den ein heftiger Schluckser plagte, hatte seine Weste und den Oberknopf seines Beinkleides geöffnet, während seine Frau, die beinahe zu ersticken drohte, allmählich leise ihre Taille losheftelte. Der junge Mensch wedelte sich mit der Serviette frische Luft zu und schenkte sich immer wieder zu trinken ein. Die Großmutter, die sich zwar auch etwas angeheitert fühlte, blieb indessen ernst und zurückhaltend. Das junge Mädchen ließ sich äusserlich nichts merken; sein Auge nur leuchtete zuweilen schwärmerisch auf und seine brünette Haut zeigte hin und wieder auf den Wangen ein flüchtiges Rot.
Der Kaffee gab ihnen den Rest. Man sprach von Singen, und jeder gab sein Lied zum Besten, dem die anderen lebhaft Beifall klatschten. Alsdann erhob man sich mit einiger Mühe und während der weibliche Teil der Gesellschaft etwas Atem schöpfte, versuchte sich der männliche Teil, beiderseits stark angetrunken in gymnastischen Übungen. Schwerfällig, schlaff und mit geröteter Stirn fassten sie sich linkisch um die Hüften und suchten sich vergeblich in die Höhe zu heben; dabei drohten ihre Hemden fortwährend aus den Hosen hervorzurutschen und wie Fähnlein vor ihren Bäuchen zu flattern.
Die beiden Ruderer hatten indessen ihre Yollen ins Wasser geschoben und schlugen nun mit vollendeter Höflichkeit den Damen eine kleine Kahnpartie vor.
»Lieber Dufour, erlaubst Du? ich bitte Dich darum« rief seine Frau. Er sah sie mit halbtrunkener verständnisloser Miene an. Da näherte sich ihm der eine Ruderer, zwei Angelschnüre in der Hand haltend. Die Hoffnung auf einen Fischfang, dieses Ideal eines jeden Spiessbürgers, machte das Auge des wackeren Mannes wieder leuchten, und er gab seine Einwilligung zu allem, was man wollte. Unter der Brücke setzte er sich im Schatten hin, und ließ die Beine über’m Wasser baumeln, während der junge Flachskopf an seiner Seite bald selig entschlafen war.
Der eine Ruderer brachte das Opfer, Madame Dufour in seinen Kahn aufzunehmen.
»Zum kleinen Holz auf der englischen Insel« rief er beim Fortrudern dem anderen zu.
Der zweite Kahn entfernte sich viel langsamer. Der Bootführer blickte seine Gefährtin so eigentümlich an, dass sie gar keine rechten Gedanken mehr fassen konnte, und sich von einem eigentümlich einschläfernden Gefühl beschlichen fühlte.
Das junge Mädchen sass am Steuerruder und überliess sich ganz dem sanften Behagen einer Wasserfahrt. Sie fühlte ein solches Widerstreben zu denken, eine solche Schwere in den Gliedern, eine solche Hilflosigkeit sozusagen, als wäre sie in der Tat ernstlich berauscht. Sie war sehr rot geworden und ihr Atem ging kurz. Die leichten Geister des Weines, deren Wirkung die sengende Hitze um sie herum noch vermehrte, spiegelten ihr vor, dass alle Bäume am Ufer sich vor ihr verneigten. Ein undefinierbares Bedürfnis nach Genuss brachte ihr Blut noch mehr in Wallung als die brennende Hitze des Tages; und dazu verwirrte sie noch dieses Tete-a-Tete auf dem Wasser in einer bei der Hitze ganz menschenleeren Gegend mit dem jungen Manne, den ihre Schönheit entschieden anzog, der sie mit den Augen verschlang und dessen Begehrlichkeit so erkennbar war, wie das Licht der Sonne.
Der Umstand, dass sie keine Worte für ein Gespräch fand, vermehrte noch ihre Verlegenheit, und ängstlich ließ sie den Blick über’s Ufer schweifen. Schliesslich frag der junge Mann, ob er ihren Namen wissen dürfe.
»Henriette« sagte sie kurz.
»Schauen Sie«, rief er »ich heisse Henri.«
Beim Klange ihrer Stimmen wurden sie beide wieder ruhiger und sie fingen an, ihr Augenmerk auf den Fluss zu richten. Der andere Kahn hielt an und schien auf sie zu warten. Sein Führer rief dem jungen Manne zu.
»Wir wollen uns im Holze wieder treffen; wir hier fahren erst noch zu Robinson, weil Madame Durst hat.«
Er legte sich sodann in die Riemen und flog so schnell mit seinem Boot davon, dass er bald ihrem Gesichtskreise entschwunden war.
Unterdessen vernahmen die zwei von ferne her ein unbestimmtes dumpfes Donnern, welches jetzt näher und näher kam. Der Fluss selbst schien zu erzittern, als ob das dumpfe Geräusch aus seiner Tiefe emporstiege.
»Was hört man denn da nur immer?« fragte sie. Es war der Fall des Wehres, welches an der Spitze der Insel den Fluss durchschnitt. Er begann eine lange Beschreibung dieser Anlage, als plötzlich durch das Brausen des Wasserfalles der Gesang eines Vogels noch ganz von weitem an ihr Ohr schlug. »Horchen Sie!« sagte er: »Die Nachtigallen schlagen bei Tage; das ist ein Zeichen, dass die Weibchen brüten.«
Eine Nachtigall also! Noch niemals hatte sie eine Nachtigall gehört, und der Gedanke, einer solchen zu lauschen, erweckte in ihrem Herzen die Vorstellung von allerhand poetischen Liebesideen. Eine Nachtigall! Das heisst so viel, wie der unsichtbare Zeuge jener Liebes-Szenen, den einst Juliette auf ihrem Balkon anrief; jene Musik, mit der der Himmel die Küsse der Menschen begleitet; jener nie versagende Quell all der schmachtenden Romanzen, in denen für die armen kleinen Herzen liebesdürstender Mädchen sich ein himmlisches Zauberbild widerspiegelt.
Sie hörte also wirklich eine Nachtigall!
»Seien wir ganz still«; sagte ihr Begleiter, »wir können beim Gehölz landen und uns ganz in ihrer Nähe hinsetzen.«
Das schlanke Boot glitt geräuschlos übers Wasser. Auf der Insel, deren Ufer so niedrig waren, dass man vom Kahn aus tief ins Gebüsch hineinschauen konnte, stiegen jetzt vor den Augen der beiden die hohen Bäume majestätisch empor. Man machte Halt und legte das Boot fest; dann ging Henriette, auf Henri’s Arm gestützt, mit diesem tiefer in das Gezweige der Insel hinein. »Bücken sie sich« sagte er, und Henriette bückte sich. Sic drangen durch fast unentwirrbares Gewirr von Schlingpflanzen, Zweigen und Schilfrohr in ein lauschiges Plätzchen, welches niemand finden konnte, der hier nicht genau Bescheid wusste. Der junge Mann nannte es lachend sein »Geheim-Kabinet.«
Gerade über ihnen, tief im Gezweige eines schattigen Baumes verborgen, sang der Vogel unaufhörlich sein Liedchen. Bald schmetterte er seine Triller und Läufer, bald erfüllte er die Luft mit tiefen zitternden Tönen, welche sich langsam in der Ferne zu verlieren schienen. Es war, als rollten sie dem Flusse entlang und breiteten sich jenseits über das Gelände aus, welches im tiefen Schweigen unter der brennenden Sonnenglut dalag.
Sie hielten sich beide ganz still, aus Furcht, das Tierchen zu vertreiben, während sie dicht aneinander geschmiegt dasassen. Langsam schob Henri seinen Arm um die Taille des jungen Mädchens und suchte es mit einer zärtlichen Bewegung an sich zu ziehen. Ohne besondere Erregung nahm sie ihrerseits diese kühne Hand und schob sie immer wieder zurück, sobald sie sich näherte. Im Übrigen machte sie diese Zärtlichkeit durchaus nicht verlegen; sie hielt sie für eben so natürlich, wie sie dieselbe auch natürlich zurückwies.
In tiefer Verzückung lauschte sie dem Gesang des Vogels. Sie empfand eine dunkle Sehnsucht nach unbekanntem Glück, ihr Inneres wallte in plötzlichem Liebessehnen auf, ihre Gedanken verloren sich in zauberische Fernen, ihre Nerven prickelten, das Herz schlug stürmisch und zärtlich zugleich; und schliesslich begann sie zu weinen, ohne zu wissen, warum. Als sie der junge Mann jetzt wieder an sich zu ziehen suchte, dachte sie nicht daran, ihn abzuwehren.
Plötzlich schwieg die Nachtigall. Von fern rief eine Stimme »Henriette.«
»Antworten Sie nicht,« flüsterte er »sonst verscheuchen Sie den Vogel.«
Es fiel ihr nicht ein, dem Rufe zu antworten. So blieben sie eine Weile ganz still. Madame Dufour musste sich irgendwo hingesetzt haben; von Zeit zu Zeit hörte man dunkel einen leisen Schrei, den die dicke Frau ohne Zweifel infolge zu großer Zudringlichkeit ihres Begleiters ausstiess.
Das junge Mädchen weinte immer noch in dem unklaren Drange ihrer Gefühle und von der natürlichen Sinnlichkeit gekitzelt, die dieser Ort und ihre Lage erwecken musste. Henri’s Haupt ruhte auf ihrer Schulter und plötzlich küsste er stürmisch ihre Lippen. Einen Augenblick fühlte sie instinktmässig den Drang der Abwehr und beugte sich hintenüber; aber ihre Lage war nun noch ungünstiger. Henri wusste seinen Vorteil daraus zu ziehen und presste seine Lippen, so sehr sie sich auch sträubte, mit sanfter Gewalt auf die ihrigen. Eine wahnsinnige Liebesglut durchdrang ihren ganzen Körper, sie zog Henri stürmisch an sich, gab ihm seine Küsse doppelt zurück und ihr letzter Widerstand entfloh in einem tiefen langatmigen Seufzer.
Ringsum war alles still; der Vogel hob wieder an zu singen. Erst schmetterte er drei Töne in die Luft, die wie ein Jubelton der Liebe klangen, dann begann er nach einer kurzen Pause mit schmelzender Stimme seine zarten Melodien.
Durch die Blätter ging das leise Flüstern eines Windhauches und aus dem Gebüsch drangen zwei tiefe Seufzer, die sich mit dem Gesang der Nachtigall und dem sanften Rauschen des Laubes verschmolzen.
Der Vogel schien jetzt liebestrunken zu werden; sein Gesang wurde immer schwellender wie eine zunehmende Feuersbrunst, und die Leidenschaft, die aus ihm herausklang, fand ihr Echo in den stürmischen Küssen, die im Gebüsche unter ihm ausgetauscht wurden. Schliesslich tobte er ordentlich in den schmelzendsten Tönen seiner Kehle; er schien von Liebesohnmacht, von melodischen Krämpfen befallen.
Hin und wieder ruhte er etwas aus, indem er nur zwei oder drei leise Töne von sich gab, die mit einem schrillen Laut abbrachen. Oder er nahm auch einen tollen Anlauf mit schmatzenden Tönen, mit eigentümlichen Kadenzen, die wie rasender Liebesgesang klangen, und denen dann plötzlich einige laute Triumphrufe folgten.
Nun aber schwieg er, denn er vernahm unter sich ein Seufzen, so tief und schmerzlich, dass es wie das Abschiednehmen einer Seele klang; immer anhaltender stiegen diese Seufzer zu dem lauschenden Vogel empor, bis sie sich schliesslich in ein krampfhaftes Schluchzen verwandelten.
*
Sie waren beide sehr bleich, als sie ihre grüne Ruhestätte verliessen. Der blaue Himmel schien ihnen bewölkt, das grelle Licht der Sonne verdunkelt; sie empfanden eine Art Grauen bei der Stille und Einsamkeit, die ringsum herrschte. Flüchtigen Schrittes eilten sie nebeneinander fort, ohne zu sprechen, ohne sich aneinander zu schmiegen; sie schienen vielmehr unversöhnliche Feinde geworden zu sein. Es war, als ob bei ihnen ein gegenseitiger körperlicher Ekel und geistiger Widerwille entstanden wäre.
»Mama, Mama!« rief Henriette von Zeit zu Zeit. Unter einem Gebüsch entstand eine Bewegung; Henri glaubte einen weißen Rock zu bemerken, der hastig über ein rundes Bein herabgestreift wurde. Bald darauf zeigte sich auf der anderen Seite die dicke Dame, noch etwas rot und verlegen, während ihre Augen glänzten und ihre Brust wogte; sie hielt sich auffallend nah an ihren Begleiter. Dieser schien wunderbare Dinge erlebt zu haben, denn über sein Antlitz zuckte es fortwährend wie von mühsam unterdrücktem Lachen.
Madame Dufour hatte mit zärtlicher Gebärde seinen Arm genommen und so ging man zu den Booten zurück; Henri mit seiner jungen Gefährtin voraus, die stumm neben ihm herschritt. Während des Gehens glaubte Henri plötzlich hinter sich das Geräusch eines schmatzenden Kusses zu vernehmen.
Man kam schliesslich wieder in Bezons an, wo Herr Dufour, ziemlich ernüchtert, sich bereits zu langweilen begann. Der junge Mensch mit dem Flachshaar nahm gerade noch einen Imbiss in der Wirtschaft. Der Wagen stand bereits angespannt im Hofe, und die Großmutter, die schon aufgestiegen war, äusserte lebhaft ihre Furcht davor, bei der Unsicherheit der Pariser Umgebung unterwegs von der Dunkelheit überrascht zu werden.
Man schüttelte sich die Hände und die Familie Dufour fuhr ab.
»Auf Wiedersehn!« riefen die beiden Bootsleute. Ein Seufzer und eine Träne bildeten die Antwort.
*
Zwei Monate später, als Henri zufällig durch die Rue des Martyrs kam, las er über einer Türe: »Dufour, Krämer.«
Er trat ein.
Die dicke Dame sass hinter dem Ladentisch. Sie erkannte ihn sofort wieder und Henri bemühte sich, ihr allerlei Liebenswürdigkeiten zu sagen.
»Und Fräulein Henriette, wie geht es ihr?« fragte er dann.
»Danke, sehr gut, sie ist verheiratet.«
»Ah! …«
»Und mit wem?« fuhr er fort, mühsam seine Bewegung unterdrückend.
»Nun, mit dem jungen Mann, wissen Sie, der uns damals begleitete; er übernimmt später das Geschäft.«
»Ah, jetzt verstehe ich.«
Als er fortging fühlte er unwillkürlich eine gewisse Traurigkeit. Madame Dufour rief ihn zurück.
»Wie geht es Ihrem Freunde?« fragte sie.
»Danke, recht gut.«
»Grüssen Sie ihn von uns; aber nicht vergessen! Und er möchte uns doch mal besuchen, wenn er vorbei käme …«
»Es würde mich besonders freuen, sagen Sie ihm das« fügte sie hinzu.
»Werde nicht verfehlen. Adieu!« entgegnete Henri.
»Nein, nicht Adieu! Auf baldiges Wiedersehen!«
*
Eines Sonntages im nächsten Jahre, als es wieder einmal sehr heiss war, traten Henri alle die unvergesslichen Einzelnheiten dieses Abenteuers plötzlich wieder so deutlich und begehrenswert vor die Seele, dass er, wie von einer dunklen Ahnung getrieben, allein nach dem alten Versteck im Gehölz ruderte.
Er prallte beim Eintritt erstaunt zurück. Sie war da, sie sass mit trauriger Miene im Grase, während neben ihr nur in Hemdsärmeln ihr Gatte, jener junge Mann mit dem Flachshaar, schlief und wie ein Maulesel schnarchte.
Als sie Henri erblickte, wurde sie kreidebleich, sodass er glaubte, sie würde ohnmächtig. Dann begannen sie ganz harmlos miteinander zu plaudern, als sei niemals etwas zwischen ihnen beiden vorgefallen.
Als er ihr aber erzählte, wie lieb ihm dieses Plätzchen sei, und dass er Sonntags oft hierher käme, um an süssen Erinnerungen zu zehren, sah sie ihm lange und tief in die Augen.
»Es vergeht keine Nacht, wo ich nicht daran denke« sagte sie.
»Komm, Liebe,« sagte ihr Mann munter werdend, »es ist Zeit, glaube ich, nach Hause zu gehen.«
*