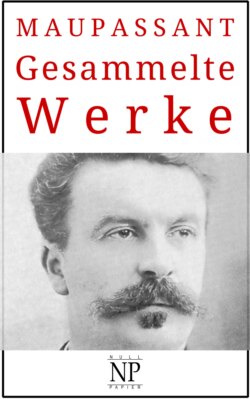Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 68
III.
ОглавлениеAm nächsten Sonntag begaben sich die Baronin und Johanna von einer Art zarter Rücksicht auf den Pfarrer getrieben, zur Messe nach Etouvent.
Nach der Kirche warteten sie auf ihn, um ihn für den nächsten Donnerstag zum Frühstück einzuladen. Er kam Arm in Arm mit einem hochgewachsenen elegant gekleideten jungen Mann, der ihn vertraulich unter den Arm genommen hatte, aus der Sakristei. Sobald er die beiden Damen bemerkte, rief er mit dem Ausdruck freudiger Überraschung:
»Das trifft sich ja herrlich! Gestatten die Damen, Ihnen unsern Nachbar, Herrn Vicomte de Lamare vorzustellen.«
Der Vicomte verbeugte sich höflich und versicherte, dass es schon lange sein Wunsch gewesen sei, die Bekanntschaft der Damen zu machen. Hierauf begann er in geschickter Weise die Unterhaltung und erwies sich dabei als ein Mann, der weiß, was sich gehört. Er hatte jenes angenehme Äussere, von dem die Frauen so gern träumen und dem niemand gram sein kann. Schwarze wohlgepflegte Haare umrahmten seine gebräunte glatte Stirn; dichte Augenbrauen, so regelmässig, als seien sie gemeiselt, überschatteten seine zärtlich blickenden, tiefliegenden dunklen Augen, bei denen das Weiße einen leichten Schimmer von Blau zeigte.
Seine buschigen langen Wimpern verliehen dem Blick jene leidenschaftliche Sprache, die in der Gesellschaft die älteren Damen verwirrt und die Backfische, die noch im kurzen Kleide sind, in die höchste Extase versetzt.
Der sprechende Ausdruck dieses Blickes ließ auf tiefe Gedanken schliessen und verlieh auch gleichgültigeren Worten in seinem Munde eine gewisse Bedeutung.
Der üppige glänzende weiche Schnurrbart verbarg eine etwas zu breite Lippe.
Man trennte sich nach vielen höflichen Redensarten.
Zwei Tage später machte Herr de Lamare seinen ersten Besuch.
Er kam gerade, als man eine Gartenbank besichtigte, die am Morgen unter der großen Platane gegenüber den Fenstern des Salons aufgestellt war. Der Baron meinte, dass man eine ähnliche unter der Linde, der Gleichheit wegen, aufstellen müsse; aber seine Frau, der alle Symmetrie verhasst war, wollte das nicht zugeben. Der Vicomte, um seine Ansicht befragt, stellte sich auf Seite der Baronin.
Hierauf sprach er von der Umgegend, die er sehr »pittoresk« nannte; er habe bei seinen einsamen Spaziergängen schon ganz herrliche »Szenerien« gefunden. Dabei traf sein Blick hin und wieder wie zufällig Johannas Augen, und unwillkürlich fühlte sich diese jedes Mal seltsam bewegt. So kurz auch nur dieser Blick war, so lag doch eine ganze Welt von Bewunderung und hell entfachter Zuneigung in ihm.
Der im vergangenen Jahre verstorbene Vater des Herrn de Lamare hatte zufällig einen intimen Freund des Herrn de Cultaux gekannt, dessen Tochter die Baronin war. Die Entdeckung dieser Tatsache brachte natürlich das Gespräch auf eine Menge von Bekanntschaften, Ereignissen und endlosen Verwandtschafts-Verhältnissen. Die Baronin machte geradezu Gewalt-Märsche auf dem Gebiete der Genealogie; sie zählte den halben Adel Frankreichs in auf- und absteigender Linie auf, ohne jemals den Faden zu verlieren.
»Sagen Sie mir, Vicomte, haben Sie ’mal von den Saunoy de Varfleur gehört? Der älteste Sohn Gontram hatte ein Fräulein de Coursil, von den Coursil-Courville, geheiratet, und der jüngere eine Cousine von mir, ein Fräulein de la Roche-Aubert, welche mit den Crisanges verwandt war. Herr de Crisange war ein intimer Freund meines Vaters und muss auch den Ihrigen gut gekannt haben.«
»Ganz recht, meine Gnädigste! War das nicht der Herr de Crisange, der ausgewandert ist und dessen Sohn sich zu Grunde richtete.«
»Eben der. Er hatte um die Hand meiner Tante nach dem Tode ihres ersten Mannes, des Grafen d’Eretry, angehalten; aber sie wollte ihn nicht nehmen, weil er schnupfte. Bei der Gelegenheit fallen mir die Viloises ein; was mag aus ihnen geworden sein? Sie verliessen die Touraine um das Jahr 1813 in Folge eines Schicksalsschlages. Sie wollten sich in der Auvergne niederlassen; aber ich habe seitdem nie wieder von ihnen gehört.«
»So viel ich weiß, starb der alte Marquis an den Folgen eines Sturzes mit dem Pferde. Von seinen beiden Töchtern heiratete die eine einen Engländer, die andere einen gewissen Bassole, einen Kaufmann, dessen Reichtum sie, wie man sagt, bestochen haben soll.«
So lebten allmählich alle Namen und Erinnerungen aus der Jugendzeit im Laufe der Unterhaltung wieder auf. Und die Heiraten dieser Familien gewannen in ihren Augen eine Bedeutung wie die wichtigsten Ereignisse. Sie sprachen von Leuten, die sie nie gesehen hatten, als wären es alte Bekannte gewesen. Und diese Leute drüben in anderen Gegenden sprachen gewiss von ihnen in derselben Weise. Man fühlte sich aus der Ferne zu einander hingezogen, wie Freunde und Verwandte; und das alles aus dem einen Grunde, weil man demselben Stande, derselben Gesellschaftsklasse angehörte und dasselbe Blut in seinen Adern fühlte.
Der Baron, welcher seiner ungebundenen Natur und seiner ganzen Erziehung nach mit den Anschauungen und Vorurteilen seiner Standesgenossen wenig harmonierte, kannte die Familien in der Umgegend kaum dem Namen nach und befragte jetzt den Vicomte darüber.
»O, es gibt wenig Adel hier im Lande« antwortete Herr de Lamare ungefähr in demselben Tone, wie er gesagt haben würde, es gebe wenig Kaninchen an der Küste. Hierauf begann er mit Einzelheiten. Nur drei Familien wohnten ziemlich in der Nähe: der Marquis de Coutelier, sozusagen der Chef des Adels in der Normandie; der Vicomte und die Vicomtesse de Briseville, von ausgezeichneter Abstammung, die sich aber so ziemlich von Allen zurückzogen. Endlich sei noch der Graf Fourville da, eine Art Blaubart, dessen Frau vor Gram über sein Leben gestorben sei. Er lebte ausschliesslich der Jagd in der Umgebung seines Schlosses la Vilette, welches mitten in einem großen Teiche liege. Einige Emporkömmlinge, die aber keinen Zutritt zur Gesellschaft fänden, hätten hier und da sich angekauft. Der Vicomte kannte sie auch nicht.
Nach einiger Zeit verabschiedete sich der junge Mann, nicht ohne einen letzten Blick auf Johanna geworfen zu haben, der wie ein besonders zärtliches sanftes Lebewohl aussah.
Die Baronin fand den Vicomte sehr nett und vor allem sehr »comme il faut.« »Jawohl, ganz gewiss«, antwortete ihr Gatte, »es ist ein sehr wohlerzogener junger Mann.«
Man hatte ihn für die nächste Woche zum Diner eingeladen. Von da an war er ein sehr häufiger Gast im Schlosse.
Meistens kam er gegen vier Uhr Nachmittags, suchte die Baronin in »ihrer Allee« auf und bot ihr den Arm, um sie bei »ihrer Übung« zu unterstützen. Wenn Johanna gerade keinen Ausflug machte, stützte sie die Baronin von der anderen Seite und alle drei gingen nun langsamen Schrittes in der geraden Allee hin und her. Er sprach fast niemals mit der jungen Dame. Aber sein dunkler verschleierter Blick traf häufig das achatblaue Auge Johannas.
Mehrmals gingen sie auch beide in Begleitung des Barons nach Yport.
Als sie eines Abends am Ufer standen, trat Papa Lastique auf sie zu, seine Pfeife im Munde, deren Fehlen auffallender gewesen wäre, als das Fehlen seiner Netze.
»Bei diesem Winde, Herr Baron,« meinte er, »müsste man morgen eigentlich nach Etretat fahren. Wir kämen bequem hin und zurück.«
»Ach Papa!« sagte Johanna, die Hände faltend, »das wäre zu herrlich.«
»Machen Sie mit?« wandte sich der Baron an den Vicomte. »Wir könnten da unten frühstücken.«
Da dieser zustimmte, wurde die Partie sofort beschlossen.
Mit dem Morgengrauen war Johanna schon auf und wartete voll kindlicher Ungeduld auf ihren Vater, der etwas langsam im Anziehen war. Dann gingen sie durch den frischen Morgentau erst an dem großen Rasenplatz vorbei, hierauf durch das Holz, welches vom Gesang der Vögel widerhallte. Der Vicomte und Papa Lastique sassen auf einer Schiffswinde.
Zwei andere Schiffer halfen bei der Abfahrt. Ihre Schultern gegen den Schiffsrand stemmend, schoben sie aus Leibeskräften; aber sie brachten den Kiel nur langsam von dem kiesigen Grunde ab. Lastique schob einige mit Fett beschmierte Rollen unter den Kiel, dann nahm er seinen Platz wieder ein und ließ mit eigentümlicher Modulation sein unaufhörliches »Ahoh hopp« erklingen, mit dem er die Bewegungen seiner Genossen leitete.
Als aber dann der Boden schräger wurde, kam das Boot plötzlich in eine rasche Bewegung und glitt über die Kiesel mit einem Tone, als würde ein Gewebe zerrissen. Jetzt ruhte es auf dem leicht gewellten Wasser und alles nahm auf den Bänken Platz. Dann schoben die beiden Schiffer, die am Ufer geblieben waren, es mit einem mächtigen Stoss in die See.
Eine leichte anhaltende Brise rief auf der Oberfläche des Wassers kleine schaumige Wellen hervor. Das Segel wurde gehisst, es blähte sich mehr und mehr, und von den Wellen gewiegt, bewegte sich die Barke langsam vorwärts.
Man fuhr anfangs weiter in See. In der Ferne verschwamm das Blau des Himmels mit dem Ozean. Wenn man zum Lande herüberschaute, so bemerkte man deutlich den tiefen Schatten, den die hohe Küste auf das Meer zu ihren Füssen warf, während man durch die Vertiefungen zwischen den einzelnen Hügeln hindurch die darunterliegenden Rasenflächen im vollen Sonnenlichte sah. Drüben im Hintergrunde hoben sich braune Segel von dem weißen Flecken ab, den Fecamp bildete, und fern da unten ragte ein Felsen empor, der wie ein Elephant aussah, dessen Rüssel ins Meer getaucht ist. Das war das sogenannte kleine Tor von Etretat.
Johanna, der das Schaukeln der Wogen anfangs etwas unheimlich war, hatte mit der einen Hand den Schiffsrand gefasst und blickte in die Ferne; es schien ihr, als ob es nur drei wirklich schöne Dinge in der Welt gäbe: die Sonne, den Himmelsdom und das Wasser.
Niemand sprach ein Wort. Papa Lastique, der das Steuerruder führte und das Segeltau hielt, nahm hin und wieder einen Schluck aus der Flasche, die er unter seinem Wams geborgen hatte. Dabei rauchte er unablässig seine nie verlöschende Pfeife, aus der fortwährend eine leichte blaue Dampfwolke aufstieg, während eine zweite aus seinem rechten Mundwinkel hervordrang. Man sah den Schiffer niemals die Pfeife von Neuem anzünden oder frisch stopfen, die, aus weißem Ton gebrannt, durch den langen Gebrauch schwarz wie Ebenholz geworden war. Nur hin und wieder nahm er sie aus dem Munde, um aus demselben Winkel, wo sonst der Rauch hervordrang, den braunen Saft in einem weiten Bogen ins Meer zu schleudern.
Der Baron, der vorn sass, vertrat die Stelle eines Bootsgehilfen und überwachte das Segel. Johanna und der Vicomte sassen nebeneinander und waren alle beide etwas verlegen. Nur hin und wieder trafen sich, wie von magischer Gewalt angezogen, ihre beiderseitigen Blicke; hatte doch zwischen ihnen sich schon im Stillen jene flüchtige zarte Zuneigung entwickelt, welche bei jungen Leuten so leicht entsteht, wenn der männliche Teil nicht hässlich und der weibliche hübsch ist. Sie waren glücklich, bei einander zu sitzen, vielleicht weil eins an den andren dachte.
Die Sonne stieg immer höher, als wollte sie von oben her das unter ihr ausgebreitete weite Meer betrachten. Wie in einer Art von Koketterie hüllte sie sich in einen leichten Nebelschleier, an dem sich ihre Strahlen brachen. Es war ein durchsichtiger Schleier, sehr niedrig, goldig, der nichts verbarg, aber alles in einem sanfteren Lichte erscheinen ließ. Allmählich nahm der Glanz des Himmelsgestirnes zu, der Nebel senkte sich tiefer und als die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hatte, verschwand er gänzlich. Das Meer, jetzt glatt wie ein Spiegel, glitzerte in dem strahlenden Lichte.
»Wie prächtig das ist!« murmelte Johanna tiefbewegt.
»Ja, in der Tat, es ist herrlich« sagte der Vicomte. Dieser schöne klare Sommermorgen spiegelte sich wie ein Bild des Glückes in ihrem eigenen Herzen wieder.
Und plötzlich sah man vor sich die großen Felsenbogen von Etretat, wie zwei Füsse, die von der Küste aus ins Meer gestreckt sind, hoch genug, um den Schiffen den Durchgang zu gestatten. Vor dem ersten derselben starrte eine weiße scharfkantige Felsenspitze gen Himmel.
Nachdem man gelandet war, stieg der Baron zuerst aus und hielt die Barke mittels eines Taues am Ufer fest. Der Vicomte trug hierauf Johanna auf seinen Armen ans Land, damit sie keine nassen Füsse bekäme. Beide stiegen dann langsam den steilen Strand hinan, noch ganz unter dem Eindruck des eigentümlichen Gefühles, welches das Hinübertragen bei ihnen hervorgerufen hatte. Sie hörten noch, wie Papa Lastique zum Baron sagte: »Das gäbe ein prächtiges Paar ab.«
Das Frühstück in einem kleinen Wirtshaus am Strande mundete vortrefflich. Bei dem gewaltigen Eindruck, den der Ozean auf alle ihre Sinne machte, hatten sie während der Fahrt keine Worte gefunden; jetzt löste der gutbesetzte Tisch ihre Zunge und sie plauderten wie Kinder auf einer Ferienreise.
Selbst die harmlosesten Dinge erweckten ihre Lustigkeit.
Papa Lastique verbarg seine noch rauchende Pfeife in seiner Schiffermütze, worüber man lachte. Eine Fliege, zweifelsohne von seiner roten Nase angezogen, kam immer wieder, um sich darauf zu setzen. Als er sie mit einer Handbewegung vergeblich zu haschen suchte, nahm sie in der Nähe auf einem Vorhang Platz, der deutliche Spuren von ihr und ihren Gefährtinnen aufzuweisen hatte. Von dort aus lauerte sie unablässig auf den leuchtenden Zinken des Fischers, wo sie sich stets aufs Neue niederzulassen strebte.
Bei jedem Versuch des kleinen Insektes erscholl ein dröhnendes Gelächter, und als der Alte schliesslich, durch das ewige Kitzeln ärgerlich geworden, vor sich hinmurmelte: »Die ist verteufelt hartnäckig«, da hätten der Vicomte und Johanna fast Tränen gelacht. Sie wanden und krümmten sich ordentlich und hielten die Serviette vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien.
Nach dem Kaffee schlug Johanna einen Spaziergang vor. Der Vicomte sprang sofort auf; der Baron hingegen zog es vor, in der Sonne am Strande sein Schläfchen zu machen.
»Geht nur, Kinder«, sagte er, »in einer Stunde wollen wir uns hier wieder treffen.«
Sie gingen geradeaus an den wenigen Strohdächern des Ortes vorüber. Nachdem sie ein kleines Schloss, welches schon mehr einem großen Pachthofe ähnlich sah, hinter sich gelassen hatten, sahen sie plötzlich ein offenes Tal vor sich liegen.
Die Seefahrt mit ihren aussergewöhnlichen Eindrücken hatte sie sprachlos gemacht, und die leichte salzhaltige Luft war die Ursache eines gesunden Appetits für sie gewesen, den sie beim Frühstück reichlich stillten, dessen schmackhafte Zubereitung ihnen ihre volle Lustigkeit zurückgab. Nachdem sie sich gründlich ausgelacht hatten, fühlten sie jetzt wieder eine Art Erschlaffung und das Bedürfnis, ziel- und zwecklos im Freien umherzuschweifen. Johannas Pulse klopften unter dem Eindrucke neuer und schnellwechselnder Gemütsstimmungen unwillkürlich stürmischer.
Die Sonne brannte heiss am Himmel. Zu beiden Seiten der Strasse wogten die reifen Getreidefelder im Winde. Heuschrecken hüpften munter im Grase; überall, im Korn, im Strauchwerk, in den Binsen am Strande vernahm man ihr kurzes schrilles Zirpen.
Sonst war alles still unter dem heissen Himmelszelt, dessen Blau hin und wieder ins gelblich-rote herüberspielte, wie Stahl, den man zu lange in die Glut gehalten hat.
Sie gingen zu einem kleinen Gehölz, welches sie etwas weiter rechts bemerkten.
Zwischen zwei Talwänden eingekeilt, lag dasselbe durch seine hohen dichten Bäume völlig vor den heissen Sonnenstrahlen geschützt; nur ein schmaler Weg führte hindurch. Eine dumpfe Kühle, welche unwillkürlich die Haut schaudern machte, umfing sie beim Eintreten. Da das Tageslicht nur spärlich durchfiel, so war das Gras bei dem Mangel an freier Luft verschwunden; aber weiches Moos bedeckte statt seiner den Boden.
»Sehen Sie, dort drüben könnten wir uns etwas setzen« sagte Johanna im Weiterschreiten. Dort standen zwei alte abgestorbene Bäume, und durch die so gebildete Öffnung des Laubdaches fiel der Tagesschimmer auf den Boden. Er hatte das keimende Gras neu belebt, Löwenzahn und Schlüsselblumen hervorgezaubert; auch die zarten kleinen Vergissmeinnicht und der Fingerhut waren dort zu finden. Schmetterlinge gaukelten umher, Bienen und die dicken kurzen Hummeln summten von Blume zu Blume, große Mücken, die wie Fliegen-Gerippe aussahen, tanzten im Sonnenlicht; es wimmelte von Insekten aller Art. Da sah man solche mit glänzenden buntgefleckten Flügeldecken, dann wieder andere mit grünlichem Schimmer, tiefschwarze mit einem kleinen Horn versehen; und das alles lebte, wogte, krabbelte und tanzte auf diesem lichten warmen Plätzchen inmitten des eisigen Dunkels, welches sonst das dichte Laubdach hervorrief.
Sie setzten sich so, dass ihre Gesichter noch Schatten erhielten, während sie die Füsse in die warmen Sonnenstrahlen streckten. Mit Interesse betrachteten sie das kleine anziehende Bild voll Leben und Lebenslust, das sich vor ihren Augen abspielte.
»Wie schön!« sagte Johanna. »Es ist doch gar zu herrlich auf dem Lande. Ich möchte zuweilen eine Fliege oder ein Schmetterling sein, um in die Kelche der Blumen zu tauchen.«
Sie sprachen dann von sich selbst, von ihren Gewohnheiten und Neigungen, in jenem leisen vertraulichen Ton, in dem man sich solche Mitteilungen macht. Er behauptete, das Leben in der großen Welt, deren läppisches Treiben ihn anwidere, schon müde zu sein. Es sei immer dieselbe Geschichte, nirgends fände man Wahrheit, nirgends Aufrichtigkeit.
Die Welt! Sie hätte dieselbe freilich schon gern mal kennen gelernt; aber sie war von vornherein überzeugt, dass sie ihr das Landleben nicht ersetzen könne.
Und mehr und mehr schlugen ihre Herzen zusammen; immer feierlicher klang ihnen das »mein Herr« und »mein Fräulein«, mit dem sie sich anredeten, und immer öfter versenkten sich ihre lächelnden Blicke ineinander. Es schien ihnen beiden, als ob sich ein grösseres gegenseitiges Wohlwollen zwischen ihnen entwickele, eine innigere Zuneigung, ein gemeinschaftliches Interesse an tausend Dingen, wie sie es bisher niemals empfunden hatten.
Als sie zurückkamen, war der Baron zu Fuss nach der Damen-Kammer, einer Felsengrotte an der Küste, gegangen. Sie warteten also beim Wirtshause auf ihn.
Erst gegen fünf Uhr abends, nach einem langen Spaziergang an der Küste, kehrte er zurück.
Man bestieg wieder die Barke. Ganz sanft, den Wind im Rücken, ohne jeden Stoss und jedes Schaukeln glitt sie vorwärts; man bemerkte kaum, dass sie sich bewegte. Nur mit Absätzen blähte ein leichter sanfter Windhauch die Segel, um sie gleich darauf wieder schlaff am Maste herunterhängen zu lassen. Das Wasser war wie abgestorben, während die Sonne nach Vollendung ihrer Bahn langsam ins Meer unterzutauchen schien.
Wiederum herrschte allgemeines Schweigen unter dem überwältigenden Eindrucke dieser abendlichen Meeresstille.
»Ich würde sehr gern ’mal auf Reisen gehen«, sagte endlich Johanna.
»Jawohl«, meinte der Vicomte, »dieser Wunsch ist nur zu sehr berechtigt. Aber ich finde es zu traurig, allein zu reisen. Man muss wenigstens zu zweien sein, um sich gegenseitig seine Eindrücke mitteilen zu können.«
»Das stimmt …« sagte sie nach einigem Nachdenken, »ich liebe es zwar auch, allein spazieren zu gehen, indessen …; man ist aber besser allein, wenn man träumen will …«
»Man kann auch zu zweien träumen«, sagte er, jedes Wort betonend und sie dabei lange ansehend.
Sie schlug die Augen nieder. Sollte das eine Anspielung sein? Sie betrachtete den Horizont, als weilten ihre Gedanken in der Ferne.
»Ich möchte nach Italien reisen …« begann sie wieder langsam. »Und nach Griechenland … ach ja! nach Griechenland! … und nach Korsika! das muss so wildromantisch sein.«
Er hätte der Alpen und Seen wegen die Schweiz vorgezogen.
»Nein«, sagte sie, »ich möchte entweder nach ganz unbekannten Gegenden wie Korsika oder nach ganz alten Ländern, wie Griechenland, wo jeder Fleck Erde seine Geschichte hat. Es muss so hübsch sein, die Spuren der Völker zu verfolgen, von denen wir schon in der Jugend gelesen haben und die Orte zu sehen, wo sich die großen Ereignisse abgespielt haben.«
»Was mich betrifft«, entgegnete der etwas weniger schwärmerische Vicomte, »so zieht mich England ausserordentlich an. Dort kann man vieles lernen.«
So durchwanderten sie gemeinsam den Erdkreis, indem sie die einzelnen Länder und ihre Vorzüge lebhaft erörterten und selbst die weniger bekannten Völker, wie die Chinesen und Lappländer mit ihren zum Teil noch unerforschten Sitten und Gebräuchen dabei nicht übergingen. Schliesslich aber einigten sie sich in der Ansicht, dass Frankreich mit seinem gemässigten, im Sommer nicht zu heissen, im Winter nicht zu rauen Klima, mit seinen üppigen Triften und grünen Wäldern, seinen herrlichen Strömen, mit seinem Kunstsinn, der kaum von der Blütezeit Athens übertroffen wäre, das prächtigste Land der Welt sei.
Hierauf schwiegen sie auch wieder.
Die Sonne, schon halb im Meere versunken, sandte über die stille Wasserfläche ihre letzten Strahlen, welche bis zum Schiffe einen glänzenden Streifen auf derselben bildeten.
Die letzten Windstösse hatten aufgehört. Keine Furche war auf dem Wasser mehr zu sehen; das schlaffe Segel schimmerte in rosigem Lichte. Eine unbegrenzte Ruhe schien den weiten Himmelsraum zu umfassen. Wie eine keusche Braut schien das gewaltige Meer seinen feurigen Liebhaber zu erwarten, der, wie von dem Verlangen nach seiner Umarmung, mit Purpurglut übergossen sich zu ihm niederneigte, um endlich ganz in demselben zu verschwinden.
Dann begann allmählich eine erquickende Kühle einzutreten. Ein Schauer wölbte den Busen des Wassers, als wenn das untergegangene Tagesgestirn einen Seufzer stillen Friedens über die Welt ausgestossen hätte.
Die Dämmerung währte nicht lange. Die Nacht mit ihrem funkelnden Sternenheer brach an. Papa Lastique griff zu den Rudern und man bemerkte beim Einschlagen derselben, dass das Meer phosphoriszierte. Johanna und der Vicomte betrachteten miteinander die tanzenden Lichtstreifen, welche die Barke hinter sich ließ.
Sie waren aus ihren Träumereien wieder aufgewacht und atmeten mit Behagen die frische erquickende Abendluft ein. Johanna hatte die eine Hand auf die Bank gestützt, und wie zufällig berührte sie dabei die Finger des Vicomte. Aber sie zog die Hand nicht zurück; die leichte Berührung flösste ihr ein eigentümliches wonniges Gefühl ein.
Als sie an diesem Abend ihr Zimmer betrat, fühlte sie sich seltsam bewegt; sie hätte am liebsten weinen mögen. Sie betrachtete die Uhr auf dem Kamin und dachte, dass die Bewegung der kleinen Biene dem Schlage des Herzens gliche, eines Herzens, das ihr nahe stand. Sie dachte, dass sie die Zeugin seines ganzen Lebens sein würde, dass sie die Freuden und Leiden dieses lebhaften und doch so regelmässigen Tik-Tak’s teilen würde. Und plötzlich hielt sie die vergoldete Biene an, um einen Kuss darauf zu drücken. Sie hätte am liebsten die ganze Welt geküsst. Es fiel ihr ein, dass sie unten in einer Schieblade eine ihrer alten Puppen verwahrt hatte. Sie holte sie hervor mit einer Freude, als träfe sie eine liebe alte Bekannte wieder; und indem sie das teure Spielzeug zärtlich an ihre Brust drückte, bedeckte sie die rotgefärbten Lippen desselben mit zahlreichen heissen Küssen.
Traumverloren hielt sie es lange so in ihren Armen.
War das wirklich »Er«, den ihr tausendfach eine innere Stimme versprochen, den ihr eine gütige Vorsehung so in den Weg geführt hatte? War er wirklich das für sie bestimmte Wesen, dem sie ihr ganzes Dasein opfern würde? Waren sie beide dazu bestimmt, sich in inniger Zärtlichkeit zu vereinen, für immer zu verbinden, die »Liebe« zu kosten?
Sie empfand noch nicht jene stürmischen Regungen der Seele, jene tiefen Gefühle, unter welchen sie sich die Leidenschaft vorstellte; es schien ihr aber, als beginne sie doch, ihn zu lieben. Denn sobald sie an ihn dachte, schlug ihr Herz höher; und sie dachte unaufhörlich an ihn. Seine Gegenwart ließ ihre Pulse heftiger klopfen, sie wurde abwechselnd bleich und rot, wenn sie seinem Blick begegnete; und sie zuckte zusammen, wenn sie seine Stimme hörte.
In dieser Nacht schlief sie wenig.
Von da an nahm das unruhige Liebessehnen sie immer mehr gefangen. Sie erforschte unaufhörlich sich selbst, befragte die Margheriten, die Wolken und warf Geldstücke in die Luft, um aus ihrem Fall sich die Antwort zu holen.
»Mach’ Dich hübsch, Kind, morgen Vormittag«, sagte dann eines Abends der Baron zu ihr.
»Warum denn, Papa?« fragte sie neugierig.
»Das ist ein Geheimnis«, antwortete er.
Und als sie am anderen Morgen herunterkam wie eine frisch erblühte Rose in ihrer lichten Toilette, fand sie den Tisch im Salon mit Bonbonieren bedeckt und auf dem einen Sessel ein mächtiges Bouquet.
Im Hof fuhr ein Wagen vor, auf dem man die Inschrift las: »Lerat, Kuchenbäcker in Fecamp. Hochzeitsdiners.« Ludivine, welche in Begleitung eines Küchenjungen herbeigeeilt kam, holte aus dem Innern desselben verschiedene verdeckte Schüsseln heraus, die sehr gut rochen.
Jetzt erschien der Vicomte de Lamare. Seine Beinkleider spannten sich über zierlichen Lackstiefeletten, welche die Kleinheit seiner Füsse noch mehr hervortreten liessen. Aus der Brustöffnung seines enganschliessenden Überrockes traten die Spitzen seines Faltenhemdes hervor, während eine elegante Halsbinde, dreifach geschlungen, ihn zwang, den Kopf höher als gewöhnlich zu tragen, was seinem gebräunten Antlitz einen gewichtigen Eindruck verlieh. Er hatte eine andere Miene wie sonst, jenen besonderen Ausdruck, den eine gewählte Toilette auch dem bekanntesten Gesicht gibt. Johanna war erstaunt und betrachtete ihn wie einen völlig Fremden. Sie fand übrigens, dass er das Musterbild eines Edelmannes, eines großen Herrn, vom Scheitel bis zur Zehe war.
»Nun, Gevatterin, sind Sie bereit?« sagte er, sich lächelnd verbeugend.
»Aber zu was denn?« stammelte sie. »Was gibt es denn?«
»Du wirst es gleich erfahren« sagte der Baron.
Der Wagen fuhr vor und Madame Adelaïde in großer Toilette stieg die Treppe herunter, gestützt von Rosalie. Letztere war so überrascht von der Eleganz des Vicomte, dass die Baronin ihm zuflüsterte:
»Hören Sie, Vicomte, ich glaube, unser Kammermädchen ist entzückt von Ihnen.«
Er wurde rot bis über die Ohren; aber er tat, als habe er nichts gehört. Er bemächtigte sich des großen Bouquets und überreichte es Johanna, welche es erstaunter noch als vorher annahm. Alle vier bestiegen jetzt den Wagen. Die Köchin Ludivine, welche der Baronin eine Tasse Fleischbrühe zur Stärkung brachte, konnte sich nicht enthalten zu sagen:
»Aber, gnädige Frau, das ist ja wie eine Hochzeit.«
In Yport stieg man aus, und sobald sie das Dorf betraten, traten die Fischer in ihren besten Anzügen aus den Türen, grüssten, drückten dem Baron die Hand und folgten prozessionsweise dem Zuge, den der Vicomte, mit Johanna am Arm, anführte.
Vor der Kirche wurde Halt gemacht. Ein Chorknabe mit dem hochgehaltenen silbernen Kreuz trat heraus, dem ein anderer im roten Chorrock und weißem Rochette folgte. Letzterer trug den Weihwasserkessel mit dem Wedel darin.
Dann kamen drei alte Chorsänger, von denen einer hinkte, dann der Organist, endlich der Pfarrer, die goldgestickte Stola über der Brust gekreuzt. Er wünschte lächelnd durch ein Neigen des Hauptes »Guten Morgen.« Dann folgte er mit halbgeschlossenen Augen, ein Gebet auf den Lippen, das Barett in die Stirn gedrückt, seinem Stabe, der sich nach dem Meere hin bewegte.
Am Strande umstand eine dichtgedrängte Menge eine neue blumengeschmückte Barke. Ihr Mast, die Segel, das Tauwerk, waren mit langen Bändern geschmückt, die im Winde flatterten. Am Steuerbord erglänzte in goldigen Buchstaben der Name »Johanna.«
Papa Lastique, der Patron dieses mit dem Gelde des Barons erbauten Schiffes trat aus der Menge vor. Alle Menschen entblössten beim Anblick des Kreuzes mit derselben Handbewegung gleichzeitig ihre Häupter und knieten in einer dreifachen Reihe nieder. Es war ein seltsamer Anblick: Alle diese Andächtigen, eingehüllt in die gleichartigen, weiten schwarzen Schultermäntel.
Der Pfarrer mit den beiden Chorknaben begab sich in das eine Ende des kleinen Fahrzeuges, während an dem anderen sich die drei alten Chorsänger aufstellten. Ihre weißen Chorhemden waren nicht mehr ganz sauber, das Kinn unrasiert; aber sie schauten mit ihrer wichtigsten Miene in das Gesangbuch und detonierten in Folge der klaren Morgenluft recht bedenklich.
Jedes Mal, wenn sie Atem schöpften, setzte der Küster allein seinen Gesang fort, und seine kleinen grauen Augen verschwanden fast hinter den dick aufgeblasenen Backen. Seine Stirn und sein Nacken waren von der Anstrengung so rot geworden, dass man hätte meinen können, die Haut wäre ihm dort abgezogen.
Das Meer selbst in seiner klaren unbeweglichen Ruhe schien an der Taufe seines Fahrzeuges Teil zu nehmen. Kaum eine leichte Regung des Wassers war zu bemerken, leise nur knirschte der Kies des Gestades unter den Wellen, die nicht ’mal eine Handbreit hoch waren. Und die großen weißen Möven zogen mit ausgebreiteten Schwingen ihre Kreise am blauen Himmel; bald schossen sie pfeilschnell davon, bald kamen sie langsam durch die Luft gesegelt auf die Menge der Andächtigen zu, als wollten sie schauen, was es da eigentlich gäbe.
Jetzt schloss der Gesang mit einem minutenlangen Amen und der Priester sprach mit tiefer Stimme ein lateinisches Gebet, von dem man im Allgemeinen nur die schärfer betonten Endsilben verstand.
Alsdann machte er einen Gang über die ganze Barke und besprengte sie mit Weihwasser; hierauf sprach er das Pater noster, wobei er an der Langseite des Schiffchens den Taufpaten gerade gegenüber stand. Diese blieben unbeweglich Hand in Hand.
Der junge Mann wenigstens behielt ganz seine ernste würdevolle Miene bei; aber die junge Dame wurde schliesslich doch von einer plötzlichen inneren Regung erfasst und fühlte sich so erschüttert, dass ihr die Zähne klapperten. Der Traum, der sie schon so lange verfolgte, nahm plötzlich eine feste Gestalt an; wenigstens glaubte sie seine Erfüllung vor sich zu sehen. Man hatte von einer Hochzeit gesprochen und ein Priester war da, um zu segnen; fromme Lieder und Gebete tönten zum Himmel. War das nicht in der Tat, als wenn es ihre Hochzeit wäre?
War das nervöse Zucken ihrer Hand, der erregte Schlag ihres Herzens durch ihre Adern zum Herzen ihres Nachbarn gedrungen? Verstand er sie, erriet er ihre Gedanken; wurde er wie sie von einem Gefühl zärtlichster Liebe beseelt? Oder wusste er nur aus Erfahrung, dass kein weibliches Wesen ihm zu widerstehen vermochte? Sie fühlte plötzlich, wie er ihre Hand drückte, anfangs ganz sanft, dann immer stärker, sodass sie fast hätte aufschreien mögen. Und ohne im Mindesten seinen ernsten Gesichtsausdruck zu verändern, sodass niemand es bemerkte, sagte er zu ihr, ja, er sagte es ganz deutlich:
»Ach, Johanna, wenn Sie wollten, könnte das unsere Verlobungsfeier werden!«
Sie neigte ganz langsam das Haupt, sodass es wie ein leises »Ja« gelten konnte; und in diesem Augenblicke fielen einige Tropfen des Weihwassers, womit der Priester sie besprengte, auf ihre zusammengepressten Hände.
Die Zeremonie war beendigt. Die Frauen erhoben sich von den Knien. Der Rückweg wurde in Unordnung angetreten. Der Chorknabe trug das silberne Kreuz nicht mehr feierlich; dasselbe schwankte in seinen Händen bald nach rechts und links, bald neigte es sich vornüber, sodass man fürchten musste, es fiele hin. Der Pfarrer eilte jetzt ohne Gebet hinter dem Knaben drein; die Chorsänger verschwanden in einer Seitengasse, um sich schneller ausziehen zu können, und auch die Fischer stürmten gruppenweise davon. Sie empfanden schon im Voraus etwas wie einen guten Küchenduft, der ihnen von der Nase bis zum Magen drang, sodass ihnen das Wasser im Munde zusammenlief und ein leichtes kollerndes Geräusch in ihrem Innern ertönte.
In Peuples erwartete sie nämlich ein gutes Frühstück.
Auf dem Hofe unter den Obstbäumen war eine große Tafel gedeckt, an der sechzig Personen, Fischer und Landleute, Platz nahmen. Die Baronin, welche in der Mitte sass, hatte die beiden Pfarrer von Yport und Etouvent rechts und links neben sich. Der Baron sass ihr gegenüber zwischen dem Maire und dessen Gattin. Es war dies eine magere, bereits etwas bejahrte Frau von ländlichen Sitten, die nach allen Seiten lebhaft grüsste. Ihr schmales runzeliges Gesicht war ganz in ihrer großen normännischen Mütze versteckt; ein richtiges Hühnergesicht mit einem weißen Kamm darüber, unter dem ein rundes Auge stets verwundert und neugierig in die Welt schaute. Sie ass mit kleinen hastigen Schlucken, als hätte sie mit ihrer Nase auf dem Teller gepickt.
Johanna schwelgte an der Seite des Vicomte im vollen Glücke. Sie sah und hörte nichts; schweigend gab sie sich ihren seligen Gedanken hin.
»Wie ist doch Ihr Vorname?« fragte sie endlich den Vicomte.
»Julius«, sagte er, »das wussten Sie nicht?«
Aber sie gab keine Antwort. »Wie oft werde ich mir diesen Namen im Stillen wiederholen« war das einzige, was sie dachte.
Als das Mahl beendet war, überliess man den Hof den Fischern und Landleuten; die Übrigen begaben sich an die andere Seite des Schlosses. Die Baronin schickte sich, auf den Gatten gestützt und von den beiden Geistlichen begleitet, zu »ihrer Übung« an, während Johanna und Julius zu dem Bosquet gingen. Kaum hatten sie die verschlungenen Pfade desselben betreten, als der Vicomte ihre Hand ergriff und zu ihr sagte:
»Johanna, wollen Sie meine Gattin werden?« Anfangs senkte sie das Köpfchen; als aber der Vicomte sie nochmals fragte: »Antworten Sie mir, ich bitte Sie«, da hob sie sanft die Augen zu ihm auf und er konnte die Antwort in ihrem Blicke lesen.
*