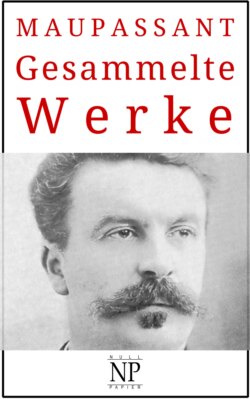Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 87
Marroca
ОглавлениеDu batest mich, lieber Freund, Dir die Eindrücke zu schildern, die ich hier in Afrika empfangen, die Abenteuer, und vor allem die Liebesgeschichten, die ich in diesem Lande erlebt, nach welchem es mich schon seit so vielen Jahren zog. Du würdest, schreibst Du, schon im Voraus herzlich über meine »schwarzen Liebschaften« lachen und sähest mich im Geiste schon in Begleitung eines großen ebenholzfarbigen Weibsbildes zurückkehren, das, den Kopf mit einem gelben Seidentuche umwunden, in den grellsten Kleidungsstücken einherwatschelt.
Die Reihe wird auch, das ist gewiss, noch an die schwarzen Weiber kommen; denn ich sah bereits mehrere, die mir einige Lust eingeflösst haben, auch mal in dieser Tinte unterzutauchen. Indessen habe ich zunächst etwas Besseres und ganz Originelles gefunden.
In Deinem letzten Briefe schreibst Du mir:
»Wenn ich erst mal weiß, wie man in einem Lande liebt, so kenne ich es genügend, um es beschreiben zu können, auch wenn ich es niemals gesehen habe.«
Nun so wisse denn, dass man hier mit einer wahren Raserei zu lieben pflegt. Man verspürt hier vom ersten Tage an eine Art Siedehitze, eine Aufwallung, eine ungestüme Anspannung der Begierden, einen bis in die Fingerspitzen gehenden Kitzel, wodurch unsere Liebesbrunst bis zur Erschlaffung entfacht und unsere ganze Sinnenlust, von der einfachen Berührung der Hände bis zu jenem unnennbaren Bedürfnis, um dessen willen wir so viele Dummheiten begehen, aufs Höchste gereizt wird.
Versteh’ mich, bitte, recht. Ich weiß nicht, ob das, was Du wahre Herzensliebe, die Liebe zweier Seelen, nennst, ob dieser Idealismus des Gemütes, mit einem Worte die platonische Liebe, unter diesem Himmelsstriche gedeihen könne. Aber jene andere Liebe, die der Sinne, die auch ihr Gutes, und zwar sehr viel Gutes hat, ist in diesem Klima geradezu schrecklich. Die Hitze, diese ewig kochende, fieberschwangere Luft, diese erstickenden südlichen Winde, diese Feuerflut, welche aus der nahegelegenen Wüste kommt und sengender, verzehrender wirkt wie eine wirkliche Flamme; dieser ewige Brand eines Landstriches, den eine riesige lechzende Sonnenglut bis auf die Steine ausdörrt, lassen unser Blut kochen, betäuben das Gehirn und machen uns zum reissenden Tiere.
Doch nun zu meiner Geschichte!
Ich übergehe die erste Zeit meines Aufenthaltes in Algier. Nachdem ich Bona, Constantine, Biskra und Setif besucht hatte, kam ich durch die Schluchten von Chabet nach Bougie. Wir hatten einen unvergleichlich schönen Weg mitten durch die Wälder der Kabylen zurückgelegt; derselbe zieht sich in einer Höhe von zweihundert Metern dem Meere entlang und folgt den Windungen des Hochgebirges bis zum herrlichen Golf von Bougie, der ebenso schön wie der von Neapel, Ajaccio und Douarnenez ist. Allerdings nehme ich hierbei die unvergleichliche Bucht von Porto an der Westküste Corsikas aus, mit ihrer Einfassung aus rotem Granit, innerhalb deren man die blutroten Steinriesen, im Volksmunde die »Calanches« von Piana genannt, erblickt.
Von weitem, ganz von weitem, bevor man um die große Bucht kommt, in der die stillen Wasser schlummern, erblickt man Bougie. Es ist an den steilen Hängen eines hohen, von Wäldern gekrönten Berges erbaut; ein weißer Pieck auf diesem grünen Hange, wie ein schäumender Wasserfall, der sich ins Meer ergiesst.
Sobald ich den Fuss in dieses bezaubernde Städtchen gesetzt hatte, wurde es mir zur Gewissheit, dass ich hier lange verweilen würde. Überall ringsum haftet das Auge auf eine Reihe zackiger wildromantischer Hügel mit bizarren Spitzen, die so dicht zusammenhängen, dass man kaum das offene Meer erblicken kann und den Golf für einen See halten möchte. Das blaue, milchfarbene Wasser ist von wunderbarer Durchsichtigkeit; und der azurne Himmel, so azurblau, als habe er einen doppelten Farbenanstrich erhalten, lacht über dem Ganzen in seiner ergreifenden Pracht.
Bougie ist die Stadt der Ruinen. Wenn man ankommt, so erblickt man am Quai einen so großartigen Trümmerhaufen, dass man sich in eine Märchenwelt versetzt glaubt; das epheuumrankte alte Sarazenen-Tor. Und in dem waldigen Gebirge rings um die Stadt herum findet man überall Ruinen, Reste römischer Mauern, Denkmäler aus der Sarazenen-Zeit, Überbleibsel arabischer Baukunst.
Ich hatte in der oberen Stadt ein maurisches Häuschen gemietet. Du kennst ja diese Wohnungen der Beschreibung nach. Sie haben nach Aussen hin keine Fenster, sondern empfangen von oben bis unten ihr Licht von dem inneren Hofe her. Im ersten Stock befindet sich ein großer Saal, in dem man sich tagsüber aufhält, und ganz oben eine Terrasse, wo man die Nächte zubringt.
Ich folgte sofort der Gewohnheit jener heissen Länder, d. h. ich hielt stets nach dem Frühstück meine Siesta. Es sind dies die drückendsten Stunden des Tages, wo man vor Hitze kaum noch atmet, wo die Gassen, die Plätze, die blendenden Strassen verödet sind, wo alle Welt schläft oder wenigstens in möglichst unbekleidetem Zustande zu schlafen versucht.
In meinem mit Säulen von arabischer Bauart geschmückten Saale hatte ich einen großen behaglichen, mit Teppichen von Djebel-Amur bedeckten Divan aufstellen lassen. So ziemlich in Adams Kostüm streckte ich mich auf demselben aus; aber einsam wie ich war, konnte ich keine Ruhe finden.
Zwei Qualen auf dieser Welt gibt es, liebster Freund, die ich nicht gerne kennen lernen möchte; nämlich der Durst nach Wasser und die unbefriedigte Sehnsucht nach einem weiblichen Wesen. Welche von beiden ist wohl die schlimmere? Ich weiß es selbst nicht. In der Wüste würde man manchesmal die schrecklichsten Dinge begehen, um nur ein Glas frischen klaren Wassers zu erlangen. Was gäbe man in gewissen Küstenstädten nicht für ein hübsches frisches und gesundes Mädchen? Es fehlt ja in Afrika nicht an Mädchen, es ist sogar Überfluss daran; aber, um bei meinem Vergleich stehen zu bleiben, sie gleichen in ihrer Art dem übelriechenden faulen und schlammigen Wasser, das man in den Brunnen der Sahara findet.
So versuchte ich nun eines schönen Tages wieder, als ich abgespannter wie gewöhnlich war, vergeblich die Augen zu schliessen. Meine Glieder zitterten, als brennten Nesseln darin; in ängstlicher Unruhe warf ich mich auf meinem Divan hin und her, und schliesslich hielt ich es nicht mehr aus. Ich sprang auf und begab mich ins Freie.
Es war ein schrecklich heisser Juli-Nachmittag. Das Strassenpflaster strahlte eine Hitze wie ein Backofen aus, das Hemd war im Augenblick feucht und klebte einem am Leibe, und am ganzen Horizont schwebte ein leichter weißlicher Dunst, der verzehrende Hauch des Sirokko, dessen Hitze man greifen zu können glaubt.
Ich ging in der Richtung auf das Meer zu hinunter und folgte, beim Hafen angelangt, dem Hange, welcher sich längs der lieblichen Bucht hinzieht, in der die Bäder liegen. Das steile, mit Gebüsch und stark duftenden Pflanzen bewachsene Gebirge umragt von allen Seiten diese Bucht, längs deren ganzem Ufer sich mächtige Felsblöcke in der stillen Flut baden.
Hier draussen sah man kein menschliches Wesen; nichts rührte sich, kein Tier gab einen Laut, kein Vogel strich durch die Lüfte. Jedes Geräusch war verstummt; selbst das Meer schien unter den brennenden Strahlen der Sonne erstarrt zu sein, sodass man nicht einmal das Plätschern des Wassers vernahm. Dagegen glaubte ich in der kochenden Luft ein Knistern wie von Feuer zu hören.
Plötzlich schien es mir, als wenn ich hinter einem der Felsen, die zur Hälfte in der schweigenden Wasserfläche untergetaucht waren, eine leichte Bewegung bemerkte. Ich wandte mich um und erblickte ein hochgewachsenes Mädchen, welches hier, wo es sich in diesen Stunden der Hitze völlig ungestört glauben mochte, ohne jede Bekleidung sein Bad nahm. Bis zur Brust im Wasser stehend, wandte sie ihren Blick dem Meere zu und plätscherte leicht mit den Händen, ohne mich zu bemerken.
Was konnte es Bezaubernderes geben, als dieses Bild: das schöne Weib in dem Wasser, so durchsichtig, wie ein Glas unter der Pracht dieses südlichen Himmels! Und sie war schön, wunderbar schön sogar, dieses hochgewachsene Weib mit dem Körper einer Marmorstatue.
In diesem Augenblick wandte sie sich um; sie stiess einen Schrei aus und verbarg sich, halb schwimmend, halb gehend, sofort hinter ihrem Felsen.
Da sie doch wieder ’mal zum Vorschein kommen musste, so setzte ich mich am Hange hin und wartete geduldig. Da kroch sie ganz sachte wieder hervor und zeigte ihren mit schwarzen wirren Haaren dichtbewachsenen Kopf. Sie hatte einen breiten Mund, aufgeworfene lüsterne Lippen, große begehrliche Augen, und ihre ganze durch das Klima leicht gebräunte Haut hatte das Aussehen von altem Elfenbein, hart und weich zugleich, mit einem Worte ein herrlicher Typus der weißen Rasse, dem aber die Sonne Afrikas ihr eigenartiges Kolorit verliehen hatte.
»Gehen Sie fort!« rief sie mir zu. Ihre volle Stimme, die, wie ihre ganze Erscheinung, etwas Kräftiges an sich hatte, kam tief aus der Kehle.
»Es ist nicht hübsch von Ihnen, dass Sie dableiben, mein Herr!« Dabei rollte sie die »r« in ihrem Munde wie Kieselsteine herum. Ich rührte mich indessen nicht, und der Kopf verschwand wieder.
Zehn weitere Minuten vergingen. Dann kamen die Haare, hierauf die Stirn und die Augen wieder zum Vorschein, langsam und vorsichtig, wie es Kinder beim Versteckenspiel zu machen pflegen, wenn sie sich nach dem umsehen wollen, der die andren suchen muss.
Dieses Mal machte sie ein zorniges Gesicht und rief laut:
»Ich werde mir Ihretwegen noch eine Krankheit zuziehen; ich kann nicht fort, solange Sie da sind.«
Nun stand ich auf und ging fort, nicht ohne mich öfters umzuwenden. Als sie mich weit genug entfernt glaubte, stieg sie in halbgebückter Stellung aus dem Wasser heraus, wobei sie mir den Rücken zudrehte. Dann verschwand sie in einer Felsspalte hinter einem vor dem Eingang aufgehängten Rock.
Am nächsten Tage ging ich wieder hin. Sie war noch im Bade, aber diesmal in vollständigem Kostüm, und zeigte mir laut lachend ihre perlenweißen Zähne.
Nach acht Tagen hatten wir uns angefreundet, und nach weiteren acht Tagen waren wir schon ganz intim.
Sie hiess Marroca, zweifelsohne ein Spitzname, den sie aussprach, wie wenn er ein Dutzend »r« enthielte. Die Tochter spanischer Ansiedler, hatte sie einen Franzosen namens Pontabeze geheiratet. Ihr Mann hatte irgend einen Staatsposten, aber ich habe nie recht erfahren können, welcher Art eigentlich seine Beschäftigung war. Ich erfuhr nur, dass er immer sehr viel zu tun hatte, und das Übrige konnte mir ja auch gleichgültig sein.
Von nun an verlegte sie ihre Badezeit und hielt jeden Tag nach dem Gabelfrühstück mit mir in meinem Hause die Siesta. Welch eine Siesta! Das soll man Erholung nennen!
Ich habe wirklich selten ein so herrliches Weib gesehen; ihr Typus erinnerte etwas an ein Raubtier, aber sie war zu entzückend. Ihre Augen schienen immer vor Leidenschaft zu strahlen; ihr halboffener Mund, ihre scharfen Zähne, ja selbst ihr Lachen deutete auf eine sinnliche Wildheit hin. Ihre wundervolle straffe und hochgewölbte Büste, gleich fleischigen Äpfeln, war so schmiegsam wie eine Sprungfeder und vermehrte bei ihrem Körper den Eindruck des Tierischen, machte sie gewissermassen zu einem untergeordneten und doch erhabenen Geschöpfe, dessen Anblick in mir die Vorstellung von jenen Liebesgöttinnen des Altertums erweckte, deren Mysterien man sich ungezwungen in Hainen und Wäldern hingab.
Niemals schlug ein Herz mit unbezähmbarerem Verlangen als das im Busen dieser Frau. Ihrem flammenden Feuer, das sich in wilden Seufzern, im Knirschen der Zähne, in Zuckungen und in Beissen kundgab, folgte fast ebenso rasch eine tiefe totesähnliche Ohnmacht. Aber dann wachte sie plötzlich wieder in meinen Armen auf, zu neuen Liebkosungen und Genüssen bereit, indem sie mich mit ihren Küssen fast erstickte.
Ihr Verstand war nicht gerade sehr hervorragend, und ließ jede höhere Bildung vermissen; ein helles Lachen vertrat meistens bei ihr die Stelle der Gedanken. In dem instinktiven Bewusstsein ihrer Schönheit verabscheute sie selbst die leichteste Hülle, und in meinem Hause ging, lief und hüpfte sie mit einer ebenso harmlosen wie zuversichtlichen Ungeniertheit herum. Wenn sie schliesslich der Zärtlichkeit genug getan hatte, schlief sie, erschöpft von Seufzern und Liebesanstrengungen, neben mir auf dem Divan einen kräftigen gesunden Schlaf, während die drückende Hitze auf ihrer braunen Haut kleine Schweißperlchen hervorzauberte. Von ihren unter dem Kopf gekreuzten Armen, von ihren Schultern, aus all’ den verborgenen Falten ihres Körpers strömte jener unnennbare Duft aus, der uns Männer so sehr berauscht.
Zuweilen kam sie abends nochmals wieder, wenn ihr Mann irgendwo dienstlich abgehalten war. Wir machten es uns dann, nur notdürftig mit den feinen faltigen Geweben des Orients bekleidet, auf der Terrasse bequem.
Wenn der volle leuchtende Mond der Tropenländer am hohen Himmel stand und Stadt und Golf mit der sie einschliessenden Gebirgskette verklärte, dann sahen wir auf all’ den anderen Terrassen ein Heer von stummen Geistergestalten liegen, wieder aufstehen, ihre Plätze wechseln und sich bei der erschlaffenden Schwüle der windstillen Nacht wieder niederlegen.
Trotz der Helligkeit dieser südlichen Nächte bestand Marroca stets darauf, sich ohne jede Kleidung und noch dazu im vollsten Mondlicht niederzulegen. Ihr war es gleichgültig, ob andere uns vielleicht sehen könnten; und zuweilen schallten trotz meiner ängstlichen Bitten ihre lauten Schreie durch die Nacht, worauf dann in der Ferne die Hunde heulend Antwort gaben.
Als ich eines Abends unter dem hohen sternbesäeten Himmelszelt schon entschlummert war, kniete sie vor mir auf dem Teppich nieder, und indem sie ihre großen vollen Lippen meinem Munde näherte, sagte sie:
»Du musst einmal bei mir zu Hause schlafen.«
»Wie? Bei Dir?« fragte ich verständnislos.
»Ja, wenn mein Mann fortgegangen ist, sollst Du seinen Platz einnehmen.«
Ich konnte ein lautes Lachen nicht unterdrücken.
»Aber warum das nur, wo Du ja immer hierher kommst?«
Sie sprach mir ihre Antwort fast in den Mund hinein, sodass ihr warmer Odem mir in die Kehle drang und sein Hauch meinen Schnurrbart befeuchtete:
»Ich muss eine Erinnerung an Dich haben.« Und das »r« in dem Wort Erinnerung rollte über ihre Lippen wie ein Giessbach, der über Felsen stürzt.
Ich verstand immer noch nicht, was sie eigentlich wollte.
»Wenn Du nicht mehr da sein wirst«, sagte sie, ihre Arme um meinen Nacken schlingend, »werde ich immer daran denken; und wenn ich meinen Mann küsse, werde ich glauben, Du wärst es.«
Und die »arrr« und »errr« klangen bei ihrer Art zu sprechen jetzt fast wie entfernter Donner.
»Du bist nicht bei Sinnen«, sagte ich halb gerührt, halb belustigt. »Ich ziehe es doch vor, in meinem Hause zu bleiben.«
Ich muss nämlich gestehen, dass ich an diesen Rendezvous unter dem Dache des Gatten gar keinen Geschmack finde; es sind dies die Mäusefallen, in denen man die Dummen fängt. Sie aber ließ mit Bitten und Flehen nicht nach und weinte sogar schliesslich.
»Du wirst sehen, wie zärtlich ich mit Dir sein werde«, fügte sie hinzu.
Das »zärrrtlich« klang wie der Wirbel eines Tambours, der zum Sturme schlägt.
Ihr Wunsch kam mir so merkwürdig vor, dass ich mir ihn gar nicht erklären konnte; bei längerem Nachdenken glaubte ich jedoch, es sei irgend ein tiefer Hass gegen ihren Mann darunter verborgen, die stille Rachsucht vielleicht einer Frau, die mit Wonne den ihr widerwärtigen Gatten betrügt, und diesen Betrug noch vergrössern möchte, indem sie denselben in seinem Hause, auf seinen Möbeln, in seinen Kissen vollzieht.
»Ist Dein Mann sehr schlecht gegen Dich?« fragte ich sie.
»O nein«, entgegnete sie mit erstaunter Miene, »sogar sehr gut.«
»Aber Du liebst ihn wohl Deinerseits nicht?«
Sie sah mich mit ihren großen fragenden Augen an:
»Doch, ich liebe ihn sehr, im Gegenteil, sogar ganz ausserordentlich; aber nicht so sehr, wie ich Dich liebe, mein Herrrz!«
Ich verstand von alledem nichts, und während ich noch über des Rätsels Lösung nachdachte, erdrückte sie meinen Mund mit einer jener Schmeicheleien, deren Einfluss auf mich sie hinreichend kannte.
»Sag’, wirst Du kommen?« fragte sie leise.
Ich konnte mich aber nicht entschliessen. Da kleidete sie sich schleunigst an und ging fort.
Acht Tage verstrichen, ohne dass ich sie zu sehen bekam. Am neunten erschien sie wieder, blieb mit ernster Miene auf der Schwelle stehen und fragte:
»Willst Du diese Nacht bei mirr in meinen Arrrmen rruhen? Kommst Du nicht, so war ich zum letzten Male hier.«
Acht Tage, lieber Freund, ist eine lange Zeit, und in Afrika kommen sie einem wie ein Monat vor.
»Ja!« rief ich, die Arme öffnend, in die sie sich mit einem Freudenschrei stürzte.
Als die Nacht hereingebrochen war, wartete sie in einer benachbarten Strasse auf mich und geleitete mich zu ihrem Heim.
Sie bewohnten in der Nähe des Hafens ein kleines niedriges Haus. Wir durchschritten zuerst eine Küche, die zugleich als Speisezimmer diente, und gelangten dann in ein weißgetünchtes sauberes Gemach mit Fotografien der Verwandten an den Wänden und Papierblumen unter Glasglocken. Marroca schien vor Freude närrisch geworden zu sein.
»Jetzt bist Du hier, jetzt bist Du zu Hause!« rief sie, im Zimmer umhertanzend, ein über das andere Mal aus.
Und ich tat wirklich, als ob ich zu Hause wäre. Anfangs war ich etwas verlegen, das muss ich gestehen, ja sogar etwas ängstlich. Als ich zögerte, in dieser fremden Wohnung mich eines gewissen Kleidungsstückes zu entledigen, ohne dass ein Mann, wenn er überrascht wird, ebenso linkisch wie lächerlich erscheint und zu jeder Handlungsweise unfähig wird, entriss sie es mir mit Gewalt und trug es mit meinen anderen Sachen in das benachbarte Gemach.
Endlich fand ich meine Sicherheit wieder und suchte ihr dies nach Kräften und so gut zu beweisen, dass wir nach Verlauf von zwei Stunden noch nicht an Ruhe dachten, als plötzlich laute Schläge gegen die Türe uns erzittern Hessen.
»Ich bin’s, Marroca!« rief eine starke männliche Stimme.
»Mein Mann! Schnell, verbirg Dich unterm Bett!« flüsterte sie, in die Höhe fahrend. Ganz verwirrt suchte ich nach meinen Beinkleidern, aber sie drängte mich: »Geh doch, geh doch!«
Ich streckte mich der Länge nach auf dem Bauche aus und lag nun lautlos unter diesem Bette, auf welchem es mir so wohl gewesen war.
Sie schlüpfte in die Küche. Ich hörte, wie sie einen Schrank öffnete, ihn wieder schloss und irgendetwas herbeibrachte, das ich nicht sehen konnte, das sie aber schnell irgend wohin legte; dann, als ihr Mann ungeduldig wurde, antwortete sie mit fester ruhiger Stimme: »Ich finde die Streichhölzerrr nicht.«
»Ah, jetzt habe ich sie«, rief sie dann plötzlich, »ich öffne schon.« Und sie ging hinaus.
Ihr Mann kam herein. Ich sah nur seine Füsse, zwei enorme Füsse. Wenn das Übrige dazu im Verhältnis stand, so müsste es ein wahrer Hüne sein.
Ich hörte Küsse, dann einen Patsch auf die blosse Haut und Lachen.
»Ich habe meine Börse vergessen«, sagte er mit Marseiller Akzent, »deshalb musste ich umkehren. Hoffentlich kannst Du nachher ruhig schlafen.«
Er begab sich an die Kommode und suchte lange, was ihm fehlte, während Marroca sich auf ihr Bett warf, als käme sie vor Müdigkeit um. Hierauf ging er wieder zu ihr hin und versuchte zweifellos seine Zärtlichkeit an ihr, denn sie überhäufte ihn in wirren Redensarten mit einer Flut von rollenden »r«.
Ihre Füsse waren mir so nahe, dass mich ein törichtes, sinnloses und unerklärliches Verlangen ergriff, sie leise zu streicheln. Glücklicherweise konnte ich mich noch beherrschen.
Er schien seinen Zweck übrigens nicht zu erreichen, denn er wurde ärgerlich und sagte:
»Du bist sehr unliebenswürdig heute.« Aber schliesslich musste er gehen. »Adieu Kleine.«
Ein neuer Kuss, die großen Füsse wandten sich fort und verschwanden in der Küche. Die Haustüre schloss sich wieder.
Ich war erlöst!
Langsam, beschämt und niedergeschlagen verliess ich mein Versteck; und während Marroca, immer noch ganz unbekleidet, laut lachend und mit den Händen klatschend um mich herumtanzte, ließ ich mich schwerfällig auf einen Stuhl fallen. Aber mit einem Satze sprang ich wieder in die Höhe; etwas Kaltes lag unter mir, und da ich nicht mehr an hatte, als meine Gefährtin, so war mir diese Berührung sehr empfindlich gewesen.
Als ich mich umwandte, sah ich, dass ich mich auf ein kleines Beil gesetzt hatte, scharf wie eine Messerklinge, wie man es zum Holzspalten gebraucht. Wie war es dahin gekommen? Beim Eintreten hatte ich es noch nicht bemerkt.
Marroca sah meinen erstaunten Blick und lachte überlaut, sie schrie vor Vergnügen, während sie sich vor Lachen die Seiten hielt.
Ich fand dieses Lachen sehr wenig am Platze; es ärgerte mich ordentlich. Wir hatten doch einfach um unser Leben gespielt; es überlief mich noch kalt, wenn ich daran dachte. Und nun dieses fast beleidigende Lachen!
»Wenn Dein Mann mich nun aber entdeckt hätte?« fragte ich.
»Keine Not«, antwortete sie kurz.
»Was, keine Not?« Sie ist närrisch geworden, dachte ich. »Er brauchte sich doch nur zu bücken, um mich zu bemerken!«
Sie lachte nicht mehr; sie lächelte nur noch, indem sie mich mit ihren großen starren Augen ansah, in denen neue Begehrlichkeit aufflammte.
»Er hätte sich nicht gebückt.«
»Aber erlaube ’mal«, fuhr ich fort, »er brauchte z. B. nur seinen Hut fallen zu lassen. Er hätte ihn doch sicher aufgehoben, und dann … mir wäre es nett gegangen in diesem Kostüm da.«
Sie legte ihre runden kräftigen Arme auf meine Schultern, und ihre Stimme mässigend, als wollte sie sagen, »ich bete Dich an«, murmelte sie leise:
»Errr hätte sich nicht wiederr aufgerrrichtet.«
»Wieso denn?« fragte ich verständnislos.
Sie zwinkerte boshaft mit einem Auge und streckte ihre Hand nach dem Stuhle aus, auf dem ich sass. Ihre gekrümmten Finger, die Falten auf ihren Wangen, die spitzen glänzenden Raubtierzähne, das alles zeigte mir schon, wozu das kleine Holzbeil dienen sollte, dessen scharfe Schneide im Lichte glänzte.
Sie tat, als ob sie es ergriffe, zog mich mit der linken Hand ganz nahe an sich heran, presste ihre Hüfte an die meinige und führte mit der rechten eine Bewegung aus, wie wenn man einem knienden Menschen den Kopf spaltet …
*
Nun weißt Du, lieber Freund, was man hierzulande unter ehelicher Treue, Liebe und Gastfreundschaft versteht.
*