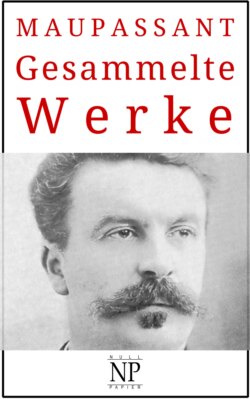Читать книгу Guy de Maupassant – Gesammelte Werke - Guy de Maupassant - Страница 69
IV.
ОглавлениеEines Morgens, noch ehe Johanna aufgestanden war, trat der Baron in ihr Zimmer und setzte sich zu Füssen des Bettes.
»Der Vicomte de Lamare hat um Deine Hand bei uns angehalten«, sagte er feierlich.
Sie hätte am liebsten das Gesicht unter der Decke versteckt.
»Wir haben unsere Antwort noch etwas verschoben.«
Johanna atmete kaum noch vor innerer Erregung.
»Wir wollten nämlich keine Entscheidung ohne Dich treffen«, fuhr der Baron nach einer kurzen Pause lächelnd fort. »Deine Mutter und ich haben gegen diese Heirat nichts einzuwenden, ohne Dich indes zwingen zu wollen. Du bist viel reicher wie er; aber wenn es sich um das Glück des Lebens handelt, muss man nicht nach dem Gelde schauen. Er hat keine Eltern mehr; wenn Du ihn heiraten solltest, so würde er als Sohn in unsere Familie eintreten. Bei einem anderen wäre es umgekehrt; da würdest Du, unser Kind, zu fremden Leuten gehen. Der junge Mann gefällt uns. Ich weiß nicht, ob er Dir gefällt …?«
»Ach ja, Papa!« stammelte sie, über und über rot.
»Ich war mir noch nicht ganz klar darüber« sagte ihr Vater, nachdem er ihr eine Weile, immer lächelnd, tief in die Augen gesehen hatte.
Sie lebte bis zum Abend in einem Taumel, ohne zu wissen, was sie tat. Mechanisch nahm sie bald diesen, bald jenen Gegenstand zur Hand; in all ihren Gliedern fühlte sie eine weiche Erschlaffung, ohne dass sie einen grösseren Spaziergang gemacht hätte.
Gegen sechs Uhr, als sie mit der Mutter unter der großen Platane sass, erschien der Vicomte.
Johannas Herz klopfte zum Zerspringen. Der junge Mann näherte sich ihnen, ohne besonders erregt zu scheinen. Als er vor ihnen stand, ergriff er die Hand der Baronin und führte sie an die Lippen. Dann nahm er die Johannas und drückte einen langen Kuss voll Zärtlichkeit und Dankbarkeit darauf …
Und nun begann die wunderbare Zeit des Brautstandes. Sie plauderten zusammen in irgend einer Ecke des Salons oder auf der Rasenbank hinten im Bosquet, vor sich die weite Heide.
Zuweilen spazierten sie mit der Mama in »ihrer Allee« und sprachen von der Zukunft, wobei Johanna nachdenklich den Blick auf die staubigen Fussspuren der Mutter heftete.
Nachdem die Sache nun einmal entschieden war, wollte man auch den Ausgang beschleunigen. So kam man überein, dass in sechs Wochen, am 15. August, die Vermählung stattfinden sollte und gleich darauf das junge Paar seine Hochzeitsreise antreten würde. Johanna, um ihre Ansicht gefragt, entschied sich dafür, dass man Korsika besuchen wolle. Dort würde man ungestörter sein, als in den vielbesuchten und belebten Städten Italiens.
Sie erwarteten den festgesetzten Tag ihrer Verbindung ohne allzu große Ungeduld, aber beseelt und getragen von einer innigen Zärtlichkeit. Sie durchkosteten alle die zahllosen kleinen Freuden des Brautstandes, die Händedrücke, die liebevollen langen Blicke, bei denen die Seelen sich in einander zu verschmelzen scheinen. Nur hin und wieder hegten beide das heftige Verlangen nach Beendigung dieser Zeit, um sich dann ganz angehören zu können.
Es wurde beschlossen, Niemanden zur Hochzeit einzuladen ausser der Tante Lison, der Schwester der Baronin, die als eine Art Pensionärin in einem Kloster bei Versailles lebte.
Nach dem Tode ihres Vaters hatte die Baronin ihre Schwester zu sich nehmen wollen; aber das ältliche Fräulein hatte die fixe Idee, dass es aller Welt zur Last sei, dass es zu Nichts zu gebrauchen und nirgend gern gesehen wäre. So zog es sich in eines jener Ordenshäuser zurück, die einsam und allein stehenden Personen Zimmer vermieten.
Von Zeit zu Zeit brachte sie ein oder zwei Monate in der Familie zu.
Sie war klein von Statur, sprach sehr wenig, zog sich sehr zurück und erschien eigentlich nur bei den Mahlzeiten, nach denen sie sofort wieder verschwand, um sich die übrige Zeit auf ihrem Zimmer einzuschliessen.
Ihr Gesichtsausdruck deutete auf Herzensgüte. Trotz ihrer zweiundvierzig Jahre machte sie aber einen viel älteren Eindruck. Ihr Blick war sanft und traurig; sie war von jeher in der Familie als eine Null betrachtet worden.
Als Kind war sie weder hübsch noch anziehend; niemand gab ihr einen Kuss. Ruhig und bescheiden hockte sie in ihrem Winkel. Seitdem war sie unbeachtet geblieben, selbst als junges Mädchen.
Sie war so eine Art Familien-Anhängsel, ein lebendes Möbel, welches man jedes Jahr zu sehen gewohnt war, um das sich aber im Übrigen niemand groß kümmerte.
Ihre Schwester betrachtete sie gleich allen im Elternhause, wie ein etwas schwachsinniges, durchaus unbedeutendes Wesen. Man behandelte sie mit ungezwungener Vertraulichkeit, in der aber manchesmal etwas herablassende Güte lag. Sie hiess Liese, aber dieser schmucke jugendliche Name schien ihr selbst mitunter unbequem zu sein. Als man sah, dass sie keinen Mann fand und auch wohl sicher war, dass sie niemals einen finden würde, taufte man sie in Lison um. Seit Johannas Geburt war sie zur »Tante Lison« avanciert. Aber sie blieb die unbedeutende überall zurückgesetzte Verwandte, die sich vor Allen fürchtete, selbst vor ihrer Schwester und ihrem Schwager, obgleich diese ihr zugetan waren. Es fehlte dieser Zuneigung indessen der warme herzliche Ausdruck; sie hatte vielmehr etwas von Mitleid und natürlichem Wohlwollen an sich.
Wenn die Baronin zuweilen von fernliegenderen Ereignissen aus ihrer Jugendzeit sprach, bemerkte sie zur Bezeichnung eines Datums: »Das war, als Lison ihren Einfall hatte.« Man sprach nie mehr darüber; und so blieb dieser »Einfall« stets in ein gewisses Dunkel gehüllt.
Eines Abends nämlich hatte Lise, als sie ungefähr zwanzig Jahr alt war, sich ins Wasser gestürzt, ohne dass man den Grund dafür erraten konnte. Nichts in ihrer Lebensweise, in ihrem ganzen Gebaren ließ dieses Ereignis vorhersehen. Halbtot hatte man sie aus dem Wasser gezogen, und die Eltern hoben erstaunt und entrüstet die Arme in die Höhe. Aber statt nach der geheimnisvollen Ursache dieses Schrittes zu forschen, beschränkten sie sich darauf, von Lises »Einfall« zu sprechen, wie sie von dem Unfall des Pferdes »Coco« sprachen, das kurz vorher in einem Wagegeleise das Bein gebrochen hatte und infolgedessen getötet werden musste.
Seitdem galt Lise und später Lison als schwachsinnig. Die milde Herablassung, mit der ihre Verwandten sie behandelten, übertrug sich langsam auch auf ihre sonstige Umgebung. Selbst die kleine Johanna hatte in ihrer Jugend mit dem natürlichen Instinkt der Kinder bald heraus, dass es sich nicht lohne, ihr viel Aufmerksamkeit zu schenken. Niemals kam sie auf ihr Zimmer, niemals schmiegte sie sich zärtlich an sie, oder stieg sie auf ihr Bett, um sie zu küssen. Nur die Kammerzofe Rosalie, welche ihr Zimmer besorgte, schien zu wissen, wo ihr Bett stand.
Wenn Tante Lison zum Frühstück im Speisezimmer erschien, so ging die Kleine gewohnheitsmässig hin, um ihr die Stirn zum Kusse zu bieten; aber das war auch so ziemlich alles.
Wenn man sie sprechen wollte, so schickte man einen Dienstboten um sie. Im Übrigen beschäftigte man sich in ihrer Abwesenheit nicht viel mit ihr. Niemals wurde an sie gedacht und niemals würde man gehört haben, dass jemand etwa mit Besorgnis gefragt hätte: Wo nur Lison diesen Morgen bleibt?
Sie füllte eben keinen Platz im Leben aus; sie war eines jener Wesen, die selbst ihren Anverwandten fremd bleiben, weil sich niemand die Mühe gibt, sie zu erforschen. Ihr Tod hätte keine Lücke im Familienkreise zurückgelassen; sie verstand es weder sich in das Leben, noch in die Gewohnheit, noch selbst in die Zuneigung jener einzuführen, welche mit ihr zusammen lebten.
Wenn von »Tante Lison« die Rede war, so berührten diese Worte sozusagen keine wärmere Stelle in Jemandes Herzen. Es war gerade so, als wenn vom »Cafétier« oder vom »Zuckerbäcker« die Rede gewesen wäre.
Sie ging stets mit kurzen leisen Schritten, ohne Geräusch zu machen, stiess nirgends an oder schien doch wenigstens die Eigenschaft zu haben, keinem Gegenstand einen Ton zu entlocken. Ihre Hände mussten wie von Watte sein; so zart und leicht behandelte sie alles, was sie anfasste.
Gegen Mitte Juli traf sie dieses Mal in Peuples ein, ganz überrascht durch den Gedanken an diese Heirat, und mit Geschenken beladen, die, weil von ihr herrührend, fast unbeachtet blieben. Seit dem Montage, wo sie angekommen war, wusste man kaum, dass sie da sei.
Aber in ihrem eigenen Innern vollzog sich eine aussergewöhnliche Bewegung, und sie wandte ihre Augen kaum von dem Brautpaare. Mit ganz eigentümlicher, fast fieberhafter Energie widmete sie sich dem Trousseau Johannas und arbeitete wie eine einfache Nähmamsell den ganzen Tag daran auf ihrem Zimmer, wohin niemand kam, sich nach ihr umzusehen.
Jeden Augenblick brachte sie der Baronin selbstgesäumte Taschentücher, Servietten, in denen sie die Monogramme eingestickt hatte und fragte: »Ist das gut so, Adelaïde?« Und indem die Baronin alles mit gleichgültiger Miene musterte, antwortete sie: »Gib Dir doch nicht so viel Mühe, Lison!«
Einstmals gegen Ende des Monats stieg nach einem sehr heissen Tage der Mond in einer jener klaren lauen Sommernächte auf, welche unwillkürlich zum Herzen gehen und zärtliche Regungen, wundersame Gefühle, mit einem Wort die ganze geheime Poesie der Seele in demselben erwecken. Von den Feldern her drang ein lauer würziger Duft in den Salon. Die Baronin und ihr Gatte spielten beim Lampenlicht eine Partie Karten; Tante Lison sass bei ihnen und häkelte, während die jungen Leute vom Fenster aus den in voller Klarheit daliegenden Garten betrachteten. Die Linde und die Platane warfen ihre Schatten auf den großen Rasenplatz, der sich mit seinem fahlen Schimmer bis zu dem ganz dunklen Bosquet dahinter ausdehnte.
Der sanfte Reiz dieser Nacht mit der duftigen Beleuchtung von Bäumen und Häusern zog Johanna mächtig an.
»Mama, wir möchten einen Gang auf dem Rasen hier vorn machen«, wandte sie sich zu ihren Eltern.
»Geht nur, liebe Kinder«, sagte der Baron, ohne von seinem Spiel aufzusehen.
Sie gingen fort und wandelten langsam auf der großen lichten Fläche bis zum kleinen Gehölz im Hintergrunde.
Die Zeit verrann, ohne dass sie an die Rückkehr dachten. Die Baronin spürte Müdigkeit und wünschte zu Bett zu gehen.
»Wir möchten doch unser Pärchen hereinrufen«, meinte sie.
Der Baron ließ seinen Blick durch den großen Park schweifen, wo die beiden Schatten sanft dahinglitten.
»Lasst sie nur«, entgegnete er, »es ist so hübsch da draussen. Lison wird schon auf sie warten; nicht wahr, Lison?«
Das alte Fräulein schlug die Augen ängstlich auf und sagte mit furchtsamen Tone:
»Gewiss, ich werde schon warten.«
Papachen stützte die Baronin.
»Ich werde mich auch schlafen legen«, sagte er, von der Hitze des Tages selbst etwas angegriffen.
Nun erhob sich Tante Lison ihrerseits, legte die angefangene Arbeit, ihre Wolle und die große Häkelnadel auf einen Sessel und beugte sich zum Fenster in die liebliche Sommernacht hinaus.
Die beiden Verlobten gingen ohne Unterlass über den Rasen vom Bosquet zur Rampe und von der Rampe wieder zum Bosquet. Sie drückten sich die Hände ohne viel zu sprechen, gleich als ob die Seele den Körper verlassen hätte, um sich mit dem poetischen Reiz dieser klaren Sommernacht zu verschmelzen.
Plötzlich bemerkte Johanna die Gestalt des alten Fräuleins, welche sich von der Helle des Zimmers deutlich im Fensterrahmen abhob.
»Sieh nur«, sagte sie, »Tante Lison beobachtet uns!«
»Ja, Tante Lison beobachtet uns«, sagte der Vicomte nach einem flüchtigen Blicke, gedankenlos, mit gleichgültigem Tone.
Und sie setzten traumverloren ihren Spaziergang fort.
Als der Tau zu fallen begann und es merklich kühler wurde, sagte sie:
»Wir wollen doch lieber hereingehen.«
Und sie kehrten heim.
Als sie den Salon betraten, sass Tante Lison wieder bei ihrer Häkelei, den Kopf tief über ihre Arbeit gebeugt. Ihre mageren Finger zitterten leicht wie von Übermüdung.
»Es wird Zeit zum Schlafengehen, Tante«, sagte Johanna, sich ihr nähernd.
Das alte Fräulein schlug die Augen auf; sie waren wie vom Weinen gerötet. Die Verlobten hatten kein Acht darauf; vielmehr betrachtete der junge Mann mit ängstlichem Blick die feinen Schühchen seiner Braut, die ganz mit Tau bedeckt waren.
»Hast Du nicht kalt an Deinen lieben kleinen Füsschen?« fragte er zärtlich.
Die Finger der Tante wurden plötzlich von so heftigem Zittern befallen, dass ihr die Arbeit entsank; der Wollknäuel rollte weit über das Parkett. Sie barg das Gesicht in den Händen und begann plötzlich krampfhaft zu schluchzen.
Erstaunt sahen die beiden Verlobten sie an, ohne ein Wort zu sagen. Dann aber sank Johanna auf die Knie, umschlang sie mit ihren Armen und fragte tief ergriffen:
»Aber was hast Du nur, Tante Lison; was fehlt Dir doch nur?«
»Ach, als er Dich fragte«, stammelte die Ärmste mit tränenerstickter Stimme und konvulsivischem Zucken, »ob Du … an … Deinen … lieben … kleinen … Füssen … nicht kalt hättest … Mir hat man … so etwas … nie gesagt … ach nie … nie …!«
Johanna war so überrascht von diesem Gefühlsausbruch, dass sie bei dem Gedanken an einen Liebhaber, der Tante Lison Zärtlichkeiten zuflüsterte, erbarmungslos beinahe laut aufgelacht hätte. Der Vicomte wandte sich ab, um seine Heiterkeit zu verbergen.
Dann erhob sich die Tante plötzlich, ließ ihre Arbeit im Stich und suchte im Dunkeln mit tastenden Schritten die Treppe zu ihrem Zimmer.
Allein gelassen, sahen sich die beiden jungen Leute lustig und zärtlich zugleich an.
»Die arme Tante! …« murmelte Johanna.
»Sie muss heute Abend nicht ganz bei Trost sein«, meinte Julius.
Es wurde ihnen schwer sich zu trennen; sie drückten sich immer wieder die Hände, und leise, ganz leise gaben sie sich den ersten Kuss vor dem großen Sessel, den Tante Lison soeben verlassen hatte.
Am anderen Tage dachten sie schon nicht mehr an die Tränen des alten Fräuleins.
Die beiden letzten Wochen vor der Hochzeit verbrachte Johanna ziemlich still und ruhig, als wenn sie von den süssen Regungen des Brautstandes ermüdet sei.
Am Morgen des entscheidenden Tages war es ihr nicht mehr möglich, über irgendetwas klare Gedanken zu fassen. Sie fühlte etwas wie eine große Leere in ihrem ganzen Körper; es war, als ob ihr ganzes Innere, ihr Herz, ihr Hirn, ihre Gebeine selbst den Dienst versagten. Wenn sie etwas anfasste, so fühlte sie, dass sie heftig zitterte.
Erst im Chor der Kirche vor Beginn des Gottesdienstes fand sie ihre Selbstbeherrschung wieder.
Verheiratet! So war sie also verheiratet! Alles was sie seit Tagesanbruch gedacht, erlebt und empfunden hatte, erschien ihr wie ein Traum. In solchen Momenten kommt einem alles wie ausgewechselt vor; die Bewegungen und Mienen gewinnen eine andere Bedeutung, ja selbst die Stunden scheinen nicht mehr in der richtigen Reihenfolge zu sein.
Sie war verwirrt und über alles erstaunt. Am Abend vorher war noch alles beim Alten gewesen; höchstens hatte sie gefühlt, dass das, was sie erhoffte, nun ganz nahe, beinahe greifbar sei. Als junges Mädchen war sie eingeschlafen, jetzt war sie eine junge Frau.
Sie hatte also die Schranke überschritten, jenseits welcher die Zukunft mit all’ ihren Freuden, all’ ihrem erträumten Glücke lag. Vor ihr schien eine Tür offen zu stehen; sie trat durch dieselbe ein in das erwartete Paradies.
Die Feierlichkeit war zu Ende. Da niemand eingeladen war, so betraten sie fast allein die Sakristei.
Als sie beim Verlassen der Kirche unter dem Portale erschienen, stutzte die junge Frau vor einem mächtigen Krach, der die Luft erschütterte und der Baronin einen Schrei erpresste. Die Landleute hatten eine Salve abgefeuert, deren Widerhall, immer wieder durch neue Schüsse geweckt, sich bis zum Schlosse Peuples fortsetzte.
Für die Familie, die beiden Pfarrer, den Maire und einige Zeugen, die man unter den grösseren Gutsbesitzern der Umgegend ausgesucht hatte, war im Schlosse ein Frühstück angerichtet.
Nach demselben wurde vor dem Diner ein Spaziergang gemacht; der Baron, die Baronin, Tante Lison, der Maire und der Abbé Picot durchwanderten die Allee der Mama, während in der gegenüberliegenden der andere Pfarrer, mit großen Schritten auf- und abwandelnd, sein Brevier betete.
Von der anderen Seite des Schlosses vernahm man den ausgelassenen Jubel der Landleute und Fischer, die unter den Obstbäumen mit Cider regaliert wurden. Die ganze Umgegend war hier im Sonntagsstaat versammelt; die Burschen und jungen Mädchen trieben allerlei muntere Spiele.
Johanna und Julius gingen zusammen durch das Bosquet, stiegen die kleine Anhöhe hinan und betrachteten das ausgebreitete Meer. Trotz der Augustsonne wehte ein kühles Lüftchen; aber der Himmel erglänzte in lichtem reinen Blau.
Die jungen Leutchen durchschritten die Heide, um zu dem lieblichen Tale zu gelangen, welches sich mit seinem Gehölz bis Yport erstreckte. Sobald sie dasselbe betreten hatten, war kaum noch ein Luftzug zu verspüren. Sie verliessen den Hauptweg und verfolgten einen schmalen Pfad, der sich unter dem Gebüsch verlor. Es war hier kaum noch Platz für Zweie und Johanna fühlte plötzlich, wie ein Arm sich langsam um ihre Taille legte.
Sie sagte nichts; nur ihr kurzer Atem und das Klopfen ihres Herzens gaben Kunde von ihren Gefühlen. Die niedrigen Zweige streiften ihre Stirn, sodass sie dieselben oftmals zur Seite biegen mussten. Als sie ein Blatt abgerissen hatte, bemerkte sie unter demselben ein Paar Muttergotteskäferchen, die sich wie zwei kleine rote Schnecken dort festgeklammert hielten.
»Sieh’ mal, Mann und Frau!« sagte sie unschuldig.
»Heute Abend wirst Du auch meine Frau sein« flüsterte Julius ihr ins Ohr.
Obschon sie während ihres Lebens auf dem Lande schon manches gesehen und gehört hatte, fasste sie doch noch die Liebe rein von der poetischen Seite auf. Seine Worte überraschten sie. Seine Frau? war sie das denn nicht schon?
Jetzt überhäufte er sie plötzlich mit unzähligen Küssen auf Stirn und Nacken, dort wo ihre Haare anfingen. Unter dem Eindruck dieser ungewohnten stürmischen Zärtlichkeit eines Mannes neigte sie unwillkürlich den Kopf zur Seite, um den Küssen auszuweichen, die ihr aber doch so wohl taten.
Sie befanden sich jetzt am Rande des Gehölzes. Erschreckt über die weite Entfernung vom Hause blieb Johanna stehen. Was sollte man nur denken?
»Lass uns umkehren« sagte sie.
Er zog den Arm von ihrer Taille fort, und indem sie sich umwandten, standen sie beide so nahe gegenüber, dass sie fast ihren Atem spürten. Sie sahen sich an und zwar mit einem jener starren Blicke, die alles durchdringen und der Verschmelzung zweier Seelen gleichen. Ihre Herzen suchten sich in ihren Augen, hinter denselben, als wollten sie ein Wesen ergründen, das ihnen noch unbekannt, undurchdringlich bis dahin geblieben war. Sie prüften sich gegenseitig mit dieser stummen aber doch so ausdrucksvollen Frage. Was würden sie sich sein? Wie würde sich das Leben gestalten, das sie jetzt miteinander begannen? Welche Freuden, welches Glück oder welche Enttäuschung würde eins dem anderen in diesem langen Zusammensein einer unlöslichen Ehe bereiten? Und es schien ihnen beiden, als hätten sie sich vorher noch nie gesehen.
Plötzlich legte Julius beide Hände auf die Schultern seiner Frau und drückte einen vollen Kuss auf ihre Lippen, wie sie ihn bis da noch nicht empfangen hatte. Er weilte nicht auf ihren Lippen, dieser Kuss, er pflanzte sich durch ihr ganzes Innere fort, durch Mark und Bein. Sie fühlte einen solchen geheimnisvollen Schauer, dass sie halb von Sinnen mit beiden Armen Julius zurückdrängte, wobei sie beinahe hintenüber gefallen wäre. »Lass uns gehen, lass uns gehen« stammelte sie verwirrt.
Er antwortete nichts und ergriff ihre beiden Hände, die er den ganzen Weg über nicht wieder losliess.
Bis zu Hause wechselten sie kein Wort mehr. Der Rest des Nachmittags erschien ihnen sehr lang.
Gegen Abend setzte man sich zu Tische. Das Diner war, ganz gegen die sonstigen Gebräuche in der Normandie, kurz und einfach. Es lag wie eine Art Verlegenheit auf allen Teilnehmern. Nur die beiden Pfarrer, der Maire und die vier geladenen Landleute zeigten einigermassen eine gewisse ausgelassene hochzeitliche Stimmung.
Wenn sie zu lachen aufhörten, so reizte sie ein Witz des Maires aufs Neue dazu. Gegen neun Uhr ungefähr nahm man den Kaffee ein. Draussen unter den Obstbäumen im ersten Hofe begann der ländliche Reigen. Durch die offenen Fenster konnte man den Festplatz übersehen. An den Bäumen waren Papierlaternen aufgehängt und liessen den ganzen Raum in grünlich-gelbem Lichte erschimmern. Männlein und Weiblein hüpften beim Klange eines eigenartigen normannischen Liedes in der Runde, zu dem zwei Violinen und eine Klarinette auf einem als Tribüne dienenden Küchentische eine etwas dünne Begleitung spielten. Der laute Gesang der Tanzenden übertönte vollständig die Instrumente; nur hin und wieder klangen ihre mageren Töne durch das Gejohle hindurch, als wenn sie von Oben her dazu aufspielten.
Zwei große Fässer, durch Fackeln beleuchtet, sorgten für den Durst der Menge. Die beiden Mägde, welche dieselben bedienten, liefen unaufhörlich hin und her, den Arm voll tropfender Gläser, die sie entweder mit rotem Wein oder mit goldglänzendem reinen Cider füllten. Die durstigen Tänzer, die ruhig dasitzenden Alten ebenso wie die schweißtriefenden Jungen beeilten sich, mit ausgestreckten Händen ein Glas oder einen Krug zu erwischen und sich mit zurückgebogenem Kopfe ihr Lieblingsgetränk schluckweise durch die Kehle rinnen zu lassen.
Auf einem Tische waren Brot, Butter, Käse und Würstchen aufgestellt. Von Zeit zu Zeit holte sich jeder einen tüchtigen Bissen; und dieses muntere Treiben unter dem grünen Laubdach in seiner gesunden Natürlichkeit erweckte selbst in den Geladenen oben im Saale die Lust, ein Tänzchen zu machen, und zu Brot und Käse einen Krug vom köstlichen Cider zu schlürfen.
»Tausend auch!« rief der Maire, der mit seinem Messer den Takt schlug, »das ist prächtig, wie bei der Hochzeit zu Ganaga.«
Alles lachte laut.
»Sie meinen die Hochzeit zu Kanaa« sagte Abbé Picot, ein abgesagter Feind aller Zivil-Behörden.
Der andere aber wollte die Belehrung nicht gelten lassen.
»Nein, Herr Pfarrer, ich weiß schon Bescheid; wenn ich sage Ganaga, so meine ich Ganaga.«
Man erhob sich und ging in den Salon. Dann mischte man sich für eine Weile unter die fröhliche Menge, bis die Geladenen sich entfernten.
Der Baron und die Baronin führten leise einen kleinen Streit miteinander. Madame Adelaïde, atemloser wie je, schien auf einen Wunsch ihres Gatten nicht eingehen zu wollen; endlich sagte sie halblaut: »Nein, lieber Freund, ich kann nicht. Ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte.«
Hierauf näherte sich der Papa, indem er sie einfach stehen ließ, seiner Tochter.
»Willst Du einen kleinen Spaziergang mit mir machen, mein Kind?« fragte er.
»Gern, Papa« antwortete sie bewegt. Sie gingen hinaus.
Als sie vor die Türe nach der Meeresseite zu traten, wehte ihnen ein trockener Wind entgegen, einer jener kühlen Sommerwinde, welche schon das Nahen des Herbstes verkünden.
Wolken jagten am Himmel vorüber und verdeckten für einige Augenblicke die Sterne.
Der Baron nahm seine Tochter unterm Arm und drückte zärtlich ihre Hand. So gingen sie einige Augenblicke schweigsam neben einander. Er schien verlegen und unentschlossen.
»Mein Kind«, begann er endlich, »ich habe eine schwierige Aufgabe übernommen, die eigentlich Deiner Mutter zukäme. Da sie sich aber nicht dazu imstande fühlt, so muss ich sie vertreten. Es gibt Geheimnisse, die man Kindern, namentlich Mädchen, sorgfältig verbirgt. Denn gerade letztere sollen reinen, absolut reinen Geistes bis zu der Stunde bleiben, wo sie den Händen dessen übergeben werden, der von da an für ihr Glück Sorge zu tragen hat. Ihm kommt es zu, den Schleier zu lüften, der über das süsseste Geheimnis des Lebens gebreitet ist. Die jungen Mädchen aber, je ahnungsloser sie sind, schrecken umso eher manchmal vor der etwas rauen Wirklichkeit zurück, welche die Erfüllung ihrer Träume mit sich bringt. Sie fühlen sich geistig und körperlich verletzt und verweigern ihrem Gatten das, was menschliches und natürliches Gesetz ihm als absolutes Recht einräumen. Mehr kann ich Dir nicht darüber sagen; aber vergiss das eine, nur das eine nicht: dass Du ganz und gar Deinem Manne angehörst.«
Was wusste sie nun eigentlich? Wie viel hatte sie erraten? Sie begann zu zittern; eine düstere schmerzliche Traurigkeit wie eine Art Vorahnung hatte sie ergriffen.
Als sie ins Haus zurückkehrten, blieben sie überrascht unter der Türe des Salons stehen. Madame Adelaïde hing an Julius Halse und schluchzte herzzerbrechend. Alles an ihr schien Tränen auszuströmen, Nase, Mund und Augen; und der junge Mann hatte in seinem Erstaunen alle Mühe, die starke Dame zu stützen, welche ihm in die Arme gesunken war, um ihm die Sorge für ihr Kleinod, ihr Herzblatt, ihr angebetetes Kind, auf die Seele zu binden.
»Ach, nur keine Szene!« sagte der Baron rasch vortretend, »ich bitte drum.« Er nahm seine Gattin und führte sie zu einem Sessel, während sie sich das Gesicht abwischte.
»Komm mein Kind«, wandte er sich alsdann zu Johanna, »gib Mama einen Kuss und geh’ zu Bett.«
Johanna hielt die gleichfalls drohenden Tränen zurück, küsste schnell ihre Eltern und verliess das Zimmer.
Tante Lison hatte sich schon auf ihr Zimmer zurückgezogen. Der Baron und die Baronin blieben mit Julius allein. Alle drei waren so verlegen, dass sie kein Wort sprachen. Die Herren standen zerstreut da in ihrer Diner-Toilette, während Madame Adelaïde ganz erschöpft, noch die letzten Tränen auf den Wangen, in ihrem Sessel lag.
Um der Verlegenheit ein Ende zu machen, begann der Baron von der Reise zu sprechen, welche die jungen Leute nach einigen Tagen unternehmen sollten.
Johanna ließ sich in ihrem Zimmer durch Rosalie auskleiden, die wie ein Wasserfall weinte. Ihre Hände waren ungeschickt; sie fand sich mit Schnüren und Hefteln nicht zurecht und schien noch in viel grösserer Gemütsbewegung wie ihre Herrin. Aber Johanna achtete nicht auf die Tränen ihrer Kammerjungfer; sie war wie auf einer anderen Welt, in einem fremden Land, getrennt von allem, was ihr bis dahin lieb und teuer gewesen war. In ihrem Denken und Fühlen schien alles so durcheinander zu sein, dass sie sich sogar fragte, ob sie eigentlich ihren Gatten liebe. Er schien ihr jetzt plötzlich ein Fremder zu sein, den sie kaum vorher gekannt hatte. Vor drei Monaten wusste sie noch nichts von seiner Existenz und jetzt war sie schon seine Frau. Wie kam das eigentlich? Warum so schnell in die Ehe stürzen, wie in ein Loch, das sich plötzlich zu unsern Füssen öffnet?
Als sie ihre Nachttoilette beendet hatte, schlüpfte sie ins Bett. Die frisch überzogenen Leintücher verursachten ihr einen leichten Schauer und vermehrten das Gefühl der Kälte, der Einsamkeit und Traurigkeit, welches seit zwei Stunden auf ihrer Seele lastete.
Rosalie entfernte sich, noch ganz in Tränen gebadet. Ängstlich und mit krampfhaftem Seelenschmerz erwartete sie das, was sie halb und halb aus den dunklen Andeutungen ihres Vaters erraten hatte, die Enthüllung dessen, was man das große Geheimnis der Liebe nennt.
Drei leichte Schläge ertönten an der Türe, ohne dass sie jemand hatte die Treppe heraufkommen hören. Sie fing heftig an zu zittern und wagte nicht zu antworten. Es klopfte abermals und dann wurde die Tür geöffnet. Sie steckte den Kopf unter die Decke, wie wenn ein Dieb in ihr Zimmer geschlichen käme. Leichte Schritte tönten auf dem Fussboden, und dann stand jemand plötzlich an ihrem Bett.
Sie stiess vor Erregung einen kleinen Schrei aus, und als sie den Kopf hervorstreckte, sah sie Julius neben sich stehen. Er schaute sie lächelnd an.
»Ach, wie Sie mich geängstigt haben!« sagte sie.
»Haben Sie mich denn nicht erwartet?« fragte er.
Sie antwortete nicht. Er war noch vollständig in seiner Festtoilette; als sie in sein hübsches Gesicht schaute, fühlte sie plötzlich eine große Scham darüber, vor diesem ganz angezogenen Manne so leicht bekleidet dazuliegen.
Sie wussten beide nicht, was sie sagen oder tuen sollten; sie wagten nicht einmal, sich anzusehen. So sehr fühlten beide instinktiv den Ernst dieser entscheidenden Stunde, von der ja so oft das Glück eines ganzen Lebens abhängt.
Er hatte so eine unbestimmte Ahnung, welche Gefahr für ihn darinlag, wenn er seine Selbstbeherrschung verlor. Er würde seine ganze wohlerwogene Zärtlichkeit aufbieten müssen, um nicht das peinliche Zartgefühl und die keusche Schamhaftigkeit eines nur von idealen Träumen erfüllten jungfräulichen Gemütes zu verletzen.
Sanft nahm er ihre Hand und küsste sie; dann kniete er vor ihrem Bett wie vor einem Altar nieder und flüsterte mit leiser zärtlicher Stimme:
»Werden Sie mir Ihre Liebe schenken?«
Sie gewann ihre Sicherheit langsam wieder, hob das Köpfchen aus dem spitzenbedeckten Kissen und sagte lächelnd:
»Ich liebe Sie ja schon längst, mein Freund!«
Da nahm er die kleinen zarten Finger seiner Frau an die Lippen und fragte sie zärtlicher noch als vorher:
»Wollen Sie mir auch den Beweis Ihrer Liebe geben?«
Seine Stimme klang ganz verändert, als er so zwischen ihren Fingern hindurch fragte.
»Ich gehöre Ihnen ja, lieber Freund!« antwortete sie aufs Neue verwirrt durch seine Frage, welche, ohne dass sie dieselbe ganz verstand, ihr doch die Worte des Vaters ins Gedächtnis zurückrief.
Er bedeckte immer wieder ihre Hand mit Küssen und, indem er langsam aufstand, suchte er sich ihrem Antlitz zu nähern, das sie aufs Neue zu verbergen strebte.
Dann streckte er plötzlich einen Arm aus, umschlang seine Frau mitsamt der Bettdecke und schob den anderen Arm unter das Kopfkissen. So zog er sie langsam an sich und flüsterte ihr leise, ganz leise zu:
»Würden Sie mir dann auch ein kleines Plätzchen in Ihrem Bette gönnen?«
Sie empfand Furcht, eine instinktive Furcht:
»Ach, jetzt noch nicht, ich bitte Sie«, stammelte sie.
Er war sichtlich überrascht, ein wenig verletzt sogar; und wenn er den bittenden Ton auch beibehielt, so klang es doch etwas rauer, als er jetzt sagte:
»Warum etwas verschieben, was wir doch schliesslich alle Tage so machen werden?«
Sie ärgerte sich über diese Worte; aber schliesslich sagte sie doch zum zweiten Male sanft und ergeben:
»Ich gehöre Ihnen ja, lieber Freund!«
Da verschwand er schnell im Ankleidezimmer. Sie hörte deutlich und mit ängstlichen Schauern das Geräusch abgelegter Kleider, das Klingen von Geld, das er aus der Tasche nahm, das Fallen der ausgezogenen Schuhe.
Und plötzlich kam er in Unterkleidern und Pantoffeln rasch durch das Zimmer gegangen, um seine Uhr auf den Kamin zu legen. Dann kehrte er hastig ins Nebengemach zurück, verweilte noch einige Augenblicke und … Johanna wandte sich rasch auf die Seite und schloss die Augen, als sie sein Nahen bemerkte.
Sie fühlte eine Regung aus dem Bett zu springen, als er jetzt rasch unter die Decke schlüpfte und sie die Berührung eines fremden, kalten und haarigen Körpers an dem ihrigen spürte. Entsetzt, das Gesicht mit den Händen bedeckend, hätte sie am Liebsten laut schreien mögen und sie zog sich ganz an das Ende des Bettes zurück.
Obschon sie ihm den Rücken drehte, schloss er sie doch in seine Arme und küsste sie heftig auf den Nacken, wobei er die Bänder ihrer Nachthaube und den Spitzenbesatz ihres Hemdes zurückschob.
Selbst als sie bemerkte, wie seine Hand begierig nach ihrem Busen tastete, regte sie sich nicht, von einer entsetzlichen Furcht gelähmt. Sie atmete schwer unter dieser ungewohnten Berührung, bei der sie am liebsten aus dem Zimmer geflüchtet wäre, um sich irgendwo, fern von diesem Manne, einzuschliessen.
Er aber wich nicht von der Stelle. Sie fühlte die Wärme seines Körpers, sie bemerkte, wie er seine Zärtlichkeiten verdoppelte und schliesslich merkte sie, dass ihr doch nichts übrig bleiben würde, als sich umzuwenden und ihn wieder zu küssen.
Denn er begann bereits ungeduldig zu werden und sagte mit traurigem Tone:
»Sie wollen also nicht meine kleine liebe Frau sein?«
»Bin ich das denn nicht schon?« murmelte sie kaum hörbar.
»Nein, durchaus nicht,« antwortete er mit einem Anflug von Herbheit, »ich glaube, Sie halten mich zum Besten.«
Ganz ergriffen vom Ton seiner Stimme wandte sie sich plötzlich zu ihm um und bat ihn um Verzeihung.
Er nahm sie nun vollends in seine Arme und begann wie ein Rasender sie mit Küssen zu bedecken. Keine Stelle an ihrem ganzen Gesicht blieb von diesen heisshungrigen, verzehrenden, wütenden Küssen unberührt. Sie hatte die Hände zurückgezogen und ergab sich widerstandslos, ohne selbst zu wissen, was sie tat, seinen stürmischen Liebkosungen. Ein tiefer Schmerz durchdrang ihren Körper, sie begann zu seufzen und erwiderte lebhaft die Küsse, vor denen sie vorhin noch so sehr zurückgeschreckt war. Jetzt war sie Julius seine Frau.
Was dann noch geschah, entzog sich ihrem Gedächtnisse, ihr Bewusstsein war ziemlich geschwunden; nur dunkel erinnerte sie sich noch, wie ihr Julius einen langen innigen dankbaren Kuss auf die Lippen drückte.
Dann sprach er mit ihr und sie musste ihm antworten. Nach einiger Zeit begann er seine Zärtlichkeiten aufs Neue; aber sie sträubte sich voll Scham, und während sie seine Umarmung abwehrte, fühlte sie auf seiner Brust die dichten Haare, die sie schon vorhin an seinen Beinen gespürt hatte. Entsetzt drehte sie sich um.
Er schien es schliesslich leid zu sein, sich vergeblich mit ihr zu bemühen und blieb ruhig liegen.
Dann dachte sie nach. »Das also heisst seine Frau sein; das also, nur das!« und die tiefste Verzweiflung ergriff ihr Herz, als sie ihre Träume von innigster Zärtlichkeit so zerstört, ihre teuersten Erwartungen enttäuscht, ihr Glück vernichtet sah.
Lange lag sie so mit ihrem Schmerze da, während ihre Augen über die Stickereien an der Wand flogen, über die alte Liebesgeschichte, mit der das ganze Zimmer sozusagen bedeckt war.
Aber als Julius nichts mehr sprach und ganz regungslos dalag, wandte sie langsam ihren Blick zu ihm und bemerkte, dass er schlief. Er schlief mit halboffenem Munde, sein Antlitz zeigte einen ruhigen, zufriedenen Ausdruck. Er schlief also!
Sie konnte es kaum glauben; sie fühlte sich verletzt. Dieser Schlaf befremdete sie noch mehr als sein Ungestüm, sie fühlte sich rücksichtslos behandelt. Konnte er denn wirklich in dieser Nacht schlafen? Für ihn hatte also das, was zwischen ihnen vorgefallen war, nichts Aussergewöhnliches? Ach, sie hätte sich lieber noch schlagen lassen, so fühlte sie sich verletzt und entrüstet über die sonderbaren Zärtlichkeiten; und er schlief ganz ruhig danach.
Auf einen Ellenbogen gestützt schaute sie unbeweglich zu ihm herüber und horchte auf die tiefen Atemzüge, welche über seine Lippen kamen und schliesslich in ein ziemlich lautes Schnarchen übergingen.
Der Tag brach an, anfangs unbestimmt dämmernd, dann lichter, rosiger und endlich hellstrahlend. Julius öffnete die Augen, gähnte, streckte die Arme, sah seine Frau an und fragte lächelnd: »Hast Du gut geschlafen, mein Herz?«
Sie bemerkte, dass er jetzt »Du« zu ihr sagte und antwortete etwas verwirrt: »O ja, und Sie?«
»Ach, ausgezeichnet« sagte er. Und er wandte sich zu ihr und küsste sie; dann fing er ruhig an zu plaudern. Er setzte ihr seine Zukunftspläne auseinander und seine Ansichten über Sparen; letzteres Wort kam in seinen Ausführungen öfters vor und machte Johanna etwas erstaunt. Sie horchte auf seine Worte, ohne den Sinn richtig zu verstehen, sah ihn an, dachte an tausend vergangene Dinge, die ihm doch viel näher liegen mussten und ihn dabei gar nicht zu berühren schienen.
Es schlug acht Uhr.
»Jetzt müssen wir aber aufstehen«, sagte er, »man könnte sich sonst lustig machen, wenn wir so spät herunterkämen.«
Er stand zuerst auf. Als er seine Toilette beendet hatte, half er sorgfältig seiner Frau bei der ihrigen und duldete nicht, dass Rosalie gerufen wurde.
Schon im Begriff, herauszugehen, blieb er nochmals stehen:
»Wenn wir allein sind,« sagte er, »können wir uns schon duzen, weißt Du; aber in Gegenwart der Eltern wollen wir lieber noch etwas damit warten. Es macht sich von selbst, wenn wir von der Hochzeitsreise zurückkehren.«
Sie zeigte sich erst zur Stunde des Frühstücks.
Der Tag verlief im Übrigen, als hätte sich inzwischen nichts neues zugetragen. Nur eine Person mehr war im Hause; das war alles.
*