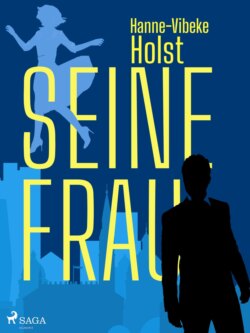Читать книгу Seine Frau - Hanne-Vibeke Holst - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWeihnachten ist eine Prüfung für viele Menschen, heißt es in den Radionachrichten. Viele nehmen sich das Leben oder rufen verzweifelt bei der Telefonseelsorge oder einer der anderen Hotlines an, an die die Einsamen und Deprimierten sich wenden können. Eine Telefonnummer wird genannt, aber ich höre nur mit halbem Ohr zu, weil ich mit der Ente und den gebräunten Kartoffeln beschäftigt bin, und denke, dass ich dieses Jahr keine von diesen Verzweifelten sein werde. In diesem Jahr habe ich mein Schäfchen im Trockenen, bin drinnen in der Wärme, muss keine von denen sein, die sich die Nasen an den Fensterscheiben platt drücken, um sich auf die Feste der anderen zu träumen. In diesem Jahr bin ich dabei, in diesem Jahr gibt es keine Katastrophe, in diesem Jahr stehe ich in einer ganz gewöhnlichen Küche, in der ganz gewöhnliche Fragen gestellt – Meinst du nicht, dass ich jetzt die Ente herausnehmen sollte, damit sie noch eine Weile stehen und ruhen kann? – und ganz gewöhnliche Antworten gegeben werden – Ja, sie sieht gut aus. Wir können sie zum Schluss immer noch ein paar Minuten unter den Grill stellen. Man darf sie nur nicht aus den Augen lassen, das kann schnell schiefgehen. Doch an diesem Abend geht nichts schief, da bin ich sicher, denn mein Schwager Ole-Stig ist bei uns, und seit er gestern Morgen über die Schwelle getreten ist, scheint das ganze Haus wie verzaubert. Die reinste Magie. Gert schimpft nicht mehr, brummt nicht verärgert herum, sondern lächelt und wünscht sogar meiner Schwägerin Janni schöne Weihnachten, als sie mir unangemeldet einen großen, in Zellophan eingepackten Weihnachtsstern vorbeibringt, der angeblich von meiner Mutter ist. Er wird gegen die übliche Schachtel Anthon-Berg-Pralinen ausgetauscht, die ich meiner Mutter in den letzten Jahren pflichtschuldigst geschenkt habe. Die Kinder sind auch im Auto, sie sind auf dem Weg zum Mozarts Plads, um zusammen mit »Großmutter« Weihnachten zu feiern. Janni hat einen Weihnachtskorb von der Heilsarmee bekommen, erzählt sie, als Ole-Stig alle hereinbittet. Gott sei Dank lehnt sie ab, sie müssen weiter; sie bringt schließlich das Essen mit. Dafür geht er mit hinaus und grüßt und steckt ihr einen zusammengerollten Hundertdollarschein zu, von dem sie den Kindern etwas Schönes kaufen soll. Janni ist zu Tränen gerührt, sie ist es nicht gewohnt, etwas geschenkt zu bekommen, eigentlich überhaupt nicht, etwas zu bekommen, und deshalb gibt er ihr noch einmal hundert Dollar und sagt, dass die für sie sind. Er kann sich das leisten, das ist es nicht. Es ist die Fürsorge, mit der wir nicht zurechtkommen, Janni und ich. Ich habe die Chance ergriffen, mit hinauszugehen, um die drei Kinder zu begrüßen; Stephanie, die auf dem Beifahrersitz sitzt, raucht, bald sechzehn ist und schon seit Langem mehr als geküsst wird, Patrick, der Lümmel, der die dunklen Augen seines Onkels hat, und der kleine Oliver, mollig und mit roten Wangen. Für ihn besteht noch Hoffnung, der Blick der beiden Großen ist bereits stahlhart, sie gehen wohl einer kriminellen Zukunft entgegen. Stephanie hat man beim Ladendiebstahl erwischt und Patrick aus dem Landschulheim nach Hause geschickt, weil er fünf Gramm Hasch bei sich hatte. Das ist Scheiße, und ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun – etwas anderes, als heimlich Weihnachtsgeschenke zu schicken, wie ich das auch dieses Jahr getan habe.
Deshalb winke ich dem hustenden Daihatsu, der bestimmt den nächsten TÜV nicht übersteht, auch mit einer gewissen Beklommenheit nach. Ole-Stig sagt nichts, legt mir nur einen Arm um die Schulter; er weiß, was ich denke, und auch, was ich fühle. Vielleicht besser als ich. Wir überlassen das Thema sich selbst wie einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel; wir sind mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen, und es bringt nichts, über das Kind zu weinen, das ich verloren habe, und die Kinder, die ich später nicht bekommen konnte.
»Great kids! Was sind die groß geworden«, sagt er, als das Auto um die Ecke verschwunden ist. Etwas im Klang seiner Stimme verrät, dass er vielleicht den gleichen Schmerz mit sich herumträgt, sich nie reproduziert zu haben. Ob es Gert auch so geht? Haben sie jemals darüber gesprochen? Dass die Familie mit ihnen ausstirbt, mit den beiden Brüdern?
»Ja«, sage ich und schaudere vor Kälte. Es ist noch immer windig, obwohl der Sturm langsam abnimmt. »Die Kinder sind schon okay. Na schön, wir sollten besser ...!«
Ole-Stig nickt, und wir gehen in die Küche und fahren da fort, wo wir aufgehört haben. Wir liegen gut in der Zeit; wir arbeiten prima zusammen, und selbst Gert findet sich in den Rhythmus ein, als er aus seinem Arbeitszimmer auftaucht, wo er wie üblich Stunden über seinem Taschenrechner und einem Block verbracht hat. Ole-Stig nennt ihn kopfschüttelnd einen unverbesserlichen workaholic – am Weihnachtsabend über einem alternativen Finanzgesetz zu brüten! Wo er nicht einmal Finanzsprecher ist! Gert zuckt versöhnlich mit den Schultern und macht unaufgefordert eine Flasche Wein auf, Kerzen und Musik an. Frank Sinatras Weihnachtshits sind kurz darauf aus den Lautsprechern in der Küche zu hören.
»Das ist das Amerika, das es einmal gab. Vor Ground Zero«, bemerkt Ole-Stig und summt bei I’ll Be Home for Christmas mit, während er das Glas Rotwein entgegennimmt, das Gert ihm eingegossen hat. Ich bekomme auch eins; er macht es ganz voll, damit ich den Wein nicht mit Wasser verdünnen kann, nicht wahr? Es wäre gelogen, zu behaupten, dass ich den ganzen Tag noch keinen Tropfen getrunken habe. Ich war gezwungen, in das Außenlager im Garten zu gehen, wo ich Flaschen unter ein paar großen, leeren Tontöpfen versteckt habe, um ein paar Drinks zu kippen. Nicht viele, nur genug, dass meine Hände nicht so zittern. Deshalb bin ich ungewöhnlich klar im Kopf und kann sowohl zuhören wie auch die Sauce zubereiten, während das Gespräch zwischen den beiden Brüdern lebhaft wird, die sich mit ihren roten Haaren, ihren Sommersprossen und ihren behänden Gestalten zwar gleichen, ansonsten aber so unterschiedlich wie Tag und Nacht sind. Nicht nur weil Ole-Stig vier Jahre jünger und schwul ist und mit seinem gepflegten Schnäuzer, der modischen Kleidung und der Breitling-Uhr am Handgelenk durchaus als wohlhabender gay doctor von der amerikanischen Ostküste gecastet werden könnte, der in einige der Sitcoms passt, mit denen ich mein Dasein friste. Sondern auch weil Gert der Schwermütige und Rätselhafte, und Ole-Stig mit einem fröhlicheren Gemüt und einer allumfassenden Offenheit gesegnet ist. Besonders wenn sie zusammen sind, wird dieser Unterschied deutlich. Während Gert das Glas immer als halb leer ansehen wird, ist es für Ole-Stig stets halb voll. Trotzdem fällt mir, während ich das Entenfett von der Sauce abschöpfe, auf, dass Ole-Stig pessimistischer wirkt als sonst.
Sie unterhalten sich nämlich über Politik, über Amerikas Rolle in der Welt, über die Wahrscheinlichkeit, dass die USA sich die patriotische Stimmung für ihren Krieg gegen den Terror zunutze machen und den Irak besetzen werden, um Saddam Hussein zu stürzen. Ole-Stig verdreht die Augen, während Gert all die Männer aufzählt, die den Präsidenten unterstützen, unter anderem Cheney und Rumsfeld, die beiden Falken des rechten Flügels. Sie sind ganz versessen darauf, auf den Knopf zu drücken, send in the marines, und der allzu weiche Falke Colin Powell dürfte außerstande sein, das zu verhindern.
»That’s right!«, stimmt Ole-Stig zu. »Und wenn diese Condoleezza Rice sie auch noch anspornt, werden sie sich noch mehr ins Zeug legen! What the fuck macht sie in dieser Regierung?«
»Sie ist die schwarze Geisel«, sagt Gert und klaut sich eine meiner Zigaretten aus der Packung auf dem Küchentisch. Eine seltene Ehre. »Condee ist der Schinken im Sandwich. Genau wie Colin«, fügt er hinzu.
»Sie ist die schwarze weibliche Geisel«, ergänze ich und schüttle mir selbst eine Zigarette aus der Packung. Drehe mich zu Gert um, um mir Feuer geben zu lassen, aber er hat das Feuerzeug weggelegt. Ole-Stig nimmt es und gibt mir Feuer.
Gert zieht skeptisch die Mundwinkel nach unten, er hat meine »selbst gestrickten Analysen« noch nie gemocht. Obwohl sie auf dem sporadischen Lesen der internationalen Zeitungen und Zeitschriften basieren, die ich ab und zu aus Gerts Papierkorb fische, um mich durch sie hindurchzuarbeiten. Wenn ich mit Saubermachen, Wochenzeitschriftenlesen und Nägellackieren fertig bin, versteht sich.
Doch Ole-Stig gibt mir recht, hurra!
»Yeah! Condee ist noch wichtiger für sie als Powell! Wenn eine schwarze Frau bis ganz an die Spitze kommen und Sicherheitsbeauftragte werden kann, ist an der Legitimität der Bush-Regierung nichts auszusetzen. Dann kann man sie nicht der Diskriminierung beschuldigen, oder?«
»Wir sind fast gleichaltrig. Sie ist ’54 geboren«, sage ich und ernte einen resignierten Blick von Gert, der sich wieder darin bestätigt fühlt, dass ich nicht intelligenter bin als die Türen, gegen die er meinen Kopf knallt. Das ist so eine Angewohnheit, die ich mir zugelegt habe. Ich erinnere mich an die Geburtsjahre berühmter Frauen, um mich damit zu quälen, was aus mir hätte werden können. Richterin am Obersten Gerichtshof, Professorin der Molekularbiologie, Literaturnobelpreisträgerin, Ministerin ...! Natürlich ist das Unsinn, lächerlich, mir einzubilden, dass an mir eine Superfrau verloren gegangen ist. Dafür habe ich, 1950 geboren, noch immer eine reelle Chance, unter die jüngeren Toten zu fallen, die ich täglich in den Todesanzeigen zähle. Zumindest das muss ich schaffen, früh genug zu sterben, damit es bemerkt wird. Und wie immer hilft Gert mir dabei, dieses Ziel zu erreichen, indem er spitz fragt, was diese Bemerkung soll?
»Nichts«, piepse ich und konzentriere mich hausmütterlich auf die bräunenden Kartoffeln, die Ole-Stig vergessen zu haben scheint. Schulmeisterhaft wendet sich Gert Ole-Stig zu und erklärt den Begriff Pax Americana, dem wir Europäer per definitionem, like it or not, unterworfen sind, wie er meint. Eine Radiodiskussion, zu der ich – wie er annimmt – absolut keine Meinung habe. Von mir wird erwartet, dass ich den Mund halte. Aber ich bin trotz allem auch ein paar Semester auf die Universität gegangen, und ich kann eine Zeitung lesen, und jetzt, wo Ole-Stig als Puffer da ist, kann ich der Versuchung nicht widerstehen, meine Meinung kundzutun.
»Ja, aber«, unterbreche ich und mache einen tiefen Zug. »Es ist zwar möglich, dass wir uns mit Amerikas ökonomischer und militärischer Dominanz abfinden müssen. Es ist auch möglich, dass wir als kommunistischer Satellitenstaat geendet wären, wenn die USA uns nicht gerettet hätten. Aber bedeutet das, dass wir ihnen ewig dafür dankbar sein müssen? Historische Überlegenheit gibt doch nicht dem Stärkeren das moralische Recht, den Schwächeren niederzuwalzen! Man muss doch Respekt vor anderen Meinungen haben ... Ich meine, das ist doch nicht zivilisiert, oder?«
»Was ist nicht zivilisiert?«, fragt Gert und stößt Rauch aus.
»Andere auf ihren Platz zu prügeln«, sage ich und begegne seinem Blick, als der Rauch in Richtung Dunstabzug zieht. »Seinen Willen zu erzwingen«, meine ich. »Das ist doch unmenschlich, nicht?«
Ole-Stig nickt bestätigend, trotz Gerts spitzer Bemerkung: »Das ist internationale Politik, Schatz!« Offenbar hat der kleine Bruder die Doppeldeutigkeit in dem ehelichen Duell nicht mitbekommen, denn er spricht mit Sicherheit nur von Amerika, als er sagt, dass sie auch gegen die Schwulen sind.
»Sie sind gegen die Schwulen, die Lesben, die Indianer, die Gewerkschaften, die Abtreibungsärzte, die Feministinnen und die Intellektuellen. Alle Minderheiten erleben das. Unsere Telefone werden abgehört, die Basisdemokraten werden unterwandert, und wenn du sonntags nicht in die Kirche gehst, bist du bereits einer von ihnen. Ein potenzieller Terrorist oder ein enemy of the state. Sie sind so extrem paranoid, dass es schon krank ist. So viel dazu, die mächtigste Nation der Welt zu sein, Gottes gelobtes Land! Ein Terrorangriff, und alles wird zu Staub. Ich glaube wirklich, ich emigriere!«
»Ja! Komm nach Hause! Du kannst bei uns wohnen! Bob auch! Ihr könnt beide hier wohnen! Oben!«, rappe ich eifrig, zu eifrig, wie ich an Gerts angespanntem Ausdruck sehe. Es ist zwar Weihnachten, aber es gibt Grenzen.
»Too late, honey«, sagt Ole-Stig mit einem bedauernden Schulterzucken und steht auf. »Hast du ein ordentliches Messer?«
Yes, ich habe ein ausgezeichnetes, geschliffenes Messer, das mühelos die hervorragende Ente zerteilt, die zu dem hervorragenden Burgunder passt, an dem bei diesem hervorragenden Weihnachtsessen keiner spart. Eigentlich hatte ich geplant, in Maßen zu trinken, doch das Küchengeplauder war trotz allem so stressig, dass die Nervosität wie Fritteusenfett im Magen siedet. Ich habe auch Angst, eine Hitzewelle zu bekommen, die Kerzen geben so viel Wärme ab, dass sich Schweißtropfen unter der Kante meines BHs zu sammeln beginnen. Ich habe meinen Arzt bereits angefleht, mir Hormone zu geben, bin bereit, das Risiko eines Blutpfropfens in Kauf zu nehmen. Der Arzt hat nicht begriffen, warum ich so versessen darauf bin, Östrogene zu schlucken. Ich bin schließlich nicht in der Situation vieler Karrierefrauen mittleren Alters, die sich ihr ganzes Curriculum Vitae verderben können, wenn sie bei einer PowerPoint-Präsentation eine Hitzewallung bekommen – wie Condee bei einer Besprechung im Oval Office, stelle ich mir vor –, ich kann nach Hause gehen und durchschwitzen, was ich will. Mein Arzt ist nicht besonders fantasievoll, oder vielleicht verkraftet er einfach keine Patientinnen mit Problemen, deshalb gehe ich auch weiter zu ihm. Er fragt nie nach, auch nicht, wenn ich ein weiteres Mal mit einer gebrochenen Rippe komme, da ich »die Treppe hinuntergefallen bin«, oder Blut im Urin habe, weil die Nieren bei »einem Tritt von einem Pferd« zu Schaden gekommen sind. Deshalb hat er auch nicht genug Fantasie, sich vorzustellen, dass ich ein sehr viel größeres Risiko eingehe, wenn ich in Gegenwart meines Mannes Hitzewallungen bekomme, als wenn ich Hormone schlucke. Denn Gert ekelt sich vor meinen Hitzewallungen, die er als Provokation ansieht, und wenn ich während des Weihnachtsessens eine bekäme, fände er das so unappetitlich, dass er ohne Zweifel aufstehen und den Tisch verlassen würde. Selbst in Gegenwart seines Bruders.
Dank des Sterns von Bethlehem und vor allem dank der himmlischen Empathie meines Schwagers, die ihn demonstrativ den Schlips lösen und Gert bitten lässt, die Tür zum Garten zu öffnen, kann ich die Katastrophe abwenden, indem ich mir die Oberlippe mit dem Tellerdeckchen trocken tupfe und den obersten Knopf meiner mit Applikationen verzierten Seidenbluse öffne. Doch meine Nervosität bekomme ich nicht so leicht in den Griff, denn jetzt dauert es nicht mehr lange, bis wir die Geschenke austauschen. Es ist das Fahrrad, das mich nervös macht. Ob es ihm gefällt? Oder ob es total falsch ist? Als ich den Mandelreis auf den Tisch stelle und die Portionen verteile, tue ich das mit dem stillen Gebet, dass Gert die Mandel bekommt. Nicht weil er auch nur im Mindesten an dem Marzipanschwein mit der roten Schleife interessiert wäre, das für alle sichtbar auf dem Tisch steht, sondern weil ich weiß, wie sehr er es hasst, eine Trophäe, welcher Art auch immer, nicht zu gewinnen. Ole-Stig weiß das auch, doch dann fährt trotzdem ein kleiner Teufel in ihn, denn offenbar hat er nicht vor, Gert kampflos den Sieg zu überlassen. Es endet damit, dass die beiden sich jeder durch vier Portionen essen, bevor ich meine Chance gekommen sehe, die Mandel, die in meiner Portion war, in einen kleinen Klacks auf Gerts Teller zu schummeln. Ole-Stig sieht es sofort und schreit Das ist Betrug!, doch Gert führt schnell den Löffel zum Mund, um dann schamlos zu behaupten, der rechtmäßige Gewinner zu sein. Ein edler Gewinner, der das Schwein sofort an Ole-Stig weitergibt, mit einem nachsichtigen Verderben wir dem Kind nicht den Spaß!
»Dem Kind!«, quäkt Ole-Stig. »Who the fuck ist hier das Kind! So ist er immer gewesen«, beklagt er sich theatralisch bei mir, und ich lache und sage: »I know!«
Gert gluckst und hebt das Portweinglas, und Ole-Stig schüttelt gutmütig den Kopf und bringt ein Skål auf die Abwesenden aus – unter anderem auf die toten Eltern und den lebenden Bob, mit dem er mindestens zweimal am Tag lange Telefongespräche führt. Noch immer guter Laune macht Gert den Weihnachtsbaum an, den Ole-Stig und ich gestern gekauft und heute Vormittag geschmückt haben, während Gert kurz in der Burg war, und ich stehe vom Tisch auf und setze Kaffee auf und stürze eilig zwei Gläser mit Rotwein hinunter, um die Panik zu dämpfen, die mich durchströmt. Warum habe ich nicht einfach nur ein Buch oder ein paar Handschuhe oder etwas anderes, weniger Ausgefallenes gekauft? Es wäre besser gewesen, wenn wir die Geschenke ganz abgeschafft hätten. Weniger peinlich für uns beide. Denn was mag er für mich gekauft haben? Noch einen Satz Unterwäsche, die er dann zerreißt, wenn sich die Gelegenheit bietet?
Mit steifen Schritten kehre ich, das Kaffeetablett in den Händen, ins Wohnzimmer zurück. Und lasse es vor lauter Entzücken beinahe fallen, als ich den angezündeten Weihnachtsbaum sehe. Alle elektrischen Lampen sind ausgeschaltet, und Frank Sinatra singt wieder. Gert dreht sich zu mir um und lächelt, und Ole-Stig nimmt mir das Tablett ab und stellt es auf den Sofatisch.
»Ist das schön!«, rufe ich und bleibe stehen und sehe mir blinzelnd den Baum an. Wann haben wir zuletzt einen Baum gehabt, der bis zur Decke reichte? Vor zehn Jahren? Vor fünfzehn? Jedenfalls nicht mehr, seit wir aufgehört haben, mit unseren Familien Weihnachten zu feiern.
Ole-Stig besteht darauf, dass wir um den Baum tanzen, und obwohl Gert sich weigert, endet es damit, dass wir um ihn herumgehen und einander an den Händen halten. Ole-Stig hat Frankieboy abgestellt und singt jetzt selbst – und was immer man über ihre Kindheit in der Missionsstation sagen mag, die Weihnachtslieder haben sie in der Sonntagsschule gelernt. Einige werden auf Englisch gesungen, doch das spielt für mich keine Rolle. In meiner Familie waren wir nie sonderlich weihnachtsliedfest, sodass ich ohnehin nicht viele Strophen der dänischen Versionen kenne. Ich lausche auch lieber den aufeinander abgestimmten Baritonen der beiden Männer, die Silent Night singen, dass die Fensterscheiben beschlagen und die Götter sich einfach erbarmen müssen. Und ich hoffe, das tun sie weiter, die Götter, damit mein Geschenk sich nicht als Katastrophe erweist. Als mein Verschworener holt Ole-Stig das Fahrrad aus dem Schuppen, wo es der freundliche, zu seinem Wort stehende Fahrradhändler auf meine Bitte hin gestern abgestellt hat.
»Für Gert von seiner Frau!«, liest Ole-Stig laut, als er das Fahrrad ins Wohnzimmer getragen hat. Ich hätte es nicht in Geschenkpapier einpacken sollen. Gert ist sichtlich irritiert, das ganze Papier abwickeln zu müssen, deshalb eile ich ihm mit einer Schere zu Hilfe und mache es für ihn, während er stumm zusieht.
»Ein Fahrrad«, sagt er schließlich nüchtern, als ich es von dem Goldpapier befreit habe.
»Ein Raleighrad«, sage ich. »Mit Trommelbremse. Gebraucht ... So eins, wie du es einmal gehabt hast ... damals, als wir jung waren, meine ich ... Ich dachte ...«
»Cool!«, sagt Ole-Stig und betätigt die Klingel. »Ein Vintage-Modell! Die bekommt man in den USA fast gar nicht!«
»Ich hatte eigentlich an ein Rennrad gedacht«, sagt Gert. »Ein Mountainbike. Das hier hat so etwas Altväterliches, nicht?«
Ole-Stig schüttelt zungenschnalzend den Kopf. Klopft Gert auf die Schulter.
»Granny, let’s face it! Wir sind schließlich im Großvateralter. Auch wenn wir keine Enkelkinder haben!«
Ich bücke mich schnell, sammle das um seine frisch geputzten Lloyd-Schuhspitzen verteilte Papier auf und vermeide so, seinen Gesichtsausdruck zu sehen. Kann ihn mir aber ohne Weiteres vorstellen. Glatt wie das Meer unmittelbar vor der Flutwelle. Doch jetzt habe nicht ich mich zu dieser Bemerkung erdreistet, sondern sein lieber kleiner Bruder. Deshalb erhebt sie sich nicht, die Welle, begnügt sich mit ein paar kleinen Wellenschlägen, die kalt über mich hinwegspülen, während ich vor seinen Füßen liege.
»Das kann man hoffentlich umtauschen?«
»Das weiß ich nicht«, sage ich und richte mich mit dem zusammengeknüllten Papier und dem schwarzen Seidenband in den Händen auf. »Danach habe ich nicht gefragt.«
»Wenn er es nicht haben will, kaufe ich es. Zum doppelten Preis«, kommt es von Ole-Stig. Nicht sonderlich umgänglich diesmal. Eher wie das warnende Knurren eines Hundes.
Gert dreht sich halb zu ihm um, und in diesem Augenblick scheint das Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum, den Kerzen und allem zu kippen.
»Ich behalte es«, sagt Gert und drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Danke, Schatz! Das ist ... nett von dir.«
Damit steht das Wohnzimmer wieder waagerecht, der Weihnachtsbaum wieder gerade, und der Kaffee scheint nicht mehr aus den Tassen zu laufen. Aber ich fühle mich noch immer so schief wie der Turm von Pisa, den zu besichtigen Touristen aus der ganzen Welt Eintritt zahlen.