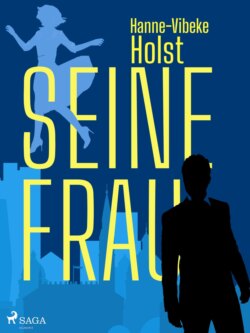Читать книгу Seine Frau - Hanne-Vibeke Holst - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIch schrubbe die Badewanne so verbissen, dass ich außer Atem komme. Das Email wird langsam alt, es ist schwer, die Ränder ganz wegzubekommen. Für die Fugen zwischen den Fliesen brauche ich eine alte Zahnbürste, die ich in Chlorid und Universalreiniger tauche. Trotzdem lässt sich der schwarzgrüne Schimmel, der sich dort sammelt, nur schwer entfernen. Sonst bin ich ziemlich geschickt im Saubermachen. Wenn es eine dänische Meisterschaft im Saubermachen gäbe, wäre ich unter den Favoriten. Dänische Meisterin im Hausputz. Das ist doch auch etwas. Eine Künstlerin hat einmal Abwasch ausgestellt. Männer finden so etwas provozierend. Genau wie die gebrauchten Damenbinden und die BHs und die verwaschenen Unterhosen, die die Emanzen in den Siebzigern ausgestellt haben. Was habe ich damals gedacht? Vermutlich das Gleiche wie Gert. Dass das ein paar verkrampfte Lesben sind, die einmal von einem Hafenarbeiter durchgefickt werden müssten. In diesem Punkt waren sie sich rührend einig, mein Vater und Gert. Der alte Max hat auch nicht verstanden, warum die Weiber sich so angestellt haben. Sie hatten es doch gut. Nur als sowohl meine Mutter als auch ich mit den anderen Carlsberg-Frauen an der großen Demonstration für gleichen Lohn auf dem Rathausplatz teilnahmen, wurden ihm in seinem Blaumann die Knie weich. Das war das einzige Mal, dass ich mich ihr verbunden gefühlt habe. Als wir da in der riesigen Menge gewöhnlicher Arbeiterfrauen nebeneinander standen und riefen: »Wir wollen den gleichen Lohn! Wir wollen den gleichen Lohn!«, bis wir heiser waren und der Vorsitzenden der Brauereiarbeiterinnen Beifall klatschten, die mit der Faust auf das Rednerpult schlug und erklärte, dass sie kein Abkommen unterschreiben werde, solange die Forderung nach gleichem Lohn nicht erfüllt sei. Ich kann mich noch an die Glut erinnern, die plötzlich in ihren Augen, den Augen meiner Mutter, aufflammte, und ich erinnere mich an ihre Stimme dicht neben mir, erst dünn und zögernd, dann laut und volltönend. An diesem Wintertag, 1971 war das, oder war es 1970?, haben sowohl sie als auch ich und die anderen fünfhundert Frauen zum ersten Mal ein Gespür für die gemeinsame Stärke bekommen, glaube ich. Dass auch wir das Boot steuern können, wenn wir zusammenhalten. Und dranbleiben.
Aber genau das haben wir nicht getan. Die meisten sind wie sie nach Hause zu ihren Männern gegangen und haben Frikadellen gemacht. Vielleicht hat sie an diesem Tag den Kartoffelbrei etwas lauter auf den Tisch geknallt, vielleicht ist sie sogar so weit gegangen, ihn zu bitten, die Senfgurken selbst zu holen. Doch ansonsten hat man die Politik der Gewerkschaft und den Aufruhr den lautstarken Emanzen überlassen, zu denen ich zur Freude meines Vaters nicht gehörte. Sie haben im Südhafen und bei Carlsberg auch nicht für ihre Sache geworben, soweit ich mich erinnere. Einige von ihnen haben eine Aktion gegen die Miss-Danmark-Wahlen gestartet, die sie als frauenfeindlich bezeichnet haben. Irgendwo gibt es einen Zeitungsausschnitt mit einem Foto von mir und einer Emanze, die ein indisches Tuch als Stirnband und eine große, runde Brille trägt. Ich habe falsche Wimpern, langes, blondes, in der Mitte gescheiteltes Haar und sehe aus wie eine Barbie-Puppe, und obwohl ich eine ordentliche, hochgeschlossene Bluse trage, erinnere ich mich daran, als hätte ich nur einen Bikini angehabt. Sie hat mich verunsichert, obwohl es das erklärte Ziel der Aktion war, »mit den Kandidatinnen der Miss-Danmark-Wahlen ins Gespräch zu kommen«. Hätte ich mich damals nicht so heruntergemacht gefühlt, wäre ich ihnen gegenüber vielleicht offener gewesen. Wäre ihnen vielleicht gefolgt und hätte den Sommer im Frauencamp auf Femø verbracht, statt in den Diskotheken der Westküste Go-go zu tanzen und den Hintern für geile Böcke zu schwingen, die so die Emanzipation der Pornografie feierten. Und vielleicht läge ich dann auch nicht hier auf meinen Knien in dem verbissenen Versuch, die abgestoßenen und lanolingefetteten Hautzellen eines Mannes aus einer Badewanne zu entfernen, die er nie auch nur ein einziges Mal selbst sauber gemacht hat. Vielleicht hätte ich dann keinen Mann geheiratet, für den das Gegenteil undenkbar wäre – dass er hinter mir sauber macht.
Womit ich nicht behaupten will, dass er neurotisch ist, was das Saubermachen angeht. Ich bin es, die sauber macht, um sich abzureagieren. Wenn ich nervös bin. Ängstlich. Und das bin ich jetzt, während ich warte, dass er vom Flughafen zurückkommt. Ole-Stig sitzt jetzt im Flieger, wenn sie on time sind. Seine Sprache hat auf meine abgefärbt, was Gert spitz kommentiert hat. »Es ist verständlich, dass Ole-Stig nach dreißig Jahren in den Staaten ein amerikanisiertes Dänisch spricht. Aber dass du auch diese Gewohnheit angenommen hast, kommt mir, ehrlich gesagt, ziemlich affektiert vor«, hat er gestern gesagt. Diese Gewohnheit muss ich mir also schnellstens wieder abgewöhnen. Bevor er nach Hause kommt. Falls er kommt, denn jetzt sind nur noch ich und die Skelette hier, die in den Schränken verstaut waren, während Ole-Stig hier war.
Dass jetzt Schluss ist mit – Entschuldigung – make believe, hat er mir bereits dadurch zu verstehen gegeben, dass ich nicht mit zum Flughafen kommen durfte. Er hat es mir selbstverständlich nicht direkt verboten, aber das ist auch vollkommen unnötig. Ich bin wie ein Hund, der auf das kleinste Fingerschnipsen reagiert. Ich bin so gut dressiert, dass ich selbst nach der Schaufel greife, um mir mein Grab zu schaufeln. Folglich habe ich auch mein Bedauern ausgedrückt, dass ich meinen Schwager leider nicht zum Flughafen begleiten kann. Ich habe nämlich so »furchtbar viel zu tun«, und uhh, macht sich da nicht wieder eine »Migräne« bemerkbar? Rücksichtsvoll, wie er ist, hat Ole-Stig nicht die Beine unter der dünnen Lüge weggetreten, mich nur auf die Wange geküsst und daran erinnert, den Geschenkgutschein einzulösen. Neben den vielen Weihnachtsgeschenken, die er mir gemacht hat, hat er mir auch eine »Neujahrsgabe« verehrt, mir einen Geschenkgutschein für eine Körpermassage gegeben. »Es dürfte dir guttun, dich ein bisschen verwöhnen zu lassen!«, hat er gesagt, doch sein schuldbewusster Ausdruck hat mir verraten, dass er genau weiß, dass es nicht dieses Verwöhnen ist, das mir fehlt. Vor Weihnachten hatte ich den bescheidenen Traum, dass wir miteinander reden könnten. Dass ich Gelegenheit haben würde, ihm mein Herz auszuschütten. Mir von einem vernünftigen Menschen versichern zu lassen, dass ich nicht verrückt bin. Doch die Gelegenheit hat sich nicht ergeben; Gert war ungewöhnlich viel zu Hause während des Besuchs seines Bruders, sodass wir mit Ausnahme des Vormittags, an dem Ole-Stig versprochen hatte, mir PC-Unterricht zu geben, eigentlich nie allein waren. Oder ist das nur eine Entschuldigung? Haben wir uns beide zurückgehalten, das Thema vermieden, die Konsequenzen gefürchtet, würde das Ungesagte in Worte gefasst? Oder irre ich mich? Bilde ich mir lediglich ein, dass sein großer Bruder mir Leid zufügt? Fällt überhaupt nichts auf? Wahrscheinlich ist es einfach so, dass Blut dicker ist als Wasser. Auch wenn er mir ein »Ich wünschte, ich könnte dich in die Tasche stecken und mitnehmen!« zugeflüstert hat, als Gert nach einem seiner Koffer griff. Das Gleiche habe ich einem kleinen, verkommenen Zigeunermädchen zugeflüstert, als ich einmal als die ihren Mann begleitende Mrs. Minister of Finance im Rahmen des Damenprogramms in der Tschechoslowakei ein Kinderheim besucht habe. Das hat auch nichts gebracht. Vom Standpunkt des Kindes aus war ich nicht besser als all die anderen wohlmeinenden Damen mit ihren Hüten und ihren guten Absichten. Und von Lindas p.o.v. aus betrachtet, dem point of view der Linda aus dem Südhafen, ist Ole-Stig nur ein Stück Scheiße. Um es einmal auf gut Dänisch zu sagen.