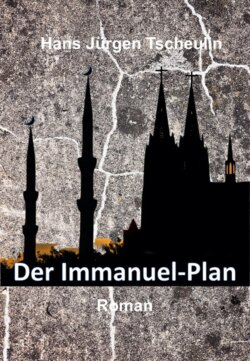Читать книгу Der Immanuel-Plan - Hans Jürgen Tscheulin - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14. Chemnitz (Deutsche Demokratische Republik), Juli 1990
ОглавлениеDer 38-Tonner bestand aus dem Zugfahrzeug mit einem Hebekran und einem Anhänger. Beide Ladeflächen konnte man mit Planen zudecken. Die Firmenaufschrift seiner Baustoffhandlung befand sich lediglich auf den beiden Fahrertüren. Der Weg nach Chemnitz war anstrengend, weil die Straßen in der früheren DDR in sehr schlechtem Zustand waren. Die Staatsorgane der DDR existierten noch immer, aber de facto und in den Augen der Bürger lebte man in einem undefinierten, grenzoffenen Zustand. Und seit Anfang Juni war Karl-Marx-Stadt von ihren Bürgern wieder in Chemnitz umbenannt worden. Neumeyer hatte schon bei seiner Entlassung aus Hohenschönhausen gespürt, welch ein Ruck durch die Menschen in der DDR gegangen war. Sie befreiten sich von ihren jahrelangen Fesseln und probten zum ersten Mal ihren Auftritt ohne die obligatorische Maske. Die Generalprobe wurde zur Premiere, denn Zeit, sich auf die neuen Verhältnisse einzurichten, bekamen die Menschen kaum. Vor einem Jahr begannen erste nennenswerte Proteste gegen die eigene Regierung, schließlich öffnete Ungarn völlig unerwartet die Grenzen nach Österreich. Man traute sich zu fliehen, obwohl noch wenige Monate zuvor an der Mauer ein Republikflüchtling zu Tode gekommen war. Die Menschen spürten den Stimmungswechsel, als wenn sich durch die kleine Grenzlücke in Ungarn das Virengift der Freiheit in rasendem Tempo über die gesamte Republik ausgebreitet hätte. Das Regime kollabierte einfach, ohne Staub aufzuwirbeln. Auch der letzte Sympathisant der Regierung witterte die Luft der Freiheit und ließ jegliche Gegenwehr erlahmen. Neumeyer genoss dieses unbegrenzte Reisen, allerdings konnte man auf den alten DDR-Autobahnen höchstens 80 km/h fahren. Mit Lastwagen war sogar nur eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h empfehlenswert, wenn man Schäden am Fahrzeug verhindern wollte. Der ehemalige Grenzübergang bei Hof in Bayern war seit einigen Monaten nicht mehr in Betrieb, aber alle ehemaligen Kontrollanlagen waren noch intakt. Besucher, die auf der Durchreise waren, hielten auf den Rastplätzen an und begafften die alten Anlagen der DDR. Wer weiß, vielleicht machte man daraus eines Tages ein Museum. Manchmal beschlich ihn ein seltsames Gefühl, wenn er daran dachte, dass es das Land und die Ideen, mit denen er groß geworden war, nicht mehr gab. Dass er vielleicht in einem Museum aufgewachsen war, ohne es zu ahnen. Freiheit war nicht nur angenehm. Sie konnte schmerzlich sein, weil niemand mehr da war, der die anderen verwaltete, auf sie Acht gab, ihnen sagte, was richtig und falsch war. Das vermisste er noch oft, gab es aber nicht gerne zu. Wie oft hatte er sich früher nach Freiheit gesehnt und in den kühnsten Träumen vorgestellt, wie es sein würde, einfach in Richtung Westen zu verreisen, solange und so oft man wollte? Aber wo waren die Grenzen der Freiheit? Wie frei war frei? Denn jetzt war jeder auf sich selbst zurückgeworfen, Fürsorge und Anleitung des Staates existierten im Westen nicht. Er verglich es mit Erwachsen werden. Ab einem bestimmten Alter übernahm man die Verantwortung für sich selbst. Das war ein langer Prozess, der mit Protest gegen das Elternhaus begann, weil die Psyche sich reiben musste, um zu einem Selbst zu reifen. Danach war man allein. Andere Gesellschaften hatten die Familie nie abgeschafft. Sie blieb die unveränderliche Konstante und der zentrale Fixpunkt für alle Angelegenheiten. Ungeschriebene Familiengesetze definierten die Grenzen der Freiheit. Unsichtbare Mauern und Maßstäbe bestimmen das Handeln. Aber wie sollte sich ein Gemeinwesen, das in idealer Freiheit existierte, organisieren? Das war noch einfach zu beantworten. Man erfand das demokratische Prinzip. Die Diktatur wich der freien Vereinbarung. Freiwillig ordnete man sich mehrheitlich ausgewählter Normen und Gesetzen unter. Aber wer gab dem einzelnen, freien Individuum seine Orientierung? Die Familie? Eine Religion? Irgendeine Weltanschauung? Freiheitliche Gesellschaften konnten sich nicht freisprechen von der Verantwortung, ihren Bürgern auch eine ethische Grundwertebasis zu vermitteln, damit das Handeln und Verhalten der Menschen untereinander fair, tolerant und menschenwürdig ablief. Das war aber der klare Schwachpunkt in der BRD, die sich zwar zum christlichen Abendland zählte, in der aber die Herausformung der ethisch-moralischen Grundlagen eher der Straße und den Medien überlassen wurde. Das barg das Potenzial des zukünftigen Scheiterns. Vielleicht erst nach der zweiten oder dritten Generation. Die Freiheit wurde nicht genutzt, um zu lernen, wie ein Gemeinwesen und eine Gesellschaft sich entwickeln. Und es würde in wenigen Jahren so viele individuell unterschiedliche Glücksvorstellungen geben, wie es Menschen gab. Sie würden in naher oder ferner Zukunft gänzlich unvereinbar aufeinanderprallen. Jeder gebar seine eigene Religion. Plötzlich raubte niemand mehr einem anderen die Freiheit, sondern stand ihm im Weg bei der Erfüllung der individuellen Glückswünsche. Falsch verstandene Selbstverwirklichung führte zur Diktatur des Individuums, dem seine eigene Entwicklung wichtiger wurde, als das Überleben seines Gemeinwesens. Freiheit wurde im Westen begriffen als Freiheit von der Verantwortung für die Gesellschaft. Die Menschen postulierten ihre divergierenden Partikularinteressen, die allesamt auf eine Fixierung und Maximierung des individuellen Glücks hinwiesen. Mitten in diesen Gedanken huschte eine Hinweistafel an dem Lastwagen vorbei, die Neumeyer aufschrecken ließ. Oberfrohna hieß die Ortschaft, in der die Lagerhalle mit dem Transportgut lag. Er kannte sich in der Gegend noch aus, da er oft in Chemnitz zu tun hatte. Am Schlimmsten war es früher im Winter, wenn alle Haushalte und Industriebetrieb mit Braunkohle heizten. Dann hüllte sich die Gegend in einen ätzenden und rauchigen Nebel, der säuerlich roch. Der färbte die Gebäude mit der Zeit braun. Jetzt fuhr er an verlassenen Häusern vorbei, Fensterscheiben waren eingeschlagen. Er fand schnell das Ortszentrum und bog in die Burgstädter Straße ab. Nur selten begegneten ihm andere Autos. Das Industriegebiet, das vor ihm lag, sah verlassen aus. Zielstrebig fuhr er vor die Halle einer ehemaligen Textilfabrik. Auf dem großen Platz drehte er den Lastzug, sodass er rückwärts in die Halle stoßen konnte, wenn das Tor offen war. Das Schiebetor zur Halle war verschlossen. Kein Schloss und kein Griff waren sichtbar, um es zu öffnen. Er wusste, warum. Deshalb hielt er sich genau an die Anweisungen. Auf der linken Seite der Halle lagen Schutthalden und viele rostige Fässer, die einmal grün lackiert waren. Er kletterte darüber hinweg. Nach ungefähr zehn Metern klopfte Neumeyer mit dem Griff eines Schraubenziehers an die verwitterten Ziegelsteine der Seitenwand. Plötzlich klang es hohl. Eine Attrappe, aber täuschend echt. Man konnte den Unterschied zu echten Ziegelsteinen nicht erkennen, selbst wenn man direkt davorstand und den Trick kannte. Er drückte kräftig dagegen. Eine künstliche Tür von zirka 30 Zentimeter Breite schwang auf und gab den Blick frei auf einen Ein-Aus-Schalter und ein Zahlenfeld mit zwölf Tasten. Er legte den Schalter auf „Ein“ um und gab eine zwölfstellige Zahlenkombination ein, die er von einem Zettel ablas, den er seiner Geldbörse entnommen hatte. Nachdem alle zwölf Zahlen korrekt eingegeben waren, summte irgendwo ein Mechanismus los, der das große Schiebetor öffnen würde. Er kletterte zurück und schaute in den Spalt, der sich immer weiter auftat, als die Schiebetür aufschwang. Erstaunt stellte er fest, dass die Tür mindestens 30 Zentimeter dick war, das Gewicht musste unvorstellbar sein. Trotzdem glitt sie leise und ohne Ruckeln zurück. In der Halle gingen Neonlampen an. Jetzt fiel ihm auf, dass die Halle keine Fenster besaß. Entlang der linken Hallenwand standen sauber aneinandergereiht 36 Paletten mit roten Ziegelsteinen. Die Steine auf jeder einzelnen Palette waren mit Eisenbändern gesichert und mit dicker, transparenter Folie verschweißt. Er sprang in das Fahrerhaus seines Lastwagens und setze den Lastzug und den Hänger vorsichtig in die Halle zurück. Leise schloss sich das Schiebetor bereits wieder. Neumeyer ließ die Beine aus dem Führerhaus baumeln, beugte sich zurück und holte eine Plastiktüte aus dem Handschuhfach. Sein Essen. Er hatte es völlig vergessen, während der Anspannung der letzten Stunden. Es war jetzt kurz nach zwanzig Uhr abends. Nach dem Aufladen, was schätzungsweise zwei Stunden dauern würde, hatte er vor, zu schlafen. Um fünf Uhr morgens wollte er wieder starten.