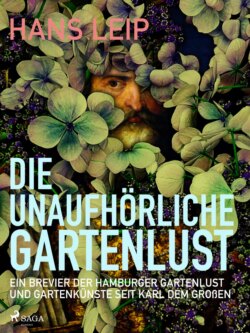Читать книгу Die unaufhörliche Gartenlust - Hans Leip - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wesen und Anwesen
ОглавлениеSeit je haben wohlhabende Städter Neigung gespürt, verschuldete Bauernhöfe zu erwerben und sie für ihre Sommerfreuden herzurichten. Den nahrhaften Betrieb überließ man gewöhnlich einem Pächter, ließ für diesen das alte Strohdachhaus stehen und setzte ein bequemes Landhaus daneben. Solches geschah in Hamburg zuerst an der Bille und an der Elbe oberhalb der Stadt.
Die Häuser waren anfangs in Fachwerk errichtet, oft noch mit Reet, später mit Pfannen gedeckt, mehrstöckig, mit steilem Kreuzdach, die vier Giebel über den First verlängert, die Spitzen mit Geknaufe verziert. Die Fenster waren vorerst Butzenscheiben. Um in der Einsamkeit sicherer zu sein, umgab man den Besitz an der Landseite gern mit Planke und Wassergraben, fügte auch manchmal, in Anlehnung an die holsteinischen Rittergüter, eine Zugbrücke hinzu.
Ein Gärtnerhaus mit Stallung schloß sich an; denn Wagen und Pferde mußten untergebracht werden, und der Garten bedurfte der fachmännischen Pflege. Ein zierliches Laubenzelt, Treibhäuser und Orangerien fügten sich ein, und bald überwog die Kunst die Natur. So, in den weiten Marschenwiesen erhoben sich die sonderbaren Oasen der Städter und dehnten sich auch bald auf den Geestrücken aus, der von Oben Borgfelde über Hamm und Horn gen Bergedorf führt.
Man nannte solch ländliches Gartengrundstück ein „Wesen“, und das war in einer Zeit, da dieses Wort noch den alten Sinn des „Innewohnenden“ hatte. Heute sagt man „Anwesen“ oder „Gewese“. Es scheint damit die innere Beziehung zu derartigen Gartenbesitzungen dem Worte nach veräußerlicht und, wenn auch kaum bewußt, vergangenheitlicht zu sein, was an der wachsenden Zwiespältigkeit des menschlichen Befindens auch in anderen Beziehungen zum Dasein seit Mitte des vorigen Jahrhunderts erkennbar wird.