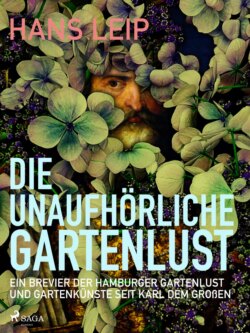Читать книгу Die unaufhörliche Gartenlust - Hans Leip - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dennoch die Mönche
ОглавлениеAurelius Augustinus soll an verschiedenen Orten zwischen Karthago und Mailand einen Garten besessen und geliebt haben, der dem fränkischen Hofe vorgeschwebt haben muß, als von dort etwa 785 die berühmte Verordnung für die Meierhöfe und auch geistlichen Gutsbetriebe, das Capitulare de villis, die gärtnerische Entwicklung diesseits der Alpen einleitete. Es war dabei nicht an Ziergärten gedacht. Alle Gärten waren zuerst Arzneigärten, und was uns heute zu seelischer Stärkung erfreut, Rosen, Iris und Lilien, Ringelblume und Gretl im Busch, es gehörte anfangs wie Malve, Veilchen und Mohn, Salbei, Raute, Diptam, Liebstöckel, Majoran, Thymian und Knoblauch in den Bereich der körperlichen Heilspflege.
Schon um 900 hatten sowohl in St. Gallen als Winchester die Klöster ihr „Sakristansgärtlein“, bei den Karthäusern gab es eigene Zellengärtlein, die Benektiner brauten einen Magentropfen aus neunerlei Kräutern, und von den Mönchen lernten die Schloßfrauen, in einer Ecke des Burghofs die Grundlagen zu ziehen für Salben, Heiltränke und Pflaster, die bei dem robusten Handwerk ihrer Männer unentbehrlich waren.
Und zu Bingen, um 1150, die Äbtissin Hildegard, die klügste Frau ihres Jahrhunderts und von allen Musen gesegnet, dazu die erste deutsche Naturforscherin und Ärztin, beschrieb in ihrer „Physica“ schon Akelei, Alpenveilchen, Christrose, Königskerze, Lupine, Pfingstrose und Primel.
In unseren Gefilden aber verzweifelte, hundert Jahre vor ihr, der große Adalbert, der ein Papsttum des Nordens aufzurichten gedachte, am Klima. Er hatte allerdings vor, auf dem Süllberg, dieser alten Meeresdüne zu Blankenese, nicht nur Burg und Kloster, sondern auch einen Rebgarten anzulegen, um den Abendmahlswein selber zu züchten.