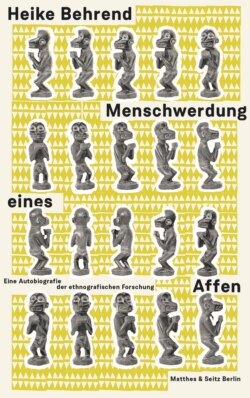Читать книгу Menschwerdung eines Affen - Heike Behrend - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеMitte der 1970er-Jahre fuhr ich nach Paris und lernte dort Jean Rouch kennen. Rouch, Schüler von zwei Marcels, Marcel Mauss und Marcel Griaule, hatte sich aufs ethnografische Filmemachen verlegt. Anfangs sowohl von etablierten Filmemachern wie auch Ethnologen als Außenseiter und Spinner marginalisiert, nahm er sich die Freiheit, gegen die akademische Textzentriertheit mit dem Medium Film und neuen ethnografischen Praktiken zu experimentieren. In Opposition zu kolonialen asymmetrischen Methoden entwickelte er eine »geteilte Ethnografie«, ein filmisches Unternehmen, das die Bilder und Töne, die er in Afrika vor allem von Besessenheitsritualen aufgenommen und in Paris montiert hatte, nach Afrika zurückbrachte. In der »Ciné-Trance«, einer mimetischen Praxis, teilte er die Trance und Besessenheit, die Überwältigung durch fremde Mächte, mit den Gefilmten. Gegen die szientistische Selbstermächtigung des Ethnografen, der im Feld zu handeln vermeint, rückte er die andere Seite des Handelns, nämlich das Erleiden des Handelns anderer, das Behandelt-Werden, in den Vordergrund. Wie sich in Besessenheitskulten Geister in ihren Medien verkörpern, so ließ sich Rouch von der Praxis der Geistbesessenheit der Ethnografierten ergreifen. Gerade die kinematografische Technik, die Verschaltung seines Körpers mit der Kamera, erlaubte ihm, sich fremden Geistern auszuliefern und eine reziproke Ethnografie zu praktizieren, die sich durch transkulturelle Feedbacks immer wieder selbst korrigierte.
Rouch praktizierte auch eine »verkehrte« Ethnografie. In seinem berühmten Film Les maîtres fous von 1956 zeigt er das jährliche Ritual der Hauka, kolonialer Fremdgeister, »der Geister der Macht und des Windes, die den Wahnsinn bringen«. Im Zustand der Besessenheit verkörpern die Mitglieder des Kultes die »Geister der Kolonialgesellschaft«, des »Gouverneurs«, der »Lokomotive« oder der »Frau des Doktors«. Im Ritual entwerfen sie ihre Ethnografie der westlichen (kolonialen) Kultur. Der Film ist also zugleich doppelte und umgekehrte Ethnografie: gefilmte Ethnografie sowie die Ethnografie der Gefilmten, die uns den Spiegel vorhalten und uns zeigen, wie sie uns sehen.
Auch in seinem späteren Film Petit à Petit aus dem Jahr 1969 behandelte Rouch das Thema des umgekehrten Blicks und die Gewaltsamkeit ethnografischer Methoden. Er zeigt einen afrikanischen Ethnografen in Paris, der dort eine Feldforschung über die »Pariser Wilden« und ihre Probleme beim Wohnen in Hochhäusern durchführt. Durch die Vertauschung von Subjekt- und Objektpositionen finden die ethnografischen Methoden bei denen Anwendung, die sie entwickelt haben. Durch die Umkehrung der Perspektive, die die Europäer zum Objekt der Feldforschung macht, kann der westliche Ethnograf erkennen, was es heißt, ethnografische Methoden erleiden zu müssen.
Rouchs ethnografische Filmarbeit beeindruckte mich so stark, dass ich 1977 mit Ulrich Gregor, damals Leiter des Berliner Kinos Arsenal und der Freunde der deutschen Kinemathek, eine erste Retrospektive seiner Filme in Berlin organisierte und 1980 eine Ausbildung an der Deutschen Film- und Fernsehakademie begann, die ich 1984 abschloss.