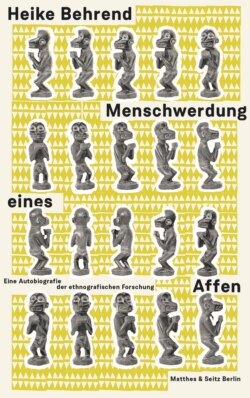Читать книгу Menschwerdung eines Affen - Heike Behrend - Страница 17
5
ОглавлениеIn Kabarnet stiegen mein Sohn und ich in ein Matatu, ein sogenanntes Buschtaxi, das uns nach Bartabwa bringen sollte. Es war ein uralter klappriger Jeep mit durchlöchertem Boden; wenn er sich, vollbepackt, auf der holprigen, von großen Kratern durchzogenen Straße nach rechts oder links neigte, sprang die jeweilige Seitentür auf. Die Räder waren, wie sich auf der Fahrt herausstellte, nicht ordentlich befestigt: Schrauben fehlten. Wir hatten die sichersten Plätze, saßen neben dem Fahrer vorne in der Mitte und konnten, wenn die Türen sich öffneten, nicht hinausfallen. Der Mann rechts neben mir versuchte mit einer Hand die Tür geschlossen zu halten und streckte immer wieder den Kopf aus dem Fenster, um das Vorderrad zu beobachten und den Fahrer rechtzeitig zu warnen. Es lockerte sich tatsächlich, wir hielten an, und der Fahrer wechselte es gegen ein anderes aus, das jedoch auch nur mit drei Schrauben befestigt wurde. Wir fuhren weiter, bis auch dieses Rad sich löste.
Trotz der Pannen war die Stimmung unter den Fahrgästen hervorragend. Sie scherzten, erzählten Witze und gaben den übrig gebliebenen Schrauben die Namen berühmter Krieger, die besonders tapfer gewesen waren – vielleicht in der Hoffnung, dass die Schrauben sich nun auch als tapfer und widerständig erweisen würden. Doch die Namensgebung half nicht, es gab kein weiteres Ersatzrad. Wir blieben auf der Strecke. Nach etwa drei Stunden kam ein anderes Matatu angefahren und nahm uns mit nach Bartabwa. Dort angekommen stiegen wir aus. Wir waren Besucher, die nicht eingeladen waren. Wir waren Fremde, die zu Gästen gemacht werden mussten.
Ich hatte damals keine Ahnung, ob überhaupt und wenn ja, wie viel meine Forschungsgenehmigung wert war und inwieweit sie Schutz und Unterstützung bedeutete. Ich wusste nur, dass mein erster Ansprechpartner der Vertreter des Staates, der Häuptling, war. Wir suchten sein Büro in der Hauptstraße auf; ich zeigte meine Forschungsgenehmigung vor, und der etwas überraschte, aber freundliche Häuptling stellte nach kurzer Überlegung meinem Sohn Henrik und mir eine leer stehende, etwas verfallene Hütte zur Verfügung. Henrik, damals sieben Jahre alt, war ein antiautoritär erzogenes Berliner Kinderladenkind, offen, neugierig und rotzfrech. Da Bartabwa bis dahin nur von erwachsenen Europäern, vor allem katholischen Missionaren, besucht worden war, avancierte er zu einer exotischen Sehenswürdigkeit. Von weit her kamen die Bewohner der Berge, um ihn zu betrachten. Henrik half in den kleinen Geschäften und lockte Kunden an; er bewachte mit den anderen Kindern die Maisfelder, hütete Ziegen und Schafe, lernte mit Keulen werfen und hantierte – wie Tarzan – mit Pfeil und Bogen. Er wurde mit Gaben überschüttet, bekam sogar eine Ziege geschenkt. Im Gegensatz zu mir lernte er die lokale Sprache in Windeseile und erzählte mir abends Klatsch und Tratsch. Wie in den Tugenbergen üblich wurde er nicht nach mir, sondern ich nach ihm »Mama Henry« genannt.
Wie ich später lernte, erhalten Frauen und Männer im Lauf ihres Lebens viele verschiedene Namen. Das rituelle Geben von Namen ist eine (auto-)biografische Praxis. Kurz nach der Geburt bekommt ein Kind in einem »kleinen« Ritual den Namen eines Ahnen. Vorher finden die Ältesten in einem Orakel den Ahnen heraus, der »ein gutes Leben führte« und bereit ist, dem Kind seinen Namen zu geben. Jede Lineage verfügt nur über eine bestimmte Anzahl von Namen, die unter den Angehörigen, den Toten und den Lebenden, zirkulieren; neue Namen gibt es nicht. Die Namen sind dauerhafter als die Menschen, die sie tragen. Und sie verpflichten: Ein Kind erhält im Namen als Zukunft die Vergangenheit eines und damit vieler Vorfahren. Es lebt in gewisser Weise in umgekehrter Richtung, denn es muss dem Namen des Ahnen gerecht werden, sein Leben nach ihm ausrichten, es wiederholen. Doch ist der Ahne, dessen Name so übermächtig das Leben seines Nachkommen bestimmt, tot. Sein »Leben« gehört den Lebenden, sie können es biegen und zu eigenen Zwecken nutzen. Erweist sich die Beziehung zwischen Kind und Ahne als unglücklich, wird der Ahne ausgetauscht. Er muss sich als der Richtige beweisen, indem er das Wohlergehen des Kindes garantiert. Gelingt ihm das nicht, so wird sein Name abgeschafft und vergessen und ein anderer Vorfahre muss mit seinem Namen herhalten.
Während Frauen dem Kind den ersten Namen gaben, erhielt es einige Jahre später von Männern einen zweiten, den »Ziegennamen«, benannt nach der Ziege, die das Kind geschenkt bekommt. Manchmal setzte sich im Lauf des Lebens der Name durch, den die Frauen gegeben hatten, manchmal der Ziegenname. Es kam aber auch vor, dass das Kind auf beide Namen hörte; dann riefen es die Frauen mit dem Namen, den sie ihm gegeben hatten, und die Männer benutzten den Ziegennamen.
Doch gaben Eltern mitunter ihren Kindern zusätzlich noch einen dritten Namen, der an ein Ereignis erinnert, das während der Geburt stattfand. Zahlreiche Kinder hießen zum Beispiel Kemei, »Hunger«, weil zur Zeit ihrer Geburt der Hunger herrschte. Ein Kind wurde Chumba, »Europäer«, genannt, weil es geboren wurde, als ein Europäer anwesend war. Ich traf auch ein Kind, das »Löffel« hieß, weil seine Eltern am Tag der Geburt zum ersten Mal einen Löffel sahen.
Während die Ahnennamen das Kind als Wiederholung in die Genealogie eingliedern, betonen die Ereignisnamen (so wie Spitznamen) eher seine Einmaligkeit und Individualität, Eigenschaften, die es auszeichnen, die aber auch – im Gegensatz zu den Ahnennamen – mit seinem Tod verschwinden.