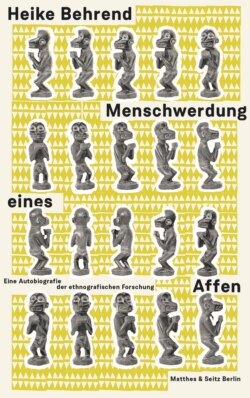Читать книгу Menschwerdung eines Affen - Heike Behrend - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAm Berliner Institut für Ethnologie galt die ethnografische Feldforschung als absolutes Muss. Unsere großen Vorbilder waren Bronisław Malinowski (trotz oder gerade wegen des Skandals um die Veröffentlichung seines Tagebuchs 1967), Edward E. Evans-Pritchard, Geoffrey Lienhardt und Jean Rouch. Die Feldforschung als teilnehmende Beobachtung hatte den Status einer doppelten Initiation, nicht nur in eine fremde Gesellschaft, sondern auch in die Gemeinschaft der Berliner Ethnologen. Sie war der zentrale Passage-Ritus mit seinen drei Phasen, wie sie Arnold van Gennep beschrieben hat: das Verlassen der eigenen Welt, der Aufenthalt in der Fremde als liminale Phase und die Rückkehr.3
Da ich bereits Mann und Kind hatte, waren es vor allem praktische Gesichtspunkte, die zur Auswahl der Tugenberge im Nordwesten Kenias als Forschungsterrain führten. Die Tugenberge, eine Gebirgskette, die sich bis in 2000 Meter Höhe in Nord-Süd-Richtung erstreckt, gehören zum Großen Afrikanischen Grabenbruch, dem Rift-Valley. Dort oben gab es keine Malaria, aber für alle Fälle eine Krankenstation in nicht zu weiter Ferne.
Dieses karge und nicht besonders fruchtbare Gebirge hatte schon im 19. Jahrhundert vielen Menschen als Rückzugs- und Zufluchtsort gedient. Die Bewohner nannten es »Land der Steine« und erzählten, dass ihr Gott, als er die Berge erschuf, schon so müde gewesen sei, dass er nur noch Steine auf die Erde habe werfen können. Das Land war so arm, dass es relativ unbehelligt blieb, als Kenia Siedlungskolonie wurde und aus Großbritannien und Südafrika Siedler ins Land strömten, um sich die fruchtbaren Regionen anzueignen. Während in der Zentralprovinz die Menschen brutal von ihrem Land vertrieben, enteignet und in Reservate gezwungen wurden, konnten die Bewohner der nördlichen Tugenberge ihr karges Land behalten.
In den 1970er-Jahren umfasste die Bevölkerung etwa 120 000 Menschen, die weit verstreut in einzelnen Gehöften in den Bergen lebten. Sie bauten Mais und Hirse an und hielten Ziegen, Schafe und Rinder. Von allen Tieren schätzten sie vor allem das Rindvieh. Sie setzten – wie die berühmten Nuer im Sudan – eine »Rinderästhetik« ins Werk, mit der sie die Schönheit ihrer Bullen und Kühe im Tanz und in poetischen Lobgesängen zum Ausdruck brachten. Hätten die männlichen Bewohner der Berge mich eine »Kuh« genannt, wäre das ein großes Kompliment gewesen, beinahe eine Liebeserklärung. Leider raubten ihnen die Pokot, ihre Nachbarn im Norden, regelmäßig ihre wertvollen, hochgeschätzten Rinder und nannten sie verächtlich »Ziegenleute«.
Alle paar Jahre suchte außerdem eine verheerende Dürre die Region heim. Wenn die Situation unerträglich wurde und »Menschen und Tiere vor Hunger und Durst umfielen«, verließen Männer und Frauen mit ihren Kindern die Gehöfte und zogen in die Wildnis, um dort zu jagen und zu sammeln. Kam der Regen, kehrten sie in ihre Häuser zurück.
In vorkolonialer Zeit waren die Bewohner akephal, hatten also keinen Häuptling, stattdessen eine gerontokratische Organisation in acht Altersklassen, deren Namen nach etwa 100 Jahren, wenn ein Kreislauf vollendet war, wiederkehrten. Alte Männer und Frauen herrschten über junge Männer und Frauen. Solange sie Kinder bekamen, waren Frauen von der Politik ausgeschlossen. Nach der Menopause erlangten sie jedoch den Status von rituellen Ältesten und waren den alten Männern gleichgestellt.
Während der Kolonialzeit verloren männliche und weibliche Älteste weitgehend ihre Macht an mehr oder weniger despotische Häuptlinge, die zunächst von der britischen Kolonialverwaltung und später, ab der 1963 erlangten Unabhängigkeit, vom postkolonialen Staat eingesetzt wurden. Meist lehnte die lokale Bevölkerung die Häuptlinge ab. Diese trieben Steuern ein, sprachen Recht und versuchten die Belange des Staates durchzusetzen. Außerdem verfügten sie über finanzielle Ressourcen und bestimmten, wer in Hungerszeiten Maismehl aus den Hilfsprogrammen erhielt.