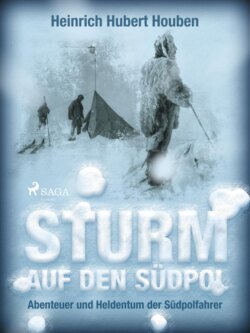Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der erste Ringkampf mit dem Polareis
ОглавлениеD’Urvilles Aufgabe ist nicht beneidenswert. Er soll nicht frischweg möglichst weit zum Südpol hinunterfahren, da, wo er durchzukommen hofft. Solch einem Experiment darf er die beiden Schiffe gar nicht aussetzen, denn sie haben noch andere grosse Aufgaben wissenschaftlicher und handelspolitischer Art, genau so wie die amerikanische Expedition. Der berühmte Physiker Arago hat am 5. Juni 1837 in der französischen Deputiertenkammer heftig protestiert gegen alle Polarreisen, deren Hauptzweck die Erreichung des Südpols sei, und die Akademie der Wissenschaften hat sich daraufhin geweigert, die neue Expedition mit fachmännischen Instruktionen zu unterstützen! Für eine richtige Polarfahrt sind die Schiffe nur notdürftig und Hals über Kopf ausgerüstet, sie sollen ja nur feststellen, ob die vier Reisewege Weddells zwischen dem 50. und 30. Grad westlicher Länge, zweimal hin, zweimal zurück, auch jetzt noch so eisfrei sind, wie sie 1823 gewesen sein müssen, wenn der englische Walfänger nicht ebenso geschwindelt hat wie sein amerikanischer Kollege und Freund Morrell. Der ganze Auftrag zeigt, dass man von den ungeheuren und unberechenbaren Veränderungen der Polareismassen nur erst eine laienhafte Vorstellung hat. In die Antarktis macht man keinen „Abstecher“ im Vorübergehen, sie verlangt von einer wissenschaftlichen Expedition den Einsatz eines ganzen Unternehmens, wenn sie zuverlässige Ergebnisse mitbringen soll. Obendrein traut d’Urville den Angaben Weddells nicht; findet er dessen Wege jetzt durch Eis versperrt, so erscheint sein Misstrauen gerechtfertigt. Aber lohnt diese negative Feststellung die Anstrengungen und Gefahren eines Kampfes mit dem Polareis? Denn selbstverständlich muss die Expedition ihr Äusserstes tun und alle Möglichkeiten erschöpfen, ehe ihr Führer mit ruhigem Gewissen, wie ehemals Cook, der Welt sagen kann: „Nec plus ultra!“ „Weiter zu kommen war einfach unmöglich!“ Es wäre natürlich ein grosser Triumph für Frankreich, wenn es gelänge, auf den vorbezeichneten Wegen den Rekord Weddells zu überbieten, und d’Urville würde von Herzen gern bis zum 80. Grad und noch weiter stracks zum Südpol fahren, aber er glaubt an diese Möglichkeit nicht. An Erfolg und Sieg aber muss man glauben, sonst sind Arm und Hand gelähmt. Ist jemals ein Polarforscher in so resignierter Stimmung auf Fahrt gegangen?
Die beiden Schiffe verlassen am 8. Januar 1838 die Magellanstrasse. Auf dem Flaggschiff „Astrolabe“ hat d’Urville auch seine beiden ersten Weltreisen gemacht; sein Freund und früherer Reisegefährte Kapitän Jacquinot kommandiert das Begleitschiff „Zelée“. Der Tüchtigste im Offizierstab ist der Seeingenieur Vincendon Dumoulin. Die Mannschaft ist dem Führer völlig fremd; von seinen früheren erprobten Begleitern hat auch nicht einer mitgehen wollen. Die Antarktis kennt noch keiner von der ganzen Besatzung.
Am 12. Januar verschwindet die Staaten-Insel, östlich von Kap Hoorn, am Horizont. In Nebel und Regen steuert d’Urville nach Südosten. Drei Tage später schwimmen die ersten Eisberge heran, erst kleinere Trümmer, dann mächtigere Blöcke von 40 Meter Höhe und 60 Meter Länge, die im brodelnden Nebel wie ungeheure graue Segel auftauchen und unheimlich nahe vorüberziehen, die Vorhut des zu bekämpfenden Feindes, an dessen Anblick sich die Mannschaft erst gewöhnen muss. Die Hauptgefahr aber ist zunächst der Nebel, der vom Meere aufsteigt und sich zu einer weissen Wolkenschicht darüber zusammenballt; oft sieht der Mann in der Ausgucktonne nur die Mastspitze des Begleitschiffes über dem Nebelmeer emporragen; verschwindet auch sie, dann muss man sich durch Kanonenschüsse verständigen. Hört alle Sicht auf, dann müssen die Schiffe beilegen, denn die Eisberge werden immer zahlreicher und gewaltiger. Die Wache, die den kleinsten Eisblock zu melden versäumt, muss doppelt langen Strafdienst tun, was bei der zunehmenden Kälte kein Vergnügen ist. Reisst der Nebel plötzlich, dann enthüllt sich ein phantastisches Bild. Die Gipfel der hohen Eisinseln umflattern Schwärme weisser Sturmvögel; an den steilen Abhängen aber stehen wunderliche Gestalten, ernst wie würdevolle Stiftsherren auf den Chorstühlen einer Kathedrale, mit vorn weisser, hinten schwarzer Robe, oder auch wie Soldaten, die regungs- und lautlos vor ihrer Festung auf Posten stehen; es sind Pinguine mit hocherhobenem Kopf und stramm angelegten Flügeln; sie begrüssen die näherkommenden Schiffe mit heiserm Geschrei, stürzen sich wie auf Kommando ins Wasser und tummeln sich pfeilschnell um Heck und Bug. Manche dieser Inseln sind Tausende von Metern lang, tafelförmig mit wilddurchfurchten Seiten, die bei flüchtigem Sonnenblick in allen Farben des Regenbogens leuchten. Eine von ihnen gleicht einer ungeheuren Turmruine, deren Inneres, von den Wellen ausgehöhlt, azurblau erstrahlt; ein Teil des Gemäuers ist mit blendendweissem Schnee bedeckt, der andere schmutzig braun vom Kot der Vögel; an einer Stelle aber ist ein richtiger Felsblock deutlich erkennbar. Er muss von irgendeiner Küste im Süden stammen. Ist etwa Land schon in der Nähe? Eine unabsehbare Kette von Eisbergen zwingt die Schiffe am 20. Januar, nach Nordosten auszuweichen; dann stossen sie wieder nach Süden vor und erreichen am 21. auf 62° s. B. bereits den Meridian, auf dem Weddell von seiner zweiten, so erfolgreichen Fahrt zurück nach Norden segelte. Die Sonne hat mit dem Nebel aufgeräumt; ein strahlend heller Tag; von Eis ist fast nichts mehr zu sehen, und nach Süden dehnt sich unermesslich weit das rätselhafte Polarmeer. Die Matrosen jubeln, denn auf Erreichung einer hohen südlichen Breite sind von Grad zu Grad sich steigernde Geldpreise ausgesetzt. Auch der Kommandant ist in freudiger Erregung. Hat Weddell am Ende doch recht gehabt? Ist hier der Weg zum Pol offen? Soll wirklich der Expedition das Glück beschieden sein, bis zum 74. Grad — vielleicht noch weit darüber hinaus zu kommen? Warum denn nicht? Die See ist ruhig, der Wind günstig, nirgends zeigt sich die Spur eines ernstlichen Hindernisses. Seit gestern ist d’Urville nicht aus der Steuermannshütte gewichen; nach achtzehnstündigem Dienst legt er sich am Abend dieses Tages voll stolzer Hoffnungen zur Ruhe. Morgen mittag schwimmen die Schiffe mindestens schon auf dem 65. Grad, über den auch Weddell auf seiner ersten Fahrt nicht hinaus kam; wann werden sie seine beiden Nussschalen überholt haben?
Mitten in der taghellen Nacht Alarm auf Deck. D’Urville schreckt aus dem Schlafe auf und eilt nach oben. „Festes Eis in Sicht!“ brüllt ihm die Wache entgegen. Im Süden, kaum drei Kilometer entfernt, zieht sich eine ununterbrochene Eisküstenlinie von Ost nach West quer über den Weg, ein unendliches, überall den Horizont abschneidendes Feld von Packeis, das eine unwiderstehliche Elementarkraft zusammengeschoben, emporgeschraubt, übereinandergetürmt und ineinander verkeilt hat. Über dieser chaotischen Masse ragen zahllose hohe Eisberge empor wie unförmige Gebäude aus weissem Marmor. Die Kante dieser Eisdecke ist eine glatte Mauer von 4 bis 5 Meter Höhe, nur hier und da ein wenig angebröckelt und zersplittert, und an ihrem Fuss steht eine schäumende Brandung, die schwere Eistrümmer wie leere Konservenbüchsen ansaugt und wieder zurückschleudert. Ein Anblick über allen Ausdruck ernst und grossartig, erschreckend zugleich und niederschmetternd. Mit einem Schlag sind alle stolzen Hoffnungen von gestern zuschanden! Hier durchkommen zu wollen, wäre Wahnsinn — das sofortige sichere Ende der ganzen Expedition! Und hier will Weddell ohne jedes Hindernis heraufgesegelt sein? D’Urvilles Zweifel waren offenbar nur allzu berechtigt! Mit den drei anderen Fahrstrassen wird es nicht besser stehen! Gleichviel, sie müssen versucht werden.
Die Schiffe folgen der Eiskante nach Osten. Bald ist auch hier der Weg verbaut. Zurück nach Norden! Um die Spitze einer weit vorspringenden Eishalbinsel herum öffnet sich wieder eine freie Bahn nach Süden. Es ist nur eine ungeheure, nach Westen offene Bucht, deren Eisküste sie in weitem Halbkreis wieder nach Norden führt. An ihrem östlichsten Punkt scheint die Eismasse in Auflösung begriffen; nicht weit von hier ist Weddell auf seiner ersten Fahrt nach Süden bis zum 65. Grad entlanggekommen. Wenn sich hier durchbrechen liesse! D’Urville wagt es als erster in der Geschichte der antarktischen Forschung, den Kampf mit dem Packeis aufzunehmen. Am 24. steuern die Schiffe in schmale Wasserarme hinein; 10 Kilometer weit tasten sie sich langsam vorwärts, dann poltern und drängen die Eisschollen gegen den Bug, die Wasserkanäle werden schmäler und schliessen sich so schnell, dass die Kapitäne kaum Zeit haben, zu wenden. Die Mannschaft ist durch die Manöver der letzten Tage so erschöpft, dass der Kommandant sich entschliessen muss, in einem Wasserbecken, das er noch eben erreicht, im Schutz von drei hohen Eisbergen einige Stunden beizulegen, auf die Gefahr hin, rettungslos eingeschlossen zu werden. Das Glück ist ihm günstig: am frühen Morgen des 25. befreit ein kräftiger Ostwind, der das Eis auseinandertreibt, die Schiffe aus ihrem Gefängnis. Bei Sonnenaufgang schwimmen sie wie in den Strassen einer zerfallenen Marmorstadt mit weissen Palästen, Kirchen, Turmspitzen, Säulenhallen und Brücken; wo die Sonnenstrahlen auf die blinkenden Wände fallen, spiegeln sie sich in Tausenden von Fenstern blutrot wider. Eine tote, schweigende Stadt, über deren Zinnen geräuschlos auf ihren weiten weissen Schwingen Eisvögel dahinsegeln; nur das dumpfe Blasen einiger Walfische unterbricht hin und wieder die unirdische Stille.
Zurück nach Westen! Aber auch dort starrt jetzt den Schiffen ein festes Eisfeld entgegen. Von allen Seiten bedroht, macht d’Urville einen zweiten Durchbruchsversuch, diesmal nach Norden; nach einstündigem Kampf findet er eine Fahrstrasse zwischen zwei Eisfeldern, die sich manchmal gefährlich einander nähern, aber schliesslich weit auseinandergehen. Am 27. erreicht er glücklich die Orkney-Inseln; drei Tage kreuzt er vor ihrer Nordküste, um einen Hafen zu suchen, wo sich die Mannschaft erholen soll; meilenweite Eisbänke haben alle Zugänge gesperrt, und ein schwerer Sturm zwingt ihn, schleunigst weiter nach Norden hin die hohe See zu gewinnen. Die Gicht quält ihn so, dass er einen Tag das Steuer abgeben muss; von der Mannschaft sind drei Leute krank.
Noch sind zwei Fahrstrecken Weddells weiter im Osten zu untersuchen. Offiziere und Mannschaft werden ja bezeugen müssen, dass schlechterdings nirgends ein Durchbruch nach Süden möglich war. Am 3. Februar kreuzen die Schiffe auf 55° 34′ s. Br. und 43° 32′ w. L. den dritten Weg; am selben Tag vor fünfzehn Jahren ist Weddell hier vom 65. Grad her zurückgekehrt. Und wieder dehnt sich hier offenes Meer bis zum südlichen Horizont! Auch am 4. weit und breit kein Eis! Die Matrosen jubeln: diesmal muss es gelingen! Aber ihr Führer hat alle Hoffnung aufgegeben. „Die Matrosen fürchten sogar, ich möge nicht weit genug vordringen“, schreibt er in sein Tagebuch; „sie dürfen ruhig sein, denn wenn ich umkehre, wird keiner mehr Lust haben, den Weg fortzusetzen.“
Noch am Abend des 4. ertönt wieder der Ruf der Wache: „Eisfeld in Süd!“ Es ist die Fortsetzung der schon gesehenen Eismauer, die sich immer weiter nach Osten hin erstreckt — d’Urville fährt darauf zu. Bald zeigt sich zur Linken ebenfalls eine Eismauer. Gerät er wieder in eine Sackgasse? Am liebsten kehrte er um, aber er fürchtet den üblen Eindruck auf die Mannschaft, die überzeugt ist: hier werde sich ein Durchgang finden. In gewissen Lagen, meint er, müsse der Führer seine eigene Meinung dem allgemeinen Wunsch opfern, selbst auf die Gefahr hin, sich ins Unglück zu stürzen. Zum drittenmal steuern die Schiffe in das wogende Packeis hinein, das hier von Robben belebt ist, die wie ungeheure Blutegel auf den Schollen liegen. Eine Weile geht es gut, aber die Eissägen am Scheg der beiden Schiffe werden abgerissen. Dichter Schneefall macht alle Bewegung unmöglich. D’Urville lässt die Schiffe an einem Eisberg festmachen, ein waghalsiger Versuch, den bisher noch kein Seefahrer hier unten gemacht hat. Die Tollkühnheit begeistert Offiziere und Matrosen. Dem Kommandanten aber ist dabei nicht wohl zumute. In der Nacht weckt ihn ein Poltern und Stossen gegen die Schiffswände, es kracht, als ob die Planken abrissen! Er stürzt auf Deck: der Wind ist umgesprungen, der „Astrolabe“ ist abgetrieben, das ganze Eis in Bewegung, die „Zelée“ ebenfalls wehrlos in seiner Gewalt. Eis ringsum, nur im Norden blinzelt hinter einem breiten Eisgürtel ein bläulich-schwarzer Streifen offenen Meeres. Dort allein ist Rettung! Jetzt beginnt ein Kampf ums Leben. „Astrolabe“ dringt wie ein Sturmbock nach Norden vor, ein paar Schiffslängen bricht er sich Bahn, dann steht er unbeweglich. Die Matrosen klettern aufs Eis hinunter, verankern eine Strecke vor seinem Bug die stärksten Taue an schweren Eisblöcken und ziehen so das Schiff langsam, unsagbar mühsam, vorwärts. Die „Zelée“ macht den gleichen Versuch. Es wimmelt hier von Robben, und der Jagdeifer macht trotz der drohenden Gefahr die Mannschaft halb verrückt. D’Urville kommandiert eine kleine Jagdabteilung ab, um wenigstens einige dieser Tiere für seine Sammlung zu erbeuten. Da sie sich gegen seinen Befehl vom Schiff entfernte und mit einem Boot geholt werden muss, darf keiner mehr das Deck verlassen. Auf der „Zelée“ derselbe Vorgang: ihr Boot mit etlichen Robbenjägern muss über die Eisschollen zum Schiff zurückgeschleppt werden; sie kommen halb tot, mit blutenden Händen, an Bord. Als sich beide Schiffe bis auf ein paar hundert Meter ans offene Wasser herangearbeitet haben, treibt ein plötzlicher Nordsturm sie wieder ins Eis zurück. Sie drehen und wenden sich hierhin, dorthin — kein Ausweg. Am nächsten Tag wird der Versuch, nach Norden durchzubrechen, wiederholt. In zehn Stunden rücken sie keine zwei Kilometer vor. Ein Mann geht auf Kundschaft drei Kilometer übers Eis; was er berichtet, ist niederschmetternd: das offene Wasser ist heute viel weiter entfernt als gestern, und am Rande des Eisfeldes ist eine Brandung, dass die Schiffe durch dieses Chaos unmöglich durchkommen. Ohne rettenden Wind ist die Expedition zum Untergang verurteilt, denn zu einer Überwinterung ist sie nicht ausgerüstet. Am Abend des 6. Februar wird d’Urville aus dem ersten Schlaf geweckt: ein Südwind hat das Eis gelockert und treibt die Schiffe langsam nach Norden! Der Kommandant will sofort unter Segel gehen, aber die Leute fürchten die Nachtfahrt, und er lässt sich von den Offizieren bestimmen, bis Tagesanbruch zu warten. Ein unseliger Entschluss! Um 3 Uhr wird geweckt. „Wie steht es mit dem Eis?“ ist d’Urvilles erste Frage an den wachthabenden Offizier. — „Wie gestern abend!“ Der Steuermann bestätigt die Nachricht. Der Wind ist um Mitternacht nach Norden umgesprungen, das Eis fester zusammengekeilt als gestern! Jetzt erfassen auch die Matrosen, dass sie durch ihren Nachtschlaf vielleicht ihr Leben verspielt haben. Das einzige, was sich tun lässt, ist, Schiff und vor allem Steuerruder gegen den Anprall der Eisschollen zu schützen. So vergeht der 7., der 8. Februar. Am Morgen des 9. weht ein leichter Wind aus Südost; die Schiffe machen sich sofort segelfertig. Zum drittenmal beginnt die mörderische Arbeit des Taueverankerns und Ziehens. Der Wind unterstützt sie. Am Nachmittag ist das offene Meer kaum mehr 600 Meter weit. Das Eis beginnt sich zu lockern, der Südwind frischt auf. „Taue einziehen! Alle Mann an Bord!“ Der „Astrolabe“ beginnt sich wieder zu bewegen, der Wind bläht die Segel. Der Kommandant atmet auf. Plötzlich Geschrei an Bord und verzweifeltes Rufen von draussen! Ein Mann ist noch auf dem Eis zurückgeblieben! Er rennt und springt über die Schollen, über Wasserrinnen, muss Umwege machen, stürzt, rafft sich wieder auf — niemand kann ihm helfen! Wenn er’s nicht schafft, ist er verloren — der Wind treibt das Schiff trotz aller Gegenbemühungen vorwärts —, und wenn es erst im freien Wasser ist, kann es nicht zurückkehren und noch einmal das Schicksal aller Kameraden aufs Spiel setzen! Die „Zelée“ ist weit entfernt und kann ihn ebensowenig retten. Furchtbare Augenblicke! Die Todesangst ist ein starker Motor. Der Unglückliche ist endlich so nahe heran, dass man ihm ein Tau zuwerfen und ihn heraufhissen kann. Er ist mehr tot als lebendig und ein volles Jahr lang ein kranker Mann. Wenige Stunden später sind die Schiffe aus dem Eis heraus und wieder Herr ihrer Bewegungen. Einen Teil ihres Kupferpanzers hat das Packeis weggerissen. Sonst aber sind sie noch völlig seetüchtig, und in einen Kampf mit dem Packeis wird ihr Kommandant sie nicht noch einmal führen.