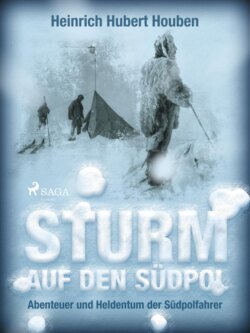Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Südpolarforschung vor Gericht
ОглавлениеDer antarktische Kontinent des Amerikaners Wilkes ist eine aller Wahrscheinlichkeit nach zutreffende Kombination, entdeckt aber hat er von dessen Küste auch nicht einen einzigen Punkt. Dass nicht überall Land ist, wo die Schiffe der amerikanischen Expedition Küsten gesehen haben wollen, beweist schon ein Jahr darauf der Führer der englischen Expedition, der über das vom „Porpoise“ schon Mitte Januar 1840 beobachtete Land hinwegsegelt, nachdem er die gesamte Ostküste des antarktischen Kontinents wirklich entdeckt hat. Die Nordostküste des antarktischen Kontinents liegt viel zu weit zurück, um vom 66. oder 67. Breitengrad aus — tiefer hinunter ist Wilkes nie gekommen — auch bei klarstem Wetter je sichtbar sein zu können. Erst auf 149° ö. L. schiebt sich die Küste des Kontinents so weit vor, dass Wilkes auf seiner Fahrt Stücke davon gesehen haben kann. Den Beweis auch dafür bleibt er aber schuldig, und wie es überhaupt mit der Zuverlässigkeit seiner Angaben steht, beweist ein Prozess, bei dem sehr ungewöhnliche Tatsachen ans Tageslicht kommen.
Die kühne Pionierfahrt 2700 Kilometer an der Küste des vermuteten Kontinents entlang ist eine Tat, der sich Wilkes mit Recht rühmen kann. Dass schon vor ihm Balleny die nach ihm benannten Inseln gefunden hat und die Existenz des von ihm gesehenen Sabrina-Landes gerade durch die von Wilkes behauptete Ausdehnung der Kontinentalküste bis zum 100. Längengrad sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, ist ihm überaus peinlich; er geht also über beide Entdeckungen des Engländers mit Achselzucken hinweg. Die Entdeckung des Adélie-Landes kann er den Franzosen nicht ernsthaft bestreiten. Die Priorität nimmt er aber auch hier in Anspruch, da seine Schiffe in jedem Fall einen andern Teil dieser Küste früher gesichtet hätten, wenn auch vielleicht nur wenige Stunden vorher. D’Urville kann ihm auf diese Behauptungen nicht mehr antworten, denn er ist am 8. Mai 1842 bei einem Eisenbahnunglück zwischen Versailles und Paris nebst seiner Frau und einem Sohn ums Leben gekommen. Auf der Karte, die Kapitän Ross nach dem grossen Erfolg der englischen Expedition herausgibt, sind die Balleny-Inseln und Adélie-Land, sogar die Clarie-Küste und Sabrina-Land als zuverlässige Entdeckungen verzeichnet; von den amerikanischen Landsichten findet sich nirgends eine Andeutung, obwohl sich Wilkes beeilt hat, gleich bei seiner Rückkehr nach Sydney dem auf der Fahrt nach Australien begriffenen neuen Nebenbuhler in einem Brief genaue Rechenschaft über seine Entdeckungen abzulegen, um sich auch diesem gegenüber die Priorität zu sichern. Er gönnt von seinem antarktischen Kontinent weder den Franzosen noch den Engländern den kleinsten Zipfel. Er gönnt aber nicht einmal seinen eigenen nächsten Mitarbeitern das geringste Verdienst, er nur allein will alles zuerst gesehen und entdeckt haben, und dieser brutale Egoismus wird ihm zum Verhängnis. Er hat vorsichtigerweise seinen wissenschaftlichen Stab auf die Polarfahrten nicht mitgenommen; die Kontrolle dieser exakten Beobachter war ihm unbequem. Aber seine Offiziere sehen ihm nicht weniger scharf auf die Finger und finden in seinen amtlichen Berichten Angaben, die den wahren Sachverhalt auf den Kopf stellen. Ihr Ehrgefühl empört sich, und sie zwingen ihn noch während der gemeinsamen Reise, im Herbst 1842, vor ein Kriegsgericht, das auf einem amerikanischen Schiff, der „North Carolina“, zusammentritt. Die Anklage umfasst elf Punkte: Missbrauch seiner Macht gegen Untergebene, rechtswidrige Annahme des Kapitänstitels usw. Die Hauptbeschuldigung aber ist: Fälschung seiner Tagebücher, um die Daten seiner Entdeckungen denen der Franzosen voranzusetzen und sich allein die Ehre aller Entdeckungen, auch seiner Untergebenen und Mitarbeiter, anzueignen! Der Ausgang des Prozesses ist nicht bekannt, und da Leutnant Wilkes im Dienst der amerikanischen Marine bleibt — zum Kapitän befördert wird er allerdings erst 1855 mit 57 Jahren —, dürfte er vor dem Kriegsgericht noch einigermassen glimpflich davongekommen sein. Die Aussagen seiner Offiziere aber wurden der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, und eine Probe daraus genügt, um die Glaubwürdigkeit dieses Expeditionsführers rettungslos zu erschüttern.
Der Stichtag den Franzosen gegenüber ist der 19. Januar 1840, an dem sie das Kap der Entdeckung sichten; anderntags landen sie an der Insel vor Adélie-Land auf 140° 12′ ö. L.; Wilkes muss also bis zum 19. mit aller Sicherheit Land wahrgenommen haben, wenn von einer Priorität vor den Franzosen die Rede sein kann. Und das behauptet er in der Erklärung, die er am 13. März 1840 veröffentlicht, und in einem amtlichen Bericht vom 11. März, als er eben von d’Urvilles Entdeckung gehört hat. Was sagen dazu die Offiziere?
Leutnant Alden vom „Vincennes“, dem von Wilkes befehligten Flaggschiff, sagt aus: „Von einer Landentdeckung am neunzehnten Januar habe ich erst in Sydney sprechen gehört, als wir gleich nach unserer Ankunft erfuhren, dass die Franzosen am Nachmittag dieses Tages ihre Entdeckung gemacht hätten. Leutnant Wilkes war damals an Land; als er an Bord zurückkam, empfing ich ihn an der Leiter mit der Bemerkung, die Franzosen seien uns also zuvorgekommen. ‚O nein!‘ antwortete er mir. ‚Erinnern Sie sich nicht, dass Sie mir am Morgen des Neunzehnten Anzeichen von Land gemeldet haben?‘ Ich konnte mich dessen im Augenblick nicht entsinnen und erwiderte, ich würde im Logbuch nachsehen. Dessen Prüfung überzeugte mich zunächst, dass ich am Morgen dieses Tages die Wache hatte, und diese Tatsache in Verbindung mit andern Umständen erinnerte mich daran, dass ich tatsächlich seine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt hatte, das wie Land aussah. Das ging so zu: Das Wetter war am ganzen Morgen neblig gewesen. Etwas nach acht Uhr hörte ich das Getöse der See, die sich an einem nahen Eisberg brach. Ich benachrichtigte Wilkes davon, und er kam aufs Oberdeck. Der Nebel stieg nach und nach, so dass wir den Eisberg sehen konnten; bald darauf wurde es ziemlich klar. Ich beobachtete den südlichen Horizont, und als Wilkes gerade im Begriff war, wieder hinunterzugehen, sagte ich ihm: ‚Da ist etwas, das wie Land aussieht.‘ Er schien diese Meldung gleichgültig aufzunehmen, antwortete nichts und stieg hinunter.“
„Glauben Sie, dass es Land war?“ fragt der Richter.
„Nach dem, was ich jetzt weiss, war es kein Land.“
„Glaubten Sie es, als Sie ihm das sagten?“
„Nein, ich glaubte es nicht, sonst würde ich diesen Vorfall im Logbuch verzeichnet haben.“
„Wurden Sie durch solche Anzeichen von Land öfter getäuscht?“
„Nicht öfter als andere Seefahrer. Bis zum fünfundzwanzigsten Januar hielt ich das Vorhandensein von Land in diesen Regionen für sehr zweifelhaft. An diesem Tage aber sagte mir Leutnant Underwood, der das Mastwerk hinaufgestiegen war, im Süden und Westen befinde sich ganz gewiss Land. Wir waren an diesem Tag auf 147° 42′ ö. L.“
„War am Fünfundzwanzigsten klares Wetter?“
„Der Fünfundzwanzigste war ein wunderbar heller Tag. Ich sah das Land, als gerade ein Reef in die Marssegel eingebunden wurde, und zeigte es Leutnant Wilkes an; er schaute einige Zeit hin und sagte: „Wahrhaftig, es ist Land.“ Ehe wir mit Einbinden des Reefs fertig waren, wurde das Schiff durch Windstösse und Schneesturm weggetrieben. Meine Angaben im Logbuch sind: ‚Um 9 Uhr 45 Minuten Land in SSO entdeckt oder etwas, was entschieden wie hohes, schneebedecktes Land aussieht‘.“
„Versuchte man, am Neunzehnten zu loten oder sich dem Land zu nähern?“
„Im Gegenteil, ich erhielt den Befehl, das Schiff in offener See zu halten, und soviel ich weiss, wurde keine Sondierung vorgenommen. Am Abend sahen wir den ‚Peacock‘ gegen SW steuern.“
Aus einer weitem Äusserung dieses Zeugen geht hervor, dass man auf dem „Vincennes“ mit wirklicher Sicherheit erst am 28. Januar Land sah auf 140° 24′ — also die Küste des Adélie-Landes! Die Beobachtung vom 25. erschien noch nicht einwandfrei. Und wäre am 19. wirklich Land in Sicht gewesen, so hätte Wilkes sofort versuchen müssen, ihm näher zu kommen; statt dessen gab er den Befehl, das Schiff in offener See zu halten! Und welcher Expeditionsführer wird die Befehlshaber der Begleitschiffe, sobald er eines davon erreicht, nicht sofort auf eine so entscheidende Entdeckung aufmerksam machen? Am 26. Januar hat Wilkes eine Unterredung mit Leutnant Ringgold, dem Führer des „Porpoise“, der schon am 13. Inseln gesehen haben will, die später nach ihm benannt werden, eine immerhin beachtenswerte Entdeckung, die jedoch der Kommandant durchaus nicht gelten lassen will, weil er sie nicht selbst gemacht hat. Wilkes berichtet ihm auch bei dieser Begegnung von dem freudigen Ereignis des 25., aber vom 19. fällt kein Wort, und Ringgold hört erst davon, als er in Neuseeland ankommt. Leutnant Hudson vom „Peacock“ jedoch glaubt am 19. Januar ebenfalls, Land zu sehen, überzeugt sich aber eines Bessern und ist seiner Sache so gewiss, dass er im Logbuch das Wort Land durch „Eisberg“ ersetzen lässt, um bei der Wahrheit zu bleiben. Der Bericht über den 19. Januar, wie er im vorigen Kapitel zunächst nach den eigenen Äusserungen des Expeditionsführers zu geben war, erweist sich demnach als eine bewusste Fälschung, als eine „Korrektur“ der Wahrheit, lediglich zum grösseren Ruhm seines eigenen Namens und zur Herabsetzung des Mannes, der nun einmal der wirkliche Entdecker der Küste des antarktischen Australquadranten gewesen ist, des Franzosen d’Urville, der selbstlos genug war, das Hauptverdienst daran sofort seinem Mitarbeiter Dumoulin zuzuerkennen.