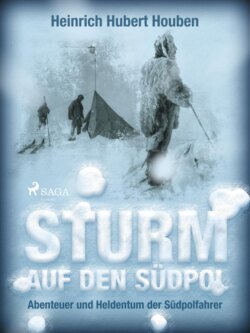Читать книгу Sturm auf den Südpol. Abenteuer und Heldentum der Südpolfahrer - Heinrich Hubert Houben - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der antarktische Kontinent
ОглавлениеDer Kommandant der amerikanischen Expedition, Leutnant Wilkes, hat alle Ursache, mit seiner Instruktion zufrieden zu sein, die ihm verbietet, irgend etwas über das Ergebnis seiner Reise in der Öffentlichkeit verlauten zu lassen. Auf seiner ersten Kreuzfahrt in der Antarktis hat er, trotz seiner fünf Schiffe, noch weniger Erfolg gehabt als sein französischer Konkurrent d’Urville. Seine Flotte ankert am 22. November 1838 in Rio de Janeiro und kommt erst im Februar in der Nassaubai, im Orange-Hafen, an der Ostküste der Hoste-Insel, an. Hier in Feuerland bleibt der wissenschaftliche Stab mit dem Schiff „Relief“ zu Forschungen physikalischer, naturwissenschaftlicher, geographischer und ethnographischer Art. Die vier andern Schiffe fahren in zwei Gruppen südwärts. Die Jahreszeit ist schon viel zu weit vorgerückt, um die beiden Vorstösse nach Süden zu machen, die für den ersten Polarsommer auf dem Programm der grossangelegten Expedition stehen. Wilkes nimmt daher nur den zweiten Punkt seiner Instruktion in Angriff. Ende des Sommers sind vielleicht die Eismassen an den Küsten des Graham- und Palmerlandes in stärkerer Auflösung begriffen, als Cook sie im Januar 1774 vorfand. Er schickt daher den „Peacock“ (Pfau) und den „Flying Fish“ (Fliegender Fisch) unter Kapitän Hudson auf die Spur Cooks und Bellingshausens nach Südwesten, während er selbst am gleichen Tage, am 25. Februar 1839, mit dem „Porpoise“ (Delphin) und dem „Seagull“ (Möwe) nach den Süd-Shetland-Inseln geht.
Die beiden ersten Schiffe können noch einigermassen von Glück sagen, sie kommen wenigstens bis zu einer ansehnlichen Breite hinunter, „Peacock“ bis zum 69. Grad, „Flying Fish“, geführt von Leutnant Walker, gar bis zum 70. auf 100° w. L., also fast bis zu Cooks südlichstem Punkt. Dort glaubt Walker Anzeichen von Land zu bemerken. Ungeheure Eismassen bedrängen beide Schiffe und zwingen sie, schleunigst umzukehren. Schnee und Nebel machen ihnen viel zu schaffen. Mehr als eine flüchtige Studie der Eisverhältnisse dort unten ist dieser Vorstoss nicht. Das Beischiff geht nach Orange-Hafen zurück, während Kapitän Hudson mit dem „Peacock“ gleich nach Valparaiso segelt, dem verabredeten Treffpunkt, wo sich die Flotte wieder versammeln soll.
Wilkes und seine Mannschaft sind Neulinge in der Polaris, und als sie am 1. März nördlich der Süd-Shetland-Inseln den ersten Eisinseln begegnen, fällt manchem das Herz in die Hosen. So ungeheuer hat er sich diese Meeresbewohner nicht vorgestellt. Dabei sind es nur die Vorboten, die wackeligen Greise, die schon auf dem letzten Loche pfeifen und in wenigen Tagen ganz zu Wasser werden müssen. Was werden die Matrosen erst zu den schwimmenden Bergen sagen, die frisch aus der Eisfabrik tief unten kommen! Bei der George-Insel, der mittelsten Süd-Shetland-Insel, sehen sie schon einige Proben davon. Wilkes möchte südwestlich von dort die kleine Bridgeman-Insel untersuchen, die nur ein Trümmerhaufen, aber ein speiender Vulkan ist; Nebel und erstickende Schwefeldämpfe, hinter denen sie sich verbirgt, machen eine Landung unmöglich. Also vorwärts nach Süden! Am 3. März kreuzt er vor Louis-Philipp-Land, das d’Urville ein Jahr vorher aufgenommen hat; doch davon kann er noch nichts Näheres wissen. An die Küste kommt er ebensowenig heran wie sein Vorgänger. Eisberge umkreisen die Schiffe wie Raubtiere ihre Beute. Um die Ostküste des noch völlig rätselhaften Palmerlandes zu finden, geht er nach Südwesten, an Trinityland vorüber; aber der Wind ist ihm entgegen, Nebel und Schneefälle stören alle Untersuchungen, die Mannschaft leidet ungeheuer unter Nässe und Kälte. Auf solche Strapazen sind die Schiffe denn doch nicht eingerichtet, es fehlt an genügendem Unterkunftsraum, es fehlt an zweckmässiger Kleidung, es fehlt an allem. Am 5. März schon gibt Wilkes die Weiterfahrt auf; Leutnant Johnson soll mit dem „Seagull“, der am meisten gelitten hat, geradeswegs nach Orange-Hafen zurückkehren, kommt aber zunächst nur bis zur kleinen Deception-Insel, der südlichsten der Süd-Shetland-Inseln, wo er des Unwetters wegen eine Woche bleibt und sich um die Untersuchung dieses ebenfalls vulkanischen Eilandes verdient macht; er entdeckt einen Krater von 500 Meter Durchmesser und viele kleine Krater, aus denen heisse Dämpfe aufsteigen; am Ostende des grossen sprudelt sogar eine heisse Quelle. Über seinen Aufenthalt hier hinterlässt er in einer Flasche an einer Fahnenstange einen Bericht, den drei Jahre später ein Landsmann, der amerikanische Walfänger Kapitän Smiley, als erster öffnet, liest und fortsetzt, wie das bei solchen Gästebüchern in der Polaris oder auf selten besuchten Inseln und Küsten der Weltmeere üblich ist. Innerhalb dreier Jahre hat die Deception-Insel übrigens grosse Veränderungen erlitten; Smiley zählt 1842 nicht weniger als 13 tätige Vulkane dort und versichert, die ganze Südseite der Insel habe geradezu in Feuer gestanden. — Nach überaus stürmischer Fahrt trifft der „Seagull“ mit völlig erschöpfter Mannschaft am 22. März wieder im Orange-Hafen ein. Sieben Tage später kommt auch Wilkes mit dem „Porpoise“ dort an; er hat vergeblich nach etlichen Inseln gesucht, die von Walfängern östlich von Louis-Philipp-Land gesichtet worden, aber wieder verlorengegangen sind und jedenfalls nichts als gewaltige Eisberge waren; die Strömung hat das Schiff weit nach Osten fortgerissen, bei den Süd-Orkney-Inseln ist es um ein Haar gescheitert, und unter der Mannschaft hat der Skorbut böse Verheerungen angerichtet. Für eine Expedition, die mit fünf Schiffen, 83 Offizieren, 12 Fachgelehrten und 345 Mann sonstiger Besatzung ins Feld rückte, sind diese Ergebnisse gar zu bescheiden. Wenn der zweite Streifzug nicht bedeutend grössere Ausbeute bringt, muss der Kommandant den antarktischen Teil seiner Expedition als völlig gescheitert betrachten. Das duldet sein Ehrgeiz nicht — sein Ruhm und das Ansehen Amerikas stehen auf dem Spiele. Der zweite Versuch muss zu einem unbestreitbaren Erfolg führen!
Auf der Weiterfahrt die chilenische Küste hinauf geht „Seagull“ mit der ganzen Mannschaft unter. Zum Ersatz dafür schickt die Marineverwaltung den „Vincennes“. Den „Relief“ hat der Kommandant als zu schlechten Segler nach Hause gesandt. Nach einer sehr ergebnisreichen Kreuzfahrt durch Ozeanien, vielfach auf den Spuren der französischen Expedition, die ärgerlicherweise auch hier zuvorgekommen ist, treffen die vier Schiffe Ende November 1839 in Port Jackson bei Sydney ein, zur Vorbereitung auf den zweiten Besuch in der Antarktis. Die Kolonisten in Neu-Süd-Wales haben schon so viel von der sorgfältigen Ausrüstung der bevorstehenden englischen Expedition gehört und gelesen, dass sie sich über den ganz alltäglichen Zustand der amerikanischen Schiffe nicht genug wundern können. „Flying Fish“ macht wegen seiner Kleinheit Sensation. Und keine ordentlichen Heizvorrichtungen in den Schiffen? Wo sind die Eissägen? Keine antiskorbutischen Mittel an Bord? Der Kommandant selbst muss den unbequemen Fragern zugeben, dass die Marineverwaltung wenig Umsicht bewiesen hat und die Ausrüstung der Expedition, trotz des ihr eingeräumten unbeschränkten Kredits, etwas Hals über Kopf vor sich ging. Für die Südsee mag sie genügen — aber für eine Polarfahrt, auf der ein Erfolg unter allen Umständen erzwungen werden soll? Lebensmittel für zwölf Monate sind in keinem der Schiffe unterzubringen, Brennmaterial höchstens für sieben Monate! Muss ein Schiff im Eis überwintern, dann ist sein Schicksal besiegelt. Das Oberwerk des „Peacock“ ist sogar derart verfault, dass er kaum noch als seetüchtig gelten kann; aber ihn neu instandzusetzen, dazu ist keine Zeit, und ihn zurücklassen? Das würde auf das ganze Unternehmen ein gar zu übles Licht werfen. Programmgemäss fahren die vier Schiffe am 26. Dezember los; fünf Tage später segeln die Franzosen von Hobart ab. Wer wird der erste sein, der das — gemeinsame Ziel erreicht?
Die ersten fünf Tage hindurch sind die Amerikaner vom Wetter begünstigt. Aber schon am 2. Januar 1840 verliert das Flaggschiff „Vincennes“ den „Flying Fish“ bei Nebel aus dem Gesicht, am 3. auch den „Peacock“. „Vincennes“ und „Porpoise“ schwimmen am 6. Januar auf 157° 35′ ö. L. und 53° 30′ s. Br. Bei der Macquarie-Insel soll die Flotte sich wieder vereinigen. Wilkes mag aber mit Warten keine Zeit verlieren und fährt gleich zum zweiten Stelldichein bei den Emerald-Inseln noch weiter östlich, findet diese aber nicht und geht in Begleitung des „Porpoise“ gleich nach Süden. Am 10. Januar begegnet ihnen der erste Eisberg, dem bald ganze Scharen folgen, und auf 64° 11′ s. B. macht ein festes Eisfeld alle Fortschritte nach Süden unmöglich. „Porpoise“ verschwindet im Nebel und kommt am weitesten nach Osten, anscheinend bis 160° 30′; am 13. Januar glaubt sein Führer, Leutnant Ringgold, im Südwesten Land zu sehen, zweifellos die Balleny-Inseln, von deren im Februar 1839 schon erfolgter Entdeckung er nichts weiss. Von da fährt er nach Westen, wohin das Flaggschiff schon vorausgegangen ist, und trifft am 15. vor der Eisschranke den „Peacock“, der von der Macquarie-Insel herkommt. Am 16. Januar ist auch der „Vincennes“ wieder in Sicht; sie steuern nun gemeinsam nach Süden, denn auf allen drei Schiffen will man Land gesehen haben, sind aber andern Morgens so dicht von Eisbergen umschlossen, dass jedes auf eigene Faust sehen muss, wie es aus diesen gefährlichen Engpässen wieder hinauskommt. Zwei Tage segeln sie weiter nach Westen und am 19. in eine tiefe Eisbucht hinein, wo sich bei klarem Wetter ein weiter Blick bietet auf „eine ungeheure Masse“, wie Wilkes sagt, die von allen an Bord für Land gehalten wird. Sie ist grau und düster, steigt im Südosten und Südwesten wohl bis gegen 600 Meter an und teilt sich deutlich in mehrere von Schnee bedeckte Ketten. Alle Versuche, näher heranzukommen, macht eine undurchdringliche Reihe von Tafeleisbergen unmöglich, obgleich die Entdeckung unzweifelhaften Landes die Besatzung zu heldenmütigen Anstrengungen begeistert. Der „Peacock“ gerät dabei so übel mit dem Eis zusammen, dass er am 25. abgekämpft ist; mit zerbrochenem Steuer und fast durchgeriebenem Vordersteven erreicht er noch glücklich offenes Wasser, aber er scheidet aus dem Rennen aus, und Kapitän Hudson bringt ihn sogleich nach Sydney zurück.
Die Mannschaft der Schiffe erlebt in diesen Tagen ein seltenes Schauspiel. Sie sehen einen Walfisch, der sich ungewöhnlich heftig bewegt, mit dem Schwanze das Wasser zu Schaum zerpeitscht und offenbar die krampfhaftesten Anstrengungen macht, sich von etwas, das ihn plagt, zu befreien. Beim Näherkommen sehen sie, dass ein etwa 12 Meter langer Fisch, ein Schwertwal oder Mörder, wie er genannt wird, mit seinem furchtbaren Rachen das weit grössere, aber machtlose Tier am Unterkiefer gepackt hat und offenbar nicht eher loslassen wird, als bis der Wal sich verblutet hat und die Beute seines Todfeindes wird. Das Ende des Kampfes entzieht sich den Augen der Zuschauer.
„Bincennes“ und „Porpoise“ setzen nun jeder für sich ihren Weg nach Westen fort und pirschen sich an die Küste heran, die bereits von den Franzosen entdeckt ist. Am 27. Januar liegt der „Vincennes“ 800 Meter vor der Küste des Adélie-Landes. „Nach Osten und Westen hin“, versichert Wilkes, „konnten wir von unserer Stellung (140° 2′ 30″ ö. L. und 66° 45′ s. B.) das Land ganz deutlich 110 Kilometer weit verfolgen; da demnach kein Zweifel mehr an der Existenz eines ausgedehnten Landes bestand, gab ich ihm den Namen des antarktischen Kontinents.“ Er ist überzeugt, dass sich die Küste dieses Kontinents mindestens bis nach Enderby-Land auf dem 50. Längengrad hinzieht, und will ihr folgen, so weit er mit seinem Schiff durchkommt. Die Ärzte machen ihm Vorstellungen wegen der Gesundheit der Leute; sie haben am 1. Februar 20 Patienten; ein Sturm am 2. erhöht die Zahl auf 30. Der Kommandant will von nichts hören — nur vorwärts! Die Leidenschaft des Eroberers hat ihn gepackt. Er kommt an der Clarie-Küste der Franzosen vorbei und sichtet fast täglich neues Land — wenn es keine Eisberge sind! So rast er weiter, um auf jeden Fall den Zusammenhang des Enderby-Landes mit seinem antarktischen Kontinent zu beweisen. Aber irgendeinen festen Punkt zu gewinnen, an der Eismauer der Küste oder wenigstens an einer kleinen Felseninsel zu landen, gelingt ihm nicht, der antarktische Kontinent verschliesst sich ihm hartnäckig, und am 17. Februar schneiden ihm auf 97° 37′ ö. L. unermessliche Eisfelder, die sich nach Norden vorschieben, endgültig den Weg ab; das letzte Stück Küste, das er gesehen zu haben glaubt, nennt er Termination-Land. Immerhin hat er 2700 Kilometer der Küste abgefahren und so oft Land gesichtet, dass der Zusammenhang dieser einzelnen Punkte, von denen allerdings keiner fest erwiesen ist, mehr als Wahrscheinlichkeit gewinnt und sich geradezu notwendig zu der Vorstellung eines gewaltigen Kontinents verdichtet. Die Entdeckung dieses Kontinents ist nun das Verdienst der amerikanischen Expedition, das wird Aufsehen genug in der Welt machen, damit können die Franzosen und die Engländer nicht konkurrieren, und in diesem angenehmen Bewusstsein kehrt Wilkes nach Sydney zurück. — Leutnant Ringgold hat mit dem „Porpoise“ fast die gleiche Fahrt gemacht und ebenfalls so häufige „Anzeichen von Land“ beobachtet, dass die Annahme eines zusammenhängenden Kontinents dadurch bestätigt erscheint. Der „Porpoise“ auch war es, der am 29. Januar der französischen Expedition begegnete; Leutnant Ringgold hat das Manöver d’Urvilles missverstanden; als er den „Aftrolabe“ Segel zusetzen sah, glaubte er, der Franzose wolle sich aus dem Staube machen, und wich nun seinerseits einer Ansprache aus. — Der verschollene „Flying Fish“ hat gar nichts geleistet: er ist leck geworden und, da infolge der Feuchtigkeit die halbe Mannschaft erkrankte, am 5. Februar umgekehrt. — Die vier Schiffe versammeln sich wieder bei den Auckland-Inseln, wo auch der wissenschaftliche Stab eintrifft, den Wilkes merkwürdigerweise in Sydney gelassen und von der Polarfahrt ausgeschlossen hat! Von da gehen sie aufs neue in See zur Fortsetzung ihrer Weltumsegelung, von der sie erst 1843 heimkehren.
Eine peinliche Überraschung aber wartet in Sydney auf Wilkes. Die französische Konkurrenz hat, besonders mit Rücksicht auf die merkwürdige Begegnung ihrer Schiffe mit dem „Porpoise“ am 29. Januar, sich beeilt, die Ergebnisse ihrer Fahrt bekanntzumachen; d’Urville prahlt zwar nicht mit der Entdeckung eines gewaltigen antarktischen Kontinents, der keine so neue Vorstellung ist, wie der Amerikaner offenbar glaubt, und einstweilen nur als eine naheliegende Hypothese oder Synthese gelten kann; der kluge Franzose bescheidet sich mit dem, was unbestreitbar ist, mit dem festen Punkt, den sein tüchtigster Mitarbeiter Dumoulin betreten hat, wenn es auch nur eine kleine Insel ist, und raubt dem amerikanischen Konkurrenten durch die Benennung und Aneignung des Adélie-Landes und der Clarie-Küste zwei kostbare Perlen aus dem glitzernden Reif des antarktischen Kontinents! Das kann Wilkes unmöglich dulden! Sofort erlässt er eine öffentliche Erklärung, worin er die Priorität der Entdeckung der ganzen Küstenlinie vom 160. bis zum 100. Längengrad für sich in Anspruch nimmt und mit genauen Daten nachweist, dass seine Schiffe den französischen auch in der Entdeckung der ersten Küstenstriche seines antarktischen Kontinents zuvorgekommen sind. Wenn diese Daten stimmen, dann steht es schlimm um d’Urvilles Entdeckerruhm; er ist zwar nur um Tage und Stunden, aber doch zu spät gekommen! Ja — wenn!